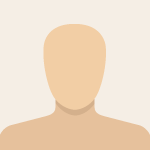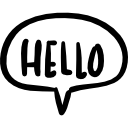Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- Wer »die KI« sagt, ist schon reingefallen
- =========================================
- Was da kommt, ist keine neue Kollegin. Es ist unsere
- kollektive Geistesarbeit, im Dienste von Krawattenidioten.
- Text: Dietmar Dath
- JACOBIN #17, S. 014ff
- 016
- I. Vorspiel und Gleichnis
- -------------------------
- Es war einmal eine kleine Gemeinschaft tapferer
- Menschen in einer entlegenen, unwegsam bergi-
- gen Gegend. Eine junge Frau dort hatte einen Un-
- fall und danach ein kaputtes linkes Bein. Sie konnte
- nicht mehr klettern, sammeln, jagen und kaum die
- wilden Kinder ihrer Verwandten hüten, denn diese
- Kinder liefen und kletterten ihr andauernd davon.
- Sie wurde natürlich Erfinderin. Ihre Maschinen
- aus Holz und Seilen erleichterten den anderen das
- Leben. Ein nicht unberechtigter Kult der Bewun-
- derung kam um sie auf. Als sie starb, fingen ihre
- Schülerinnen und Schüler an, links zu hinken. Sie
- pflegten das Erbe der Bewunderten auch, indem sie
- neue Erfindungen machten.
- Eines Tages kamen Menschen von woanders ins
- Gebirge.
- Die staunten über die technische Welt dort oben.
- Dann verrieten sie den Bergmenschen, dass jenseits
- der Berge die Technik noch viel weiter war.
- »Man hat bei uns Roboter«, sagten sie, »die den-
- ken, genau wie wir und ihr!«
- Da fragten die Bergmenschen: »Denken sie
- schon gut genug, dass sie hinken können?«
- 017
- II. Facharbeit, Affen und Papageien
- -----------------------------------
- Neuerdings bringen gewisse Personen, die schlecht
- denken, reden und schreiben, den Maschinen das
- Schreiben, Reden und Denken bei. Anders als die-
- jenigen, die in den Bergen hinkende Roboter bauen,
- können sie sich dabei aber nicht darauf herausreden,
- dass sie von Nachrichten isoliert leben, die sie auf
- bessere Ideen bringen könnten.
- Reden wir über qualifizierte, oder wie man frü-
- her sagte: geschickte Arbeit. Wird sie gerade abge-
- schafft? Die Behauptung steht vielfach im Raum:
- Wir haben jetzt ja künstliche neuronale Netze, bald
- sogar kosteneffizientes Quantencomputing, wozu
- brauchen wir da noch Fachpersonal? Umgekehrt
- aber fragt man auch: Ordnen sich um die neue Tech-
- nik vielleicht neue Fächer, entstehen da neue Quali-
- fikationswege für Lernwillige?
- Zwischen 2015 und 2017 haben Rune Åberg,
- Duncan Gallie und andere Gelehrte in Ländern
- wie Schweden und Großbritannien, also in arbeits-,
- verwaltungs- und überhaupt verfahrenstechnisch
- weit fortgeschrittenen Wirtschaftszonen, einige
- Untersuchungen angestellt, die zu Ergebnissen
- führten, aus denen sich schließen ließe, dass ein
- altbekannter Befund der an Marx geschulten Ka-
- pitalismuskritik nicht (mehr?) stimmt.
- Im dritten Band seines Hauptwerks Das Ka-
- pital behauptet Marx für das von ihm korrekt
- vorausgesehene Zeitalter der zunehmenden Kapi-
- talkonzentration eine Tendenz der Veränderung
- des Arbeitslebens, die wir heute zwar tatsächlich
- vorfinden, die aber im Zeichen der Digitalisierung
- von anderen Tendenzen konterkariert zu werden
- scheint.
- Modisches Managergeschwätz nennt jene von
- Marx entdeckte Tendenz mit pseudosportlichem
- Vokabular gern »Flexibilisierung«. Gemeint ist,
- dass Krawattenidioten im siebenundzwanzigsten
- Stock irgendeines Hochhauses in irgendeinem
- Bankendistrikt irgendeiner reichen Großstadt per
- Headset zahllose abhängig Beschäftigte willkürlich
- durch die Welt schubsen und ihnen dabei jede Chan-
- ce verwehren, sich unter Berufung auf ihre ausbil-
- dungsbedingte Unersetzlichkeit in qualifizierten
- Interessenverbänden zu organisieren.
- Das entspricht der Diagnose von Marx, die
- Übermacht des Kapitals neige zur »Aufhebung al-
- ler Gesetze«, »welche die Arbeiter hindern, aus ei-
- ner Produktionssphäre in die andre oder aus einem
- Lokalsitz der Produktion nach irgendeinem andern
- überzusiedlen.«
- Die Monopole streben, heißt es da weiter, die
- totale »Gleichgültigkeit des Arbeiters gegen den
- Inhalt seiner Arbeit« an, mittels umfassender »Re-
- duzierung der Arbeit in allen Produktionssphären
- auf einfache Arbeit«, also auf etwas, das zur Not
- auch ein dressierter Affe machen kann (oder im
- Call-Center: ein Papagei).
- Der »Wegfall aller professionellen Vorurteile bei
- den Arbeitern«, von dem in der betreffenden Marx-
- Passage die Rede ist, mag bei oberflächlichem Lesen
- hübsch weltoffen klingen. Doch in dem Fall, dass
- dabei vormalige »Fachkräfte« gemeint sein sollten,
- ist das keineswegs ein Merkzeichen der Emanzipa-
- tion von etwas, das der freien Entfaltung mensch-
- licher Subjektivität hinderlich wäre, sondern bloß
- eine besonders wirkungsvolle Spielart der »Unter-
- werfung des Arbeiters unter die kapitalistische
- Produktionsweise«.
- 018
- Manch ein Aufmacher im Wirtschaftsteil einer Qua-
- litätszeitung, die immer mehr Rechtschreib- und
- Grammatikpatzer zulässt, weil sie die menschliche
- Korrekturarbeit spart, trötet selbst in diesem Zu-
- sammenhang von »Chancen«, aber dahinter steckt
- nur das Kommando: »Heute hier, morgen da, wie
- das Kapital es will.« Ein Berufsleben unter dieser
- Fuchtel wird schnell zum irren Wechsel von War-
- terei und atemloser Eile für alle, die kein Kapital
- besitzen.
- Die Arbeitsmedizin darf dann, wenn sie über-
- haupt zu Wort kommt, nur noch vorwurfsvoll
- konstatieren, dass so etwas den Homo sapiens kei-
- neswegs langsamer oder angenehmer verschleißt als
- das Hacken und Herumkriechen in Minenschäch-
- ten oder das vierzig Jahre lang währende Ausführen
- hirnloser Handbewegungen am Fließband.
- Im Bannkreis der Informationstechnologie-
- branche (»IT«), also auf demjenigen Zweig der
- Gesamtökonomie, an dem die Treibmittel der Di-
- gitalisierung reifen, kann man aber auch Vorgän-
- ge ganz anderer Art erleben. Wer dieses Business
- kennt, wird nicht nur die Ersetzung geschickter
- Arbeit durch einfache kennen, sondern umgekehrt
- auch die Ersetzung einfacher Arbeit vieler Leute
- durch die geschickte Arbeit Einzelner.
- Im Frühjahr 2024 zum Beispiel machte eine Ge-
- schichte im Netz die Runde, die unter anderem auf
- der britischen Tech-Webseite The Register zu lesen
- war und von einem Profi erzählte, der bei einem
- Anbieter für teure Speicher-Arrays (also Daten-
- schatztruhen) unter Vertrag stand. Den holte ein
- Klient per Flugzeug in eine europäische Stadt, wo
- er das Wochenende in einer Hotelsuite für 5.000
- Dollar pro Nacht verbrachte, »auf Abruf«, plus
- Gefahrenzulage, nur um am Ende ein Problem zu
- lösen, dessen Beseitigung nicht mehr als fünf Mi-
- nuten konzentrierten Nachdenkens und fachkun-
- digen Handelns erforderte. Wenn das Lohnarbeit
- ist, dann jedenfalls eine komfortable, für die Lenins
- Wort von der »Arbeiteraristokratie«, die am Klas-
- senkampf kein Interesse hat, fast eine Verniedli-
- chung darstellt.
- Wer die Wochenend-Hotelgeschichte als bloße
- Anekdote abtun will, sollte sich den Studien von Åb-
- erg, Gallie und ihresgleichen stellen, die ich bereits
- erwähnt habe: Während sich in den produktions-
- technisch weitestfortgeschrittenen Gegenden die
- Zahl der in klassischer Industrieproduktion Be-
- schäftigten seit den 1960er Jahren stark verringert,
- ja teils sogar halbiert hat, ist bis 2010 der Anteil der
- Hochqualifizierten von 7 bis 15 Prozent auf 32 bis 40
- Prozent angewachsen. Seit den 1990er Jahren ver-
- mehren sich in besagten Zentren sowohl die beson-
- ders hoch- wie die besonders niedrigqualifizierten
- Jobs anteilig relativ zum Gesamtbeschäftigungsvo-
- lumen. Man spricht von »Polarisierung«: mehr Bil-
- ligjobs, mehr Elitejobs, weniger Mittelfeld. Sogar im
- legendär sozialstaatlichen Schweden lässt sich das
- seit der Jahrtausendwende nachweisen.
- Hat Marx sich mit seiner These der kapitalge-
- triebenen Nivellierung aller Qualifikationen also
- geirrt?
- 019
- III. Woher kommt die Klickerei?
- -------------------------------
- Im März 2024 nahm ich als journalistischer Be-
- obachter an der Frühjahrstagung der American
- Chemical Society (ACS) in New Orleans teil. Der
- ungarische Wissenschaftler Oldamur Hollóczki
- hielt dort einen Vortrag über seine Forschungen zur
- Frage der Verbreitung von Mikroplastikteilchen in
- lebenden Organismen.
- Er berichtete von Computersimulationen, die
- unter anderem der (mittlerweile auch experimen-
- tell bestätigten) Vermutung nachspüren sollen,
- dass solche künstlichen Partikel sogar die Schran-
- ke zwischen dem Blutkreislauf und dem Hirn über-
- winden, obwohl diese Schranke eigentlich zu den
- bestgesicherten Firewalls der Biosphäre zählt. Im
- Zuge seiner Ausführungen ließ Hollóczki die Be-
- merkung fallen, er bevorzuge Modelle, in denen die
- Mikroplastikfetzen möglichst klein ausfallen.
- Aus dem Publikum wollte jemand wissen, wes-
- halb. »Weil kleinere Bruchstücke weniger Moleküle
- enthalten als große. Dann muss die Maschine we-
- niger komplizierte Wechselwirkungen berechnen«,
- erklärte der Wissenschaftler.
- Im Anschluss an den Vortrag fiel einer Kolle-
- gin in kleinerer Runde dazu etwas Bemerkenswer-
- tes ein: »Je mehr in allen Medien von intelligenten
- Systemen, von KI und so weiter geredet wird, desto
- kleinteiliger wird meine Arbeit am Rechner. Flie-
- ßende Abläufe werden zerstückelt, dauernd gene-
- riere ich per Klicks Daten und Metadaten, kreuze
- an und fülle aus. Ich frage mich, ob dabei irgendwer
- meine Arbeit so erforscht wie Herr Hollóczki den
- Plastikmüll, den er studiert.«
- Empirisch konnten wir anderen in der Runde
- das Bild bestätigen, und zwar quer durch die Be-
- rufslandschaft: Einen Zeitungsartikel so druckfer-
- tig zu machen, dass er auch online publiziert werden
- kann, verlangt zum Beispiel von der Redakteurin
- heute in manchen Redaktionen dreimal so viele
- Schritte wie vor zehn Jahren. Vergleichbares er-
- zählen Leute aus der Schwimmbad-Eintrittskar-
- ten-Datenverarbeitung, aus der Lagerabteilung im
- Möbelmarkt, aus dem Sekretariat der Arztpraxis…
- Alle stöhnen: Bürokratie!
- Aber anders als in den typischen modernen Bü-
- ros der Verwaltung, von denen dieses Wort »Bü-
- rokratie« abgeleitet ist, entsteht bei der ganzen
- Klickerei eine gigantische Detailaufnahme mensch-
- licher Arbeit, an der die Automaten lernen, was wir
- wann, wo und wie tun.
- Ein großes Medienhaus plaudert das im Früh-
- jahr 2024 in einer Mitteilung an die Belegschaft so-
- gar ganz offen aus. Vorgestellt wird darin ein »Tool«,
- also eine KI-Anwendung, die »inhouse« entwickelt
- worden sei, »mit Fokus auf den Einsatz in Redak-
- tion und Verlag«. Stolz vermeldet man, »dass das
- Tool praktisch den gesamten Arbeitsablauf abbil-
- den kann«.
- Diejenigen, denen solche Tools gehören, werden
- sich aller Erfahrung nach die Gelegenheit (wenn
- beispielsweise die Geschäftszahlen schlecht genug
- sind) kaum entgehen lassen, damit zu drohen, je-
- de Arbeit zu automatisieren, die von den noch vor-
- handenen Menschen nicht in stiller Demut und für
- wenig Geld geleistet wird.
- Ein Beispiel: Eine Call-Center-Beschäftigte
- konnte bis zur Ausrufung des KI-Zeitalters in der
- Stunde sechs Gespräche mit hilfsbedürftigen Kun-
- dinnen und Kunden erledigen – mehr nicht, da sie
- außerdem gehalten war, zwischen den Dialogen
- Protokolle des Besprochenen anzufertigen. Sie mag
- sich jetzt denken: Wenn KI mir die Protokolltippe-
- rei in Zukunft abnimmt, dann werden die sechs
- Gespräche, die ich pro Stunde führe, vermutlich
- nützlicher und befriedigender, auch für mich, weil
- ich mehr Zeit für die einzelne Unterhaltung habe.
- Es ist ja doch frustrierend, Menschen mit Floskeln
- abfertigen zu müssen.
- Aber die Rechnung des Kapitals geht anders: Ab
- jetzt schaffst du sieben oder sogar acht Gespräche
- in der Stunde, und falls du sie nicht schaffst, fliegst
- du raus, was übrigens auch dann passiert, wenn die
- toolgestützte Überwachung deiner Arbeit uns ir-
- gendetwas über deine Leistungen verrät, das uns
- nicht passt.
- 020
- Es gibt eine absolut hilflose Sorte Protest gegen
- das alles: die humanistische Sorte. Sie legt etwa
- dar, dass eine Maschine, die einen Haufen Wörter
- irgendwie verarbeitet, vielleicht nicht die ideale
- Instanz ist, um ein Gespräch durchzuführen und
- zu kontrollieren, das nicht einfach ein zielloses
- Schwätzchen sein soll. Denn oftmals lässt sich dabei
- ein Problem nicht so lösen, wie man in der Schule
- eine Textaufgabe löst, da das in Rede stehende Pro-
- blem erst einmal formuliert werden muss.
- Eine derartige Tätigkeit, sagt der Neo-Humanis-
- mus etwa in Gestalt eines der bedeutendsten Infor-
- matiker unserer Zeit, Judea Pearl, verlangt kausales
- Denken, wozu die nach Gewichtungen und soge-
- nannten Temperaturen aufgeschlüsselte Sprach-
- verarbeitung bei den jetzt so beliebten Chatbots
- und ihren rechenarchitektonischen Verwandten
- nicht in der Lage ist. Denn sie hängt an Wahrschein-
- lichkeitskalkülen, die sich zwar verfahrenslogisch
- nicht grundsätzlich von der Art und Weise unter-
- scheiden, in der auch das Menschenhirn Sprache
- prozessiert, aber eben keine selbständige Verallge-
- meinerung von als Wahrscheinlichkeitsverteilun-
- gen vorliegenden Datenmengen zu Kausalschlüssen
- zustande bringt.
- Nun sind Kausalschlüsse zwar ohnehin nur Nä-
- herungen, sofern nicht sämtliche Informationen
- zu allen Determinanten einer Angelegenheit be-
- kannt sind. Aber wir Menschen denken nun mal
- in solchen Näherungen, und etwas, das nicht in ih-
- nen denken kann, liefert folglich kein funktionales
- Modell unseres Denkens und kann es deshalb auch
- nicht ersetzen.
- Mehr noch: Nicht mal unsere allergewöhnlich-
- ste Sprachpraxis wird von den Maschinenlernme-
- thoden, die jetzt im Schwange sind, sachadäquat
- modelliert. Das jedenfalls haben in mühevoller
- Kleinarbeit wissenschaftliche Aufsätze in Publi-
- kationen wie Trends in Cognitive Sciences, Neu-
- roscience and Biobehavioral Reviews oder Cortex
- nachgewiesen, verfasst von Leuten namens Noam
- Chomsky, Johan J. Bolhuis, Andrea Moro und vielen
- anderen. Angezweifelt wird, ganz abgesehen von
- Kausalschwäche und Sprachmodelluntauglichkeit,
- inzwischen sogar, ob das, was man bei Computern
- jetzt »Lernen« nennt, diesen Namen überhaupt
- verdient. Auch darüber gibt es ausführliche Lite-
- ratur, zum Beispiel Gradient Expectations: Struc-
- ture, Origins, and Synthesis of Predictive Neural
- Networks von Keith L. Downing.
- Das Problem dieser ganzen humanistischen
- Schule der systematischen KI-Kritik als Vergleich
- von Computerleistungen mit menschlichen Ma-
- ßen ist ihre Flughöhe. Die Frage »Sind die neuen
- Systeme überhaupt in der Lage, menschliche Ar-
- beit bedarfsgerecht zu ersetzen (oder auch nur zu
- ergänzen)?« interessiert nämlich Leute, die sich
- »Arbeitgeber«, »Unternehmer« oder »Venture
- Capitalists« schimpfen, also Herrn Bill Gates und
- ähnliche Microschufte, leider gar nicht. Sie ist ih-
- nen schlicht zu hoch.
- Zum Wesen des Monopolkapitalismus gehört,
- dass die Mehrheit der Menschen in seinem Pro-
- duktions- und Reproduktionsbann nicht nur vom
- philosophischen, sondern überhaupt von jedem
- einigermaßen voraussetzungsreichen Denken ab-
- geschnitten dahinvegetiert. Die herrschenden
- Gedanken sind gröber als der platteste Vulgärmar-
- xismus und funktionieren rein polit-ökonomisch,
- auf unterstem Niveau. An sie aber wird die gesam-
- te einigermaßen reichweitenstarke öffentliche De-
- batte über Arbeitsbelange angepasst.
- 021
- IV. Verdeckte Klassenkämpfe offen führen
- ----------------------------------------
- Wer »die KI« sagt, ist schon reingefallen. Denn das
- klingt, inklusive grammatisches Geschlecht, als gin-
- ge es um eine neue Kollegin. Stattdessen hat das Ka-
- pital hier eine sehr clevere Art gefunden, bereits
- vorhandene Kolleginnen und Kollegen so zu ver-
- netzen, dass sie die in jeder Vernetzung liegende
- Chance zum solidarischen kollektiven Handeln gar
- nicht mehr erkennen können.
- Ein ehemaliger Microsoft-Programmierer und
- jetziger Sprachwissenschaftler am Data Science Ins-
- titute der Columbia University in New York namens
- Dennis Yi Tenen hat Anfang 2024 in seinem her-
- vorragenden Buch Literary Theory for Robots. How
- Computers Learned to Write dazu eine Losung aus-
- gegeben, die schnell weitestmögliche Verbreitung
- verdient: »Artificial Intelligence is collective labor.«
- Als kollektive Arbeit müsste KI eine entspre-
- chende Bezahlung der Menschen bedingen, die die-
- se Arbeit geleistet haben und weiter leisten, nicht
- obwohl, sondern weil sich diese Arbeit in teuren
- und sehr energiehungrigen Automaten vergegen-
- ständlicht. Die Archive, an deren Beständen gene-
- rative KI trainiert wird, sind ja in letzter Instanz
- von Menschen angelegt, wenn auch oft schon ma-
- schinell kollationiert, gefiltert, organisiert. »Die KI«
- bringt das, was andere anderswo wissen oder an-
- derswann wussten, zu denen, die es hier und jetzt
- wissen wollen oder sollen, damit sie es weiterver-
- arbeiten können.
- »Die KI« als Leerformel aber ähnelt eher als
- einem Netz dem von Marx entdeckten »Warenfe-
- tisch«, der ein gesellschaftliches Verhältnis (etwas
- wird verkauft und gekauft) für eine Eigenschaft der
- jeweiligen Sache hält (das Verkaufte und Gekaufte
- »ist« eine Ware) und obendrein auch noch die Ver-
- kehrsformen des betreffenden Verhältnisses für
- Attribute besagter Sache ausgibt: Waren »haben«
- Preise, jedes Ding »braucht« »daher« einen Preis.
- Der Fetisch macht das Verhältnis als Ganzes un-
- sichtbar. Erkennbar sind dann nur noch Haufen von
- Einzelheiten: die »ungeheure Warensammlung«
- zum Beispiel, als die nach Marx der menschliche
- Reichtum im Kapitalismus verkürzt wahrgenom-
- men wird. Das betrifft auch die Ware Arbeitskraft,
- deren Realität dann nur noch als unvermitteltes
- Nebeneinander von Dequalifizierung, Tagelöhnerei
- und Minijobs auf der einen Seite und Luxus-Hotel-
- Bereitschaftsdienst in First-Class-Debugging-Jobs
- oder anderen Vorzugstätigkeiten auf der anderen
- Seite aufgefasst werden kann.
- Die »Schere« dieses Nebeneinanders ist gar
- nicht so neu, sondern eine klassische Folge von
- Verschiebungen des Kräfteverhältnisses zwischen
- denen, die schuften, und denen, die kommandieren.
- Organisiert wird dergleichen schon immer gern als
- produktionstechnische Umwälzung. Wer die Ga-
- leerensklaverei einführt, schafft nicht nur niedrig
- qualifizierte und schlecht behandelte Ruderknech-
- te, sondern auch den neuen Posten der Person, die
- den Takt trommelt, zu dem gerudert werden soll.
- Die darf ruhig ein bisschen länger ausschlafen, sie
- muss ja fit sein zum Trommeln.
- Das Wesen hinter der Erscheinung heißt Klas-
- senkampf. Aber selbst die Thinktanks der herr-
- schenden Klasse erkennen manchmal nur noch die
- Erscheinung, nicht das Wesen. Ein instruktives
- Beispiel bietet das sogenannte »Produktivitätspa-
- radox« der vier Dekaden zwischen 1960 und 2000,
- das diese Thinktanks heute breit diskutieren.
- Die erste Welle der Computerisierung verlang-
- samte damals die Zuwächse der Produktivität der
- Ausgebeuteten zunächst, statt sie zu beschleuni-
- gen. Wenn das Kapital derzeit überhaupt noch vor
- irgendetwas Angst hat, dann davor, dass sich ein
- solcher Effekt bei den jüngsten Rechnertechnolo-
- gien wiederholen könnte.
- Figuren wie der »Innovationsforscher« Chan-
- der Velu oder der Fachmann für Industrie-Inge-
- 022
- nieurswesen Fathiro H. R. Putra erklären jenes
- vermeintliche Paradox zu einem naturgesetzlich
- auftretenden Faktor. Er gehöre, so lehren sie, ein-
- fach zu den Kosten der Integration neuer Technik
- in die Arbeitsabläufe.
- So kommt etwas Wichtiges bei ihnen nicht vor:
- der kleine und große Widerstand der Ausgebeute-
- ten gegen die Intensivierung der Ausbeutung. Die In-
- novationsdenker ignorieren den Bummelstreik und
- die Sabotage, an denen nichts auszusetzen ist als der
- geringe Organisations- und Bewusstseinsgrad. Vor-
- sätzlicher Kampf, überall und immer, wäre schöner.
- V. Nachspiel und Perspektive
- ----------------------------
- Computer könnten vielen Menschen langweilige,
- stumpfsinnige oder allzu speicherintensive kognitive
- Arbeit abnehmen, genau wie andere Maschinen un-
- sere Körperkraft dergestalt ergänzen können, dass
- wir uns weniger schinden müssen. Besser noch: Was
- manche Kritik den in künstlichen neuronalen Net-
- zen implementierten Sprachmodellen heute ankrei-
- det, nämlich dass sie unter bestimmten Umständen
- ein Sprachverhalten zeigen, das vom menschlichen
- bedeutend abweicht und dem Umriss nach »unmög-
- liche Sprachen« ahnen lässt, könnte vom Makel zum
- Vorzug dieser Systeme werden, wenn man sie nicht
- mehr als Taktgeber menschlicher Arbeit einsetzen
- würde, sondern als Generatoren des Unbekannten.
- Allerdings war in der historischen Realität schon
- die Dampfmaschine primär ein Werkzeug der Men-
- schenquälerei in der Fabrik und eben kein Gerät, an
- dem man die Befreiung von Plackerei und Not hätte
- üben können.
- Computer erschließen der Ausbeutung jetzt die
- letzten Nischen in den Köpfen.
- Alle Produktionsmittel im Joch der Klassengesell-
- schaft kann man mit Hilfsmitteln der Freiheit in ei-
- nem gerechten Gemeinwesen vergleichen. Aber der
- Vergleich hinkt.
- Das tut er allerdings nicht von Natur. Es ist da
- auch kein Unfall passiert.
- Das Monopolkapital hat dem Vergleich sein Spiel-
- bein gebrochen.
- Dafür wird es bezahlen müssen.
- ---
- Dietmar Dath ist Publizist, Pop- und Filmkritiker bei der
- FAZ und Schriftsteller. Er hat zahlreiche Romane (Die
- Abschaffung der Arten, 2008, Gentzen oder: Betrunken auf-
- räumen, 2021) und Sachbücher (Maschinenwinter, 2008,
- Der Implex, 2012) geschrieben. Zuletzt erschien Miley Cyrus
- (2024).
Add Comment
Please, Sign In to add comment