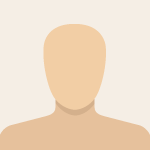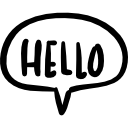Advertisement
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- Die Erfindung betrifft ein strahlengeschütztes Panzerfahrzeug, bei wel chem zwischen der Panzerung und dem Mannschaftsraum eine Neutronen schutzauskleidung vorgesehen ist sowie ein Verfahren zur Herstellung des selben.
- Eine Mannschaft in einem Panzerfahrzeug wird gegen atomare Strahlung einerseits durch das Material der Panzerung und andererseits durch eine Neutronenschutzauskleidung geschützt, welche zwischen der Panzerung und dem Mannschaftsraum angeordnet ist. Das Material der Panzerung schützt wirksam gegen die γ-Strahlung und die hochenergetischen Neutro nen. Letztere müssen jedoch nach der Abbremsung durch die Panzerung in bekannter Weise von Materialien, die einen hohen Anteil an Elementen mit geringem Atomgewicht besitzen, eingefangen werden. Die Neutronenschutz auskleidungen werden dementsprechend im allgemeinen aus einem harten Kunststoff hergestellt, welcher ein Element oder die Verbindung eines Ele mentes enthält, das gegenüber Neutronen einen hohen Wirkungsquerschnitt besitzt. Bevorzugt werden hierbei Bor oder Lithium, welche bei ihrer Reak tion mit Neutronen in der Hauptsache a-Strahlen, jedoch kaum γ-Strahlung aussenden und welche keine radioaktiven Folgeprodukte erzeugen. Diese Elemente werden in Konzentrationen von einigen Prozent dem Kunststoff beigefügt, wobei der Gehalt sich nach der eingesetzten Verbindung richtet. So ist z. B. bei Verwendung von Bornitrid anstelle von Borkarbid ungefähr die doppelte Menge Borverbindung erforderliche, d. h. der Borgehalt von B4C beträgt ca. 78%, der Borgehalt von BN ca. 43%.
- Es ist nun verständlich, daß die Anforderungen an die Materialien hinsicht lich des Strahlenschutzes nicht mit den Anforderungen hinsichtlich eines optimalen Schutzes der Besatzung gegen Beschuß übereinstimmen. Als Minimalforderung für die ballistische Sicherheit gilt, da die Neutronen schutzauskleidung ihrer Funktion so lange gerecht werden muß, solange die Panzerung standhält. Da an der Neutronenschutzauskleidung eine Reihe von Baugruppen auch elektronische Baugruppen befestigt sind, ober da in dieselbe Bedienungsknöpfe, Lampen oder dergleichen integriert sind, wird durch ein Ausbrechen der Neutronenschutzauskleidung nicht nur der Strah lenschutz beeinträchtigt. Es kommt vielmehr auch manchmal zu einem Ausfall von wesentlichen Bedienungselementen. Weiterhin gefährden bei einem Treffer umherfliegende Teile der Neutronenschutzauskleidung oder der an dieser befestigten oder in dieselbe integrierten Elemente die Be setzung. Insbesondere konnte festgestellt werden, daß die Neutronenschutz auskleidung bei tiefen Temperaturen unter einem Beschuß ausbricht, unter welchem die Stahlpanzerung noch standhielt. Als Ursache für das Ausbrechen der Neutronenschutzauskleidung bei einem Treffer wurde einerseits die Schockübertragung und andererseits die Ausbeulung der Stahlwand ermit telt.
- Der Erfindung liegt dementsprechend die Aufgabe zugrunde, ein strahlen geschütztes Panzerfahrzeug der in Rede stehenden Art vorzuschlagen, bei dem weitgehend sichergestellt ist, daß die Neutronenschutzauskleidung bei Treffern, welche die Panzerung des Fahrzeuges nicht durchschlagen, weit gehend erhalten bleibt.
- Die Lösung der Aufgabe ergibt sich aus den im Kennzeichen des Hauptan spruches aufgeführten Merkmalen. In den Unteransprüchen sind bevorzugte Ausführungsformen und ein Verfahren zur Herstellung eines strahlenge schützten Panzerfahrzeuges erläutert.
- Die gemäß der Erfindung zwischen der Panzerung und der Neutronenschutz auskleidung vorgesehene puffernde Schicht, welche ein wesentlich niedrigeres spezifisches Gewicht als die Neutronenschutzauskleidung besitzt, hat eine Reihe von Funktionen. Die bei Auftreffen eines Geschoßes auf die Panzerung auftretende Schockwelle soll teilweise reflektiert werden, sie soll nach Durchlaufen der puffernden Schicht sowohl abgeschwächt als auch abgeflacht werden. Insbesondere durch die Abflachung des Schockimpulses wird die Neutronenschutzauskleidung besser in die Lage versetzt, die Schockbela stung standzuhalten. Weiterhin soll die puffernde Schicht die Ausbeulung der Panzerung teilweise kompensieren. Wenn die Neutronenschutzausklei dung direkt auf die Panzerung aufgebracht wird, dann ist die Ausbeulung der Neutronenschutzauskleidung mindestens ebenso groß wie diejenige der Pan zerung. Durch die gemäß der Erfindung vorgesehene puffernde Schicht wird jedoch die Neutronenschutzauskleidung erheblich weniger ausgebeult als die Panzerung. Durch eine entsprechende Abstimmung der Materialien und der Stärken kann, wie im folgenden gezeigt wird, gewährleistet werden, daß die Neutronenschutzauskleidung so lange standhält als die Panzerung zur ausgebeult, jedoch nicht durchschlagen wird.
- Um diese Funktionen erfüllen zu können, soll die puffernde Schicht ein möglichst geringes spezifisches Gewicht besitzen. Auf der anderen Seite soll jedoch die puffernde Schicht zusätzlich zum Strahlenschutz beitragen, so daß das spezifische Gewicht nicht unter die erforderliche Grenze abge senkt werden sollte. Weiterhin soll selbstverständlich die puffernde Schicht eine derartige Festigkeit haben, daß die Neutronenschutzauskleidung ent sprechend positioniert wird.
- Die Zeichnungen dienen der weiteren Erläuterung der Erfin dung. Es zeigt
- Fig. 1 eine Seitenansicht einer Versuchsanordnung;
- Fig. 2 eine Draufsicht auf die Versuchsanordnung;
- Fig. 3 ein Diagramm, welches das Verhalten verschiedener Materialien zeigt;
- Fig. 4 eine Seitenansicht eines Optimierungsgehäuses mit gepufferter Neutronenschutzauskleidung - Länge ca. 1500 mm, Breite ca. 1500 mm, Höhe ca. 700 mm;
- Fig. 5 eine schaubildliche Ansicht des Optimierungsgehäuses gemäß Fig. 4.
- Die in den Fig. 1 und 2 dargestellte Versuchsanordnung bestand aus Spann schienen 1, einer Verschraubung 2, einer Neutronenschutzauskleidung 3 in Form einer Kunststoffplatte, einer puffernden Schicht 4, einem Rück blech der Schotte 5, Distanzrohren 6 für den Schotthohlraum und einem Vorblech 7 der Schotte.
- Von besonderem Interesse im Rahmen der Erfindung ist die Neutronen schutzauskleidung 3 in Verbindung mit der puffernden Schicht 4. Die für letztere in Frage kommenden Schaumstoffe besitzen je nach Raumgewicht verschiedene Druckfestigkeiten, wobei bei den technisch noch mit repro duzierbaren Eigenschaften herstellbaren Schaumstoffen minimale Druck festigkeiten von einigen kp/cm2 erhalten werden.
- Unter der Annahme, daß der Schaumstoff einer puffernden Schicht so komprimiert wird, daß er mit einer Druckspannung von 0,1 kp/cm2 bela stet ist, die die Rückstellkraft, die auf eine Fläche von 1 m2 wirkt, 1000 kp [F = A · σ D ]. Eine bleibende Verschiebung der puffernden Schicht ist deshalb unwahrscheinlich, da bei einem geschlossenen Gehäuse die ge genüberliegende Seite auf Zug belastet wird und dort eine etwa gleichgroße Rückstellkraft wirkt. Auch die Seitenwände erleiden eine Formänderung, die sich in einer Rückstellkraft auswirkt.
- Im Rahmen von Versuchen sind puffernde Schichten mit Dichten zwischen 30 kg/m3 und 300 kg/m3 um Pufferdicken von 5 bis 30 mm untersucht wor den.
- Als Material für die puffernde Schicht kamen geschäumtes Polystyrol (Styropor) und geschäumtes Polyurethan (Basis Desmodur 15) zum Ein satz.
- Erprobt werden die Puffersysteme mit dem in Fig. 1 und 2 dargestellten Erprobungsträger auf der E-Stelle 91 d. B. in Meppen mit dem Vollge schoß "40 mm × 365, PB (Kaliber 40 mm, panzerbrechend)". Die Beschuß entfernung betrug "100 m". Die Auswertung erstreckte sich auf die visuel le Beurteilung des Schadensbildes und die Messung der Ausbeulung der Pan zerstahlplatte.
- Es zeigte sich, daß in jedem Fall durch eine puffernde Schicht gemäß der Erfindung das Ausbruchsverhalten verbessert wurde. Ebenfalls erkennbar war, daß mit steigender Dicke der puffernden Schicht 4 der Schaden klei ner wurde, wobei jedoch teilweise Abweichungen auftraten. Aus diesem Grunde wurde die "korrigierte Beulhöhe" eingeführt, d. h. von der Höhe der auftretenden Beule im Blech wurde die Dicke der puffernden Schicht 4 abge zogen. In dem Diagramm der Fig. 3 sind freidefinierte Schadensklassen ge gen die korrigierte Beulhöhe aufgetragen. Aus dieser Auswertung ist zu er sehen, daß materialspezifische Abhängigkeiten zwischen Schaden und korri gierter Beulhöhe auftreten. Der auftretende Schaden ist bei bei allen unter suchten Kunststoffen umso kleiner, je kleiner die korrigierte Beulhöhe ist. Weiter kann aus den Versuchen ersehen werden, daß Polyurethanpuffer bes serer Wirkung zeigen aus Puffer aus geschäumten Polystyrol.
- Aufgrund dieser Vorversuche wurden sogenannte "ballistische Optimierungs gehäuse", wie in Fig. 4 und 5 dargestellt, mit einem allseitig angebrachten Polyurethanpuffer von 12 mm Dicke versehen und dann mit Strahlenschutzma terialien 50 mm dick ausgekleidet. Als Strahlenschutzmaterial kamen Epoxid und Polyurethan zum Einsatz, wobei für diesen Zweck Epoxid als schlechte stes Material und Polyurethan als bestes gießbares Material betrachtet wird. Die Erprobung mit Kaliber 40 mm (40 mm × 365, PB, Entfernung 100 m) er gab, daß die puffernde Schicht das Ausbruchsverhalten in erheblichem Maße verbessert. Da bereits in einer früheren Phase direkt, d. h. ohne puffernde Schicht, ausgekleidete Optimierungsgehäuse beschossen wurden, konnte ein direkter Vergleich der "Schadensbilder" erfolgen. Bei der gepufferten Epoxidauskleidung trat im Gegensatz zu der direkt auf Stahl aufgegossenen Auskleidung kein Ausbrechen mehr auf. Das Schadensbild war dem der auf Stahl gegossenen Polyurethanauskleidung gleich, d. h. es trat sternförmige Rißbildung auf. Bei der gepufferten Polyurethanauskleidung traten nach dem Beschuß keine sichtbaren Schäden auf.
- Die Beschußerprobung der Optimierungsgehäuse wurde unter harten Kriterien durchgeführt, da in die Kunststoffauskleidung ein Halterungs element integriert wurde, an welchem eine Stahlplatte von 10 kg Gewicht angeschraubt war. Der Treffpunkt wurde so gewählt, daß die Einleitung des Beschußschockes unter der Halterung erfolgte, so daß die Auskleidung noch zusätzlich belastet wurde.
- Bei der gepufferten Polyurethanauskleidung erfolgte eine noch härtere Er probung. Auf den Dachbereich wurde unter 15° Schuß (40 mm, PB) so plaziert, daß der Einschuß direkt neben einer mit 5 kg belasteten, in die Auskleidung integrierten Halterung zu liegen kam. Das 12 mm dicke Stahl blech wurde im Bereich des Treffens auf 40 mm Breite und ca. 400 mm Länge regelrecht herausgestanzt. Das Geschoß selbst kam in direkte Wech selwirkung mit der Auskleidung, drang zur Hälfte in den Kunststoff ein und wurde von diesem nach außen abgelenkt. Der Kunststoff selbst wies entlang des Geschoßweges einen halbkreisförmigen Kanal auf und war flächig nach unten weggedrückt worden. An der gegenüberliegenden Seite war ein Riß erkennbar, der geringfügig länger als die vom Geschoß beeinflußte Zone war, durch den jedoch noch kein Licht durchdrang. Unter diesen Kriterien gilt eine Panzerung als noch sicher.
- Beide Treffer am Optimierungsgehäuse mit gepuffert gelagerter Polyurethan auskleidung lagen im Grenzbereich der Beschußsicherheit des Gehäuses. Der Beschuß der Frontpanzerung erfolgte unter einem Winkel, der ca. 2,5° un ter dem theoretischen Sicherheitswinkel lag. Im Dachbereich erfolgte ein Durchschlagen des Stahles. Trotz dieser durch die gewichtsbelasteten Hal terungen noch gesteigerten Belastung trat kein Ausbruch in der Auskleidung auf. Auch bei dem beschußungünstigen Epoxid wurde durch die gepufferte Lagerung eine erhebliche Verbesserug des ballistischen Verhaltens erhal ten.
- Die Versuche führten zu unerwarteten Erkenntnissen, die eine Abstimmung der wesentlichen Faktoren erheblich erleichtern:
- a) Art und Stärke der Neutronenschutzauskleidung;
- b) Art und Stärke der puffernden Schicht;
- c) Art und Stärke der Panzerung.
- Sämtliche in Abhängigkeit von der
- d) einkalkulierten Munitionsart eines Treffers, Auftreffwinkel des Ge schosses, Geschoßmasse und Geschoßgeschwindigkeit.
- Nimmt man die Faktoren d und c als vorgegeben an, d. h. wenn also für ein bestimmtes gepanzertes Fahrzeug eine Panzerung gewählt wurde, die Geschoße bis zu einem bestimmten Geschoßtyp unter Berücksichtigung der Treffwahrscheinlichkeit an bestimmten Stellen widersteht, kann empirisch und/oder rechnerisch eine bestimmte "Beulhöhe" angenommen werden. Wür de die Neutronenschutzauskleidung beispielsweise durch Auftragen eines flüs sigen Kunststoffgemisches auf die Stahlplatte unmittelbar an dieser befestigt werden, dann ist je nach Art der Neutronenschutzauskleidung mit einem Aus brechen der Neutronenschutzkleidung zu rechnen, auch wenn die Beulhöhe ge ring ist oder wenn nur eine entsprechende Schockübertragung stattgefunden hat. Gemäß der vorliegenden Erfindung wird jedoch als Minimalforderung für die ballistische Sicherheit gefordert, daß die Neutronenschutzausklei dung so lange nicht versagen darf, solange die Panzerung standhält.
- Als Versagenskriterium für die Neutronenschutzauskleidung kann das Bre chen bzw. das Ausbrechen des Kunststoffes gewertet werden. Bei den schwerpunktmäßig untersuchten Kunststoffen Polyäthylen, Polyurethan, Gummi, Polyamid und Epoxid trat bereits bei Raumtemperatur, bevorzugt jedoch bei tiefen Temperaturen, Versagen ein, obwohl die Stahlpanzerung unter den entsprechenden Beschußbedingungen noch standhielt. In vielen Fällen konnte eine Abhängigkeit zwischen dem Schadensbild im Kunststoff und der Durch- bzw. Ausbeulung der Stahlwand festgestellt werden. Die Klassifizierung der Kunststoffschäden erfolgte nach dem Schadensbild Riß, sternförmiger Riß, kleine Absplitterung, Ausbruch, sehr großer Ausbruch, d. h. Zerstörung, die Messung der Ausbeulung des Stahls er folgte direkt. Gleichzeitig erfolgte eine Beschußerprobung, bei welcher bei den Erprobungsträgern zwischen Stahl und Kunststoff Schaumstoff puffer verschiedener Dicke eingebracht waren. Als Puffer kamen Styropor und Polyurethanschäume unterschiedlicher Dichte zum Einsatz. Ein direk ter Vergleich Schadensklasse-Beulhöhe brachte keine vernünftigen Aussa gen. Erst nach Einführung der korrigierten Beulhöhe, d. h. Beulhöhe im Stahl abzüglich Pufferdicke, ergab sich eine sinnvolle Zuordnung der Schadensklassen. Je kleiner die korrigierte Beulhöhe war, desto gerin ger war der Kunststoffschaden. In den Fällen, in denen die Höhe der Stahl beule kleiner als die Pufferdicke war, trat selbst bei dem sich ballistisch schlechter verhaltenden Epoxid kein Schaden auf. Außer der Möglichkeit allein durch den Schaumstoffpuffer das ballistische Verhalten des Kunst stoffes zu verbessern, besteht auch noch die Möglichkeit, den Kunststoff durch Gewebe bzw. Fasern so zu verstärken, daß seine Ausbruchneigung verringert wird. Außerdem muß dem Kunststoff ein Element bzw. die Verbindung eines Elementes zugemischt werden, welches gegenüber Neu tronen einen hohen Wirkungsquerschnitt besitzt.
- Die Dicke des Kunststoffpuffers, welcher zum Schutz der Strahlenschutz auskleidung sich zwischen dieser und dem Panzerungsmaterial befindet, richtet sich nach der möglichen beschußbedingten Ausbeulung der Panze rung. Die Beulhöhe hängt von verschiedenen Faktoren ab, sie ist u. a. von der Art der Panzerplatte, der Plattendicke, dem Auftreffwinkel des Geschosses, der Geschoßmasse, der Geschoßgeschwindigkeit und der Munitionsart abhängig. Bei dünneren Stahlplatten in die Ausbeulung größer als bei dickeren Stahlplatten. Es muß also von Fall zu Fall ent schieden werden, welche Pufferdicke erforderlich ist. Bei den erfindungs gemäß durchgeführten Versuchen kam ein Schottsystem mit relativ dünn wandigen Stahlblechen zur Anwendung. Die Erprobung erfolgte mit panzer brechender Munition (kein Hartkern) unter einem Winkel, bei dem das System gerade noch sicher war, die Beule jedoch schon so groß war, daß sie in der Mehrzahl aller Fälle Rißbildung zeigte. Die Bemessung der Pufferdicke erfolgte so, daß ein Teil der Beulhöhe bzw. die ganze Beule im Puffer aufgefangen wurde, so daß das Auskleidungsmaterial dem Rest schock standhalten kann. Bei den Versuchen stellte sich heraus, daß die verschiedenen Kunststoffe ein unterschiedliches Verhalten zeigen. Speziell bei den beschußempfindlichen Epoxidharzen tritt in der Regel dann ein Aus brechen des Kunststoffes auf, wenn die Beule den Kunststoff berührt. So bald jedoch die Pufferdicke größer wird als die Beulhöhe, übersteht die Auskleidung die Beschußerprobung. Bei Polyurethan wiederum tritt ein Ausbruch nur dann auf, wenn das Material direkt am Stahl anliegt bzw. fest verbunden ist. Bereits bei einer relativ dünnen Pufferschicht tritt die Rißbildung in den Vordergrund, wobei mehrere Risse sternförmig von der Trefferstelle aus weglaufen; bei größeren Pufferdicken treten einfache Risse in den Versuchsaufbauten auf, welche die Funktion der Auskleidung nicht beeinträchtigen. Die Pufferdicke kann dabei viel dünner sein als die Beulhöhe.
- Der Schaumstoff sollte aus konstruktiven Gründen nicht so weich sein, daß die Auskleidung schwimmend gelagert ist. Eine Verlagerung der gesamten Auskleidung bereits bei Einwirken kleiner Kräfte muß vermieden werden. Das System Panzerung-Puffer-Strahlenschutzauskleidung ist so auszulegen, daß in allen Bereichen eine ausreichende Pufferdicke herrscht. Dabei kann die unterschiedliche Beschußsicherheit des Gesamtaufbaues berücksichtigt werden, so daß sich unterschiedliche Pufferstärken ergeben. In jedem Fall sollte jedoch in die Bereiche ein Puffer eingebaut werden, welche erfahrungs gemäß oft getroffen werden. Der Puffer ist aus konstruktiven Gründen als Schaumstoffpuffer auszulegen. Ein Luftspalt kann einen Teil der Funktionen erfüllen - aus gießtechnischen Gründen - d. h. bei Einsatz gießbarer Harze - und bei Verwendung z. B. des Panzerturmes als Formteil ist es günstig, die zur Pufferung erforderlichen Hohlräume mittels eines Schaumstoffes zu bilden. Zusätzlich trägt der Schaumstoff auch zur Strahlungsabschirmung bei. Die Oberfläche des Schaumstoffes kann mit einer geschlossenen Schicht versehen werden, die vermeidet, daß der flüssige Kunststoff in den Puffer eindringt.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement