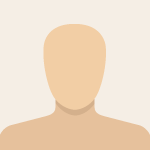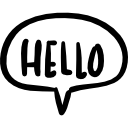Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- Mein Leben zwischen Highlife und Pleiten
- Ich der Neger URS ALTHAUS
- Bearbeitet von Helmut-Maria Glogger
- Einige Namen im Buch wurden geändert.
- Für meine Mutter Irma Althaus in Altdorf
- und alle Mütter dieser Welt
- Es gibt nichts Schöneres im Leben,
- als die Einheit zu spüren.
- Inhalt
- Ich war noch nie in New York 11
- Ein heißer Sommer IS
- Schwarz, Schweizer, unehelich 22
- Kindergarten, Krippenspiel 27
- Mädchen, Tanzen, Fühlen 30
- Fußball, Lernen, Modeschau 35
- München, Bangkok, Hongkong, Tokio, Paris 41
- Ford, Elite, Saint Laurent 45
- Schwarz, 21, ein Star .54
- Pavarotti, Beckenbauer, Nurejew 62
- Liebe, Jack, die Pille 67
- Aus Ecstasy wird Xtazy 70
- Xtazy-Höhenflug nach Paris 75
- Offener Brief an meine Mutter 79
- Pleite und Handicap Hautfarbe SS
- Polizei in Zürich, Jetset in Klosters 9S
- Rom, Sex auf offener Bühne 104
- 840 000 Franken Verlust, Valentino sauer III
- Actors Studio und kleine Rollen 119
- Südafrika, Iman, Only Black 125
- Keine Schwarzen bei Dior, Schauspielunterricht,
- schwuler Indianer 133
- Genialer Schuss ins Lattenkreuz 139
- Eigil, Liebe, Sadomaso 142
- Der Actionfilm und der Vietnam-Veteran 149
- Leiden, saufen, Afrolook 1.57
- Sean Connery, Murray Abraham, Jean-Jacques Annaud
- Gary, eigene Modelinie 171
- Sex, Drogen, Wahnsinn 182
- Freiheit, Zürich, fester Job 189
- Wein, Erfolg und Neid 193
- Schweizer Modelkrieg, Option, Miss Wonderbra 201
- Indien, Tibet, der Dalai Lama 206
- Models, Sex, Skandal 211
- Aga Khan, Streit, Schlussstrich 214
- Liebe und Verrat, Shakespeare auf dem Hafenkran 216
- Neger bleibt Neger, schwarz bleibt schwarz 223
- Ein Schweizer Leben 227
- Anhang: Filme mit Urs Althaus 231
- Ich war noch nie in New York
- oder
- Wo ist mein Gesicht auf dem Times Square?
- New York kann traurig sein. Besonders im November. 1977 ist Erdnussfarmer Jimmy Carter Präsident der Vereinigten Staaten. Carters Bruder Billy ist Säufer und dem »Playboy« sieben Seiten wert. Eine Schwedin wird »Miss World«. Ägyptens Staatspräsident Anwar as-Sadat bestätigt das Existenzrecht Israels. »Der Butt« von Günter Grass ist auf Platz eins der Bestsellerliste. Für mich wichtiger: Die Modelagentur Elite aus Paris öffnet in New York ihre Pforten. Mein Agent Zoltan »Zoli« Rendessy gibt dazu eine seiner berühmten Star-Partys. Elite-Gründer John Casablancas ist da, ebenso Apollonia van Ravenstein und Cheryl Tiegs, die berühmten Titelgirls der Badeanzugausgabe von »Sports Illustrated«. Die Szene-Coiffeure Ära Gallant und John Sahag, Fotografen wie Bruce Weber, John Peden, Richard Avedon und Patrick Demarchelier im Schlepptau. Ein idealer Rahmen, um das neue Modewunderkind New Yorks zu feiern: Die 22-jährige Prinzessin Diane de Beauvau-Craon stellt mit Elite-Models ihre erste Kollektion vor. Locker drapierte Sei- denstoffe, lang gezogene V-Ausschnitte, drei Schichten Chiffon über nackten Busen. Mode eines Society-Darlings, das sich Mäd- chen, Agenten, Fotografen, Prominenz kaufen kann. Sie ist die Enkelin des bolivianischen Zinnkönigs Patino. Ich suche an diesem Donnerstagmorgen keine Agentur, kein
- 1 1
- Model, keinen Coiffeur, keinen Fotografen, keinen Bruder, keine Frau, kein Modekind, keinen Zinnkönig. Ich suche mich. Genauer: Ich suche mein Gesicht. Mein schwarzes Gesicht. An diesem neblig-weißen Morgen in New York. Ich weiß, wo ich mich finden könnte: an einem Zeitungsstand. Dort wird das »GQ«-Magazin (»Gentlemen's Quarterly«) verkauft, die einflussreichste Modebibel für den Mann von heute und mor- gen. Zwischen Dampfsäulen aus der New Yorker U-Bahn entdecke ich bei den Zeitschriftenverkäufern die neue »Vogue«. Mit Made- moiselle Beauvau. Die neue Ausgabe von »Rolling Stone«, mit dem Rockstar Pete Townshend von The W h o als Karikatur auf dem Cover. Nirgends ein »GQ«. Mir wird bange. Wurde der Titel in letzter Minute vom Chef- redakteur gekillt? Griff der allmächtige Verleger ein? Zogen die Anzeigenkunden Doppelseiten zurück? Weigerte sich der Vertrieb, diese Ausgabe von » G Q « auszuliefern? Auf Druck rassistischer Südstaatler - weil ich als erstes schwarzes Model es geschafft habe, auf das Titelblatt eines US-Männermagazins zu kommen? Die Situation hat sich, während ich dies schreibe, nicht wirklich geändert. Trotz Barack Obama, dem ersten schwarzen Präsidenten. Gerade entfacht wieder ein Schwarzer auf dem Titelblatt eine Diskussion. Die US-»Vogue« wagt es 2009, erstmals in ihrer Ge- schichte, einen schwarzen Mann auf ihr Cover zu setzen. Einen Baseball-Star, immerhin abgefedert mit dem halbweißen Model Gisele Bündchen, das in ein züchtiges Seidenkleid gehüllt wurde. So ist ein Schwarzer auf dem Titelblatt 1977 erst recht eine Pro- vokation. Seit » G Q « als Fashion-Magazin 1957 vom Lifestyle-Ver- lagshaus Conde Nast gegründet wurde, ist noch nie ein Model mit anderer Hautfarbe als Weiß auf dem Cover gewesen. Ich laufe um die Ecke 53. Straße, Second Avenue. Von Zeitungs- stand zu Zeitungsstand. Nichts. Mein Gesicht ist an diesem Mor- gen unauffindbar. Die anderen Modehefte liegen alle da. An jedem
- 1 2
- Kiosk, an dem ich vorbeihaste. Und die stören mich jetzt, diese »Vogue«, »Vanity Fair«, »Glamour Magazine«, »New York Maga- zine«. Denn keine Spur von mir als Titel-Boy in den Gestellen der Open - Air-Kioske. »Sorry, man! It's not your day«, sagt mir ein Inder, der gerade Stapel von Zeitschriften ordnet. Genau! Die anderen Hefte erschei- nen jeweils am Dienstag. » G Q « jedoch wird donnerstags ausgelie- fert. Aber um diese Tageszeit ist das Magazin noch nicht da. Kein Wunder, bei dem Verkehr. Als ich mich endlich finde, sehe ich seltsam faltig aus: Ich gucke als Mann mit H u t durch die dünnen Verpackungsriemen, die die Ausgaben zusammenhalten, in den New Yorker Morgen: als Deck- blatt der Lieferung druckfrischer »GQs«. So habe ich mich gefunden an diesem Donnerstagmorgen, dem 17. November 1977. Mich kaufen aber will ich nicht an dieser zugi- gen Ecke New Yorks. Dazu wähle ich die feinste Adresse: den exquisiten internationalen Zeitungsstand neben dem Luxushotel The Plaza an der Fifth Avenue, Central Park South. Wie viel ein » G Q « kostet? Zwei Dollar! Egal: Das ist mir an die- sem Tag mein Gesicht allemal wert. Ich will mich bewundern! Wer wollte das nicht? Ich. Ich. Ich. Das erste schwarze Model auf dem Cover von »GQ«, das weltweit erscheint. Abgelichtet und in Szene gesetzt von dem berühmten New Yorker Fotografen John Peden, der die reichsten und berühmtesten Amerikaner auf Zelluloid bannt. Was für ein Moment. Endlich habe ich die 260 Seiten Edelpa- pier in der Hand. Perfekt gedruckt. Tiefdruck. Mit klammen Fin- gern halte ich das Magazin. Ich kann es kaum fassen. Das bin ich. Da vorne drauf. Mit Hut. Links neben mir die vier dicken Titelzei- len »How to Get Your Wardrobe Together«. Ein dickes Paket Mode, das ich wieder und wieder durchblät- tere. Zumal ich nach den Anzeigen der großen US-Labels mein
- 1 3
- Gesicht im Heftinneren erneut entdecke, als Anreißer für die Bild- strecke in der Mitte des Heftes, in der ich aktuelle Herbstmode prä- sentiere - auf vierzig Seiten. Auf fast jeder Doppelseite! Sagenhaft. Natürlich bin ich stolz. Natürlich wachsen mir Flügel. Natürlich bin ich an diesem Morgen der wichtigste Mann New Yorks. Begehrt von den Topshots der Branche. Gebucht bis zum Um- fallen. Diesen Erfolg als Mannmodel habe ich mir nicht mit Modeza- ren oder -redakteuren erschlafen: Ich hatte beste Referenzen von besten europäischen Modehäusern. Glück kam dazu. Ausgerech- net am Tag des berühmten »Black-outs« in New York, dem tota- len Stromausfall, erfuhr ich von meinem Agenten bei Kerzenlicht: »Urs, >GQ< - >Gentlemen's Quarterly< will dich. Das wird es! Dein Durchbruch! Das Größte!« Ehrlicherweise muss ich anfügen: Sie wollten nicht nur mich. Auch das berühmte weiße Model Roland Wadenpul war dabei. Trotzdem war ich damals sprachlos, bin es heute noch. Auch mein Agent Zoltan »Zoli« Rendessy staunte, diese legendäre Figur der internationalen Modeszene. Sollte ich es wirklich geschafft haben, ausgerechnet in New York den Ritterschlag der Modewelt zu erhalten? Ich konnte nicht auf- hören zu träumen, damals im »Plaza«. Ich war 21 Jahre jung, ich war attraktiv und fotogen. Ich dachte nicht an das Morgen, nur an das Heute. Ich wusste: Urs, nach diesem Job liegt dir die Modewelt zu Füßen. Agenturen reißen sich um dich, Fotografen sowieso. Katalogarbeiten in der Karibik, Werbekampagnen auf Hawaii oder den Pazifik-Atollen, wenn es in der Schweiz lausig kalt ist. Mode- häuser können ohne dich keinen Erfolg haben! Ich war der glück- lichste Mensch von New York City, glaubte zu wissen, das weiße Amerika habe mich in seinen erlauchten Kreis aufgenommen. Mir fielen zwei Begebenheiten ein, mit denen mich dieses weiße Ame- rika nur kurz zuvor irritiert hatte. Bei meiner Bookerin hatte ich
- 1 4
- eine Casting-Anzeige hängen sehen. Gesucht wurden Träger des »All American Look«. Ich fragte nach, ob ich an jenes Casting fah- ren könne. Meine Bookerin stutzte. Dann sah sie mir lange in die Augen und erklärte: »Urs, du bist wirklich süß, aber dieses Casting ist nichts für dich. >A11 American Look< ist nur was für Weiße.« Sollte das etwa ein Witz sein? Ich war mehr als erstaunt. Ame- rika, das klassische Einwandererland! Der Schmelztiegel der Natio- nen, die neue Welt! Und hier waren nur Weiße »all American«? Wie genau die einzelnen Zutaten in diesem Schmelztiegel unter- schieden wurden, erfuhr ich kurz darauf. Ich wurde zu Helen Weepman geschickt - der Staranwältin der ausländischen Models, die es immer wieder schaffte, uns, aus aller Herren Ländern ange- reist, ein Visum zu beschaffen. Zuerst wollte Helen mich von unserem Rendezvous fortjagen, da sie, wie sie mit spitzer Stimme erklärte, »einen Schweizer erwar- tete«. Nachdem sie sich bei meiner Agentur vergewissert hatte, dass ich tatsächlich der gesuchte Schweizer war, durfte ich jedoch das Antragsformular ausfüllen. Als ich es ihr zurückgab, fand sie darin sogleich einen Fehler. »Da!« Sie kniff die Augen zusammen, rück- te ihre Brille zurecht und bohrte den knallrot lackierten Nagel ihres Zeigefingers in das Blatt Papier, knapp unterhalb des Stichwortes »Nationalität«. Dort stand »Swiss«. Auch »Konfession« hatte ich korrekt ausgefüllt: »Protestant«. Dann, eine Zeile tiefer, der Fingernagel der Anwältin. Es war die Zeile, in der man sich eine Hautfarbe aussuchen durfte. Weiß, Schwarz, Braun, Rot, Gelb. Ich hatte sie leer gelassen. Denn wenn es nach mir ging, so war ich schlicht und ergreifend Schweizer. »Es gibt keine schwarzen, asiatischen oder weißen Schweizer in der Schweiz. Auch keine Hispano-Schweizer«, erklärte ich empört. Helen Weepman nahm mir ungeduldig den Bogen aus der Hand. »Mein Stundenansatz ist ziemlich hoch. Und wenn du hier in Amerika arbeiten willst, dann lernst du besser schnell, dass du ein schwarzer Schweizer bist, nicht einfach nur ein Schweizer. Also mach jetzt hier ein Kreuz, sonst bekommst du kein Visum.«
- 1 5
- So lernte ich nach und nach, dass ich in Amerika nicht der Urs aus der Schweiz, sondern der schwarze Urs aus der Schweiz war. Ein paar Tage nach meinem Visumsantrag hatte ich ein Shooting mit einem berühmten europäischen Fotografen, Alberto Rizzo, für das »Brides Magazine«. Zu jener Zeit versuchten alle Fotografen, die in Europa zu Ruhm und Ehre gelangt waren, in Amerika zu Geld zu kommen. Es waren vier Models für das Shooting gebucht worden, zwei schwarze, zwei weiße. Ich dachte mir überhaupt nichts dabei und stellte mich, auf dem Set angekommen, einfach auf einer Seite der kleinen G r u p p e dazu. »Urs, wir sind hier in New York, also müssen wir das getrennt fotografieren. Bitte stell dich nach rechts, zu deinem Mädchen.« Der Fotograf sagte es freundlich lächelnd - und ich tat, als sei nichts weiter passiert. Nach dem Shooting meinte meine - natürlich schwarze - Braut: »Weißt du, wenn du länger hier in Amerika arbei- test, dann lernst du, mit diesen Dingen umzugehen.« So war das damals. Alle Models sprachen von »diesen Dingen«. Nie sprach jemand von Rassismus. Es war Harry Coulianos, der Art-Director von »GQ«, der mei- nen Erfolg überhaupt möglich machte. Er hatte bei dem konser- vativen Modeblatt die Zügel in die H a n d genommen. Harry ent- deckte nicht nur mich, sondern auch Bruce Weber, den späteren Starfotografen, der mit seinen Muskelboys berühmt wurde. Er schickte mich damals für » G Q « zu John Peden, einem stillen, aufgehenden Star am Fotografenhimmel, zunächst nur für die Innen- seiten. Schon die Polaroids, die vor allen Sequenzen gemacht wer- den, fielen in Harrys und Johns Augen überdurchschnittlich gut aus. Und das, obwohl Harry Coulianos mich bei unserem ersten Mee- ting fassungslos angestarrt hatte und nicht glauben konnte, dass es in der Schweiz überhaupt einen »Black Boy« gab. Er, der Sohn grie- chischer Einwanderer, begriff, was mir dieses Shooting bedeutete. Er nahm mich im End-Layout auf fast jede Doppelseite. Tage nach den Aufnahmen bei Peden saß ich bei Harry in der »GQ«-Redaktion im Hochhaus des Verlagsgiganten Conde Nast.
- 1 6
- Harry, der später an Aids starb, wollte mir die Bilder als Dias zei- gen. Als einer der Großen der Branche ahnte er besser als ich, was da auf mich zukommen würde - waren die Bilder erst einmal ver- öffentlicht. Er fragte mich nach meiner Jugend, meiner Famüie, meiner Mutter, meinem Leben, quetschte alles raus. Dann ging er mit mir zum Leuchtpult in seinem großen, mit Katalogen, Bildern, Mo- delpostern fast zugeschütteten Büro, wo die Fotos von mir wie gerahmte Zinnsoldaten auf der beleuchteten Scheibe lagen. »Urs! Diese Bilder machen dich zum Star!« Dann schluckte er, sah aus dem Hochhausfenster auf den Wahn- sinn namens New York. »Dich machen sie zum Star ...«, wieder- holte er und fügte dann an: »... und ich, ich verliere wohl meinen Job.« »Wieso das denn!«, rief ich entsetzt, »ist das Shooting denn so schlecht?« »Die Bilder sind fantastisch.« »Aber? Sie sind noch nicht abgesegnet?«, fragte ich. Harry lachte. »Urs! Ich segne sie ab. Aber sie könnten ein Erd- beben auslösen.« »Ist die Mode so revolutionär?« »Die nicht. Ich hoffe nur, dass die Zeit reif ist für einen Schwar- zen auf dem Titel von >GQ<.« Zwei Wochen hörte ich nichts. Dann rief Harry meinen Agenten Zoltan an und sagte: »Urs muss noch mal fotografiert werden!« »Warum? Was ging beim ersten Shooting daneben?« »Nichts. Gar nichts. Urs muss für das Cover von >GQ< fotogra- fiert werden!« Zoltan schluckte. Dachte wohl heimlich, dass ich mich bei dem Shooting danebenbenommen hatte. Zoli suchte seine Models nicht nur nach deren Aussehen aus, er achtete auch auf ihr gutes Beneh- men, das auch ich Jahrzehnte später als Mitinhaber einer der be- kanntesten Schweizer Modelagenturen von meinen weiblichen und
- 1 7
- männlichen Models kompromisslos einforderte. Europäische Schu- le eben. Doch darum ging es Harry nicht, das wusste ich. Und ich wuss- te, wie perfekt die Innenseiten waren. Diese hatte ich ja schon bei ihm im Büro gesehen. Sie wollten tatsächlich mein Gesicht auf ihre Titelseite drucken, das erste schwarze Modelgesicht auf der Titelseite seit Gründung des Magazins! »Ist langsam Zeit für Amerika, dass deine Hautfarbe das Cover dieser Zeitschrift ziert«, strahlte Harry Coulianos. Und nachdem wir uns in seinem Büro wieder über die Dias gebeugt hatten, fügte er an: »Urs! Mit dieser Ausgabe von >GQ< schreiben wir Modege- schichte.«
- Ein heißer Sommer oder Als Stammgast im »Studio 54«
- Damals nahm ich noch keine Drogen. In den ersten Tagen, als ich als Farbiger mich auf einer weißen Zeitschrift gesehen hatte, glaubte ich: Urs, du hast es geschafft! Ich war sicher, damals vor dem »Plaza«, dass die Nachricht in wenigen Stunden wie ein Lauffeuer durch die Modeszene der west- lichen Welt fegen würde: ein Neger auf dem Titel! Jeder im Big Apple, der etwas mit Mode zu tun hatte, konnte doch sehen, dass er nur einen buchen musste: the Black Boy from Switzerland. Besonders die Freunde aus dem »Studio 54«, aus der weit ver- zweigten Mode-Family von Pop-Art-Guru Andy Warhol, der in der
- 1 8
- Subkultur seiner New Yorker »Factory« mit ihren 57 Mitgliedern Kunst, Filme und Siebdrucke am Fließband fabrizierte, sich mit Rockstars wie Mick Jagger oder David Bowie und einer großen Entourage vergnügte; Warhol war der wohl einflussreichste Nicht- Art-Director aller Zeiten - für Mode. Nie zuvor hatte es etwas dem »Studio 54« Vergleichbares gege- ben: ein Inferno - oder Nirwana - aus Drogen, Geld, Macht, Poli- tik und purer Lust. Ein Club, in dem jeder ein Star war, ob reich, arm, jung, alt, hetero oder schwul oder beides in einer Nacht - falls er am Türsteher vorbeikam. Selbst Lillian Carter, die Mutter des amtierenden Präsidenten Jimmy Carter, schwärmte: »Ich weiß nicht, ob ich im Himmel war oder in der Hölle.« Eigentlich ist das ganze »Studio 54« heute für mich und alle, die überlebt haben, zu einer einzigen Erinnerung verschmolzen. Oder wie der »Spiegel« schwelgte: ein Spuk aus fernen Zeiten, vor Terror, vor Krieg, vor Aids, als ein Nachtclub an Manhattans 54th Street die Disco zu einem Lebensgefühl machte. Nicht Hollywood, das »Studio 54« in New York erfand den Kult um Prominente neu. Da gab es den Coiffeur John Gerard, der mit seinem Klammeraffen Max garantiert Einlass bekam. Obwohl Max dem Erben einer Champagnerdynastie fast die Nase abgebissen hatte. Da tanzte Doris Duke, weit über siebzig Jahre alt, mit fast nackten Jamaikanern. Kein Problem für die zweitreichste Frau Amerikas. Kultautor Truman Capote gab sich die Kante bis zum Umfallen. Selbst die einstige First Lady Jackie Kennedy-Onassis verbrachte hier mehr als nur eine Nacht bis Tagesanbruch. Interessanterweise erfanden zwei Freunde diesen Club, die keine Ahnung vom VIP-Business hatten: Steve Rubell und lan Schräger kannten sich vom College. Rubell war der Party-Man, Schräger der Business-Boy. Sie mieteten auf der verdreckten New Yorker West Side ein altes Theater und TV-Studio, aus dem CBS lange die legen- däre »Tonight Show« mit Johnny Carson gesendet hatte. Der Club war riesig. 500 Menschen konnten auf der Tanzfläche toben. Es gab das beste Soundsystem, und ein »Mann im Mond«
- 1 9
- im Neonlicht schniefte rhythmisch einen Löffel Kokain in die Nase. Einen Stock höher lag die berühmte Galerie. Der Raum für die Insider war im Keller. Da gab es auch den berüchtigten »Rubber Room«, dessen Gummiwände man abwaschen konnte. Nichts, was bizarrste Fantasien nicht übertroffen hätte. Schon die Eröffnung am 26. April 1977 war eine Sensation. 5000 Einladungen waren verschickt worden. Um Mitternacht herrschte in Midtown Chaos. Alle kamen sie zur »Studio«-Premiere: Cher, Frank Sinatra, Mick und Bianca Jagger, Margaux Hemingway, Truman Capote, Andy Warhol, die Modezaren Klein und Halston mit ihren weiblichen Modellen und ihren männlichen Spielgefähr- ten. »Als habe der Blitz eingeschlagen«, staunte Schräger. Viele mussten draußen bleiben. Uber Nacht erwarb sich das »Studio« den Ruf eines Sünden- babels. Aids war noch unbekannt, und der Konsum von Drogen gehörte in New York quasi zum guten Ton. Das »54« galt als Spiel- wiese für alle, die schon immer von Partys geträumt hatten, auf denen sie ihren Fantasien freien Lauf lassen und hemmungslos bis in die frühen Morgenstunden feiern konnten. Unter den Stamm- gästen: Diana Ross, Liza Minnelli, Elizabeth Taylor, Andy Warhol, die Jaggers, Michael Jackson, Elton John, die noch unbekannte Madonna, Salvador Dali, Supermodel Christie Brinkley und Grace Jones. Grace Jones, die ich später immer mal wieder sehen sollte und mit deren Freund Dolph Lundgren ich später eine Show für Emanuel Ungaro bestritt, war die erste Frau, auf die das Wort »cool« zutraf. 1977 nahm sie ihr erstes Album auf. Als Disco-Lady mit Lederpeitsche war Grace Jones im »Studio 54« Kult. Sie ließ ihren Hit »I Need a Man« vom Publikum mitsingen und abnicken. Das Vorspiel kannten alle! Grace als geölter Luxusbody. Als schul- tergepolstertes Science-Fiction-Geschöpf mit geometrisch fixier- tem Kopf. Disco-Hymnen aus dem »Studio« eroberten die Welt. »I Love the Nightlife«, »YMCA«, »Last Dance«. Die Popgruppe Chic schrieb
- 2 0
- ihren Megahit »Le Freak« aus Protest, nachdem sie vom »Studio«- Tiirsteher abgewiesen worden war. Später wurde »Le Freak« ein Hit im »Studio«. Jetzt kamen auch die Chic rein. Jede Nacht hatte ein Motto. »Dress spectacular«, stand auf den Eintrittskarten. Für »Saturday Night Fever« wurden weiße Tauben freigelassen, die prompt in den Scheinwerfern verendeten. Hinter- her kehrte man sie mit einem Besen auf. Die Kunst bestand darin, am Türsteher Marc Benecke vorbeizu- kommen. Der ließ nur rein, wer originell war. Zum Beispiel »Disco Sally«, eine reiche, tanzwütige Greisin aus einer Öldynastie. Oder den Millionär, der mit seiner lebensgroßen Marionette schmuste. Oder den konservativen Politiker, der als »Sanitäter« seinen männ- lichen Lieblingspatienten auf der Bahre reinschob. Ich kann mich nicht beklagen; ich kam immer rein, sogar mit mei- ner Mutter. Es gelang mir auch, Freunde und Bekannte ins »Studio« zu schleusen, die ohne mich nicht hineingekommen wären. Irgendwann zeichnete sich ein Ende der Herrlichkeit ab. Steuer- fahnder fanden doppelte bis dreifache Buchführung. Dazu gesellte sich eine Anklage wegen Drogengeschäften: Kokain, Marihuana, Quaalude. Hinter den abwaschbaren Wänden fanden sich die echten »Studio«-Bücher, Mülltüten mit einer Million Dollar Bar- geld und Kokain für mindestens eine Woche »Studio«. Rubell und Schräger wurden wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 2,5 Mil- lionen Dollar angeklagt und 1980 zu je dreieinhalb Jahren Haft ver- urteilt. Verbüßen mussten sie davon aber nur dreizehn Monate. Das »Studio« schloss am 4. Februar 1980 mit einer Party namens »Das Ende des modernen Gomorrha«. Sylvester Stallone bestellte den letzten Drink. Und auf mich, den Urs aus Altdorf, kam Steve Rubell, zu, um mir in dieser Closing Night zu danken. »Thank you for your support.« Ich hatte die schrillsten Vögel der Modeszene zu ihm geschleppt. Kurz bevor Steve Rubell 1989 an Aids starb, sah ich ihn wieder. Auf der 8th Avenue. Abgemagert. Wir unterhielten uns lange und schieden als Freunde. Schräger wurde Multimillionär mit Immobi-
- 2 1
- lien. John Gerard schnitt wieder Haare. Max, der Klammeraffe, war tot. Für mich war das »Studio 54« Hölle und Himmelreich. Als ich, der Schwarze, für einen Katalog auf dem amerikanischen Mode- markt zum ersten Mal gebucht wurde, hatte mich mein Agent Zoltan Rendessy zur Feier des Tages auf die Gästeliste des Clubs setzen lassen. Ich sehe mich noch heute: Da stand ich an der Brüstung des Bal- kons, zum ersten Mal im »Studio 54«. Sah fasziniert und fassungs- los auf eine Welt, die mir im Grunde völlig fremd war. Auf zu- ckende Glieder, nackte Brüste, auf Menschen, auf ein Treiben, ein Leben, unfassbar weit entfernt von meiner Kindheit in der Inner- schweiz. Und ich sah die Schwarzen, die Farbigen, Jamaikaner, Afrikaner, Mischlinge. An diesem Abend im »Studio 54« dachte ich an meinen Vater aus Nigeria. An die Hälfte meines Ichs, die ich bisher verdrängt hat- te, nicht wirklich kennen wollte.
- Schwarz, Schweizer, unehelich oder Wie ich in Uri trotzdem eine behütete Kindheit erlebte
- Ich wurde am 25. Februar 1956 in Herrliberg am Zürichsee gebo- ren. Im Sternzeichen des Fischs. An einem Tag, den Astrologen so umschreiben: Es ist die Atempause vor dem März, mit Stunden der Träume und Sehnsüchte, die inneren Hoffnungen Gestalt verleihen. Für meine Mutter jedenfalls war ich die Gestalt ihrer Träume, Sehnsüchte und Hoffnungen.
- 2 2
- Ich wuchs ohne Vater als halbschwarzes, uneheliches Kind in Altdorf, im Herzen der Urschweiz, auf. Meine Mama Irma Althaus ist eine wunderbare Frau. Eine Dame, eine Familien-Patronne, eine Arbeiterin; mehr englische Lady als Schweizerin. Mein Papa? Den lernte ich nie kennen. Obwohl ich seinen Na- men kenne, ihn jahrelang suchte. In den Weiten Afrikas. Ich weiß nur, dass er aus Nigeria stammt, dem großen, ölreichen Land West- afrikas. Wie Mama Papa kennen und lieben lernte? Jede Familie hat ihre Geheimnisse. Meine Mama nur dieses. Und doch weiß ich, wo die beiden sich erstmals trafen. Das war in Schottland, genauer in Glasgow. Dort arbeitete Mama als Gouver- nante bei einer reichen Familie. Schweizerinnen waren damals besonders beliebt bei wohlhabenden Damen der Gesellschaft. In Glasgow trat Mama auf den nigerianischen Medizinstuden- ten Emanuel Igwe. Einen wunderschön gewachsenen, großen, in- teressanten und gebildeten Schwarzen. Beide sprachen perfekt Englisch. Nigeria war damals noch nicht in die Unabhängigkeit ent- lassen worden, stand unter britischem Protektorat. Was Mama vom meinem attraktiven Vater Emanuel blieb, ist seine letzte bekannte Adresse: Glasgow N. W. Napiershall Street 5. Und das Kind. Ich. Als meine Mutter England verließ, wusste sie nicht, dass sie schwanger war! Dass sie mich bereits in ihrem Bauch ernährte. Jahr- zehnte später erzählte sie mir, wie fröhlich sie die Botschaft aufnahm, als sie, zurück in der Schweiz, erfuhr: Irma. Du bist schwanger! »Ich hoffte, mein Kind würde schwarz und ein Junge sein«, sagte sie später. Die Freude machte ich ihr. Allerdings: Unmittelbar nach meiner Geburt war sie enttäuscht - meine Hautfarbe war zunächst, wie bei schwarzen Babys üblich, hell. Doch sie dunkelte, zu ihrer Zufriedenheit, ziemlich schnell nach. Mama ist eine unerhörte Kämpferin! Niemand sah ihr die Schwan- gerschaft an. Sie suchte sofort Arbeit in Zürich und jobbte als Kell-
- 2 3
- nerin bis zum Tage meiner Geburt. Sie war entschlossen, ihrer Fa- milie erst von mir zu erzählen, wenn ich auf der Welt war. Als schließlich bei der Arbeit ihre Wehen einsetzten, fuhr sie in ein nahe gelegenes Heim für ledige Mütter. Dort wurde sie mit den Worten begrüßt: »Was wollen Sie denn hier?« Mama war einfach zu schlank. Keiner sah ihr an, dass sie im neunten Monat war. Sie erzählte ihre Geschichte, schilderte ihre Schmerzen und wurde gleich in den Gebärsaal gebracht. Nun sind uneheliche Kinder in meiner Verwandtschaft keine Sel- tenheit. Ich war das dritte uneheliche Kind - wenn auch das erste »Negerlein«. Was meine Großmutter nicht störte. Sie hielt sich an das Motto: »Lieber ein Kind auf dem Kissen als auf dem Gewis- sen.« Leider verstarb sie, als ich zwei Jahre alt war. Es waren harte Zeiten damals. Man konnte sich ernsthaft nicht vorstellen, was um Himmels willen eine Frau ohne Ehemann mit ihrem Leben anfangen sollte. Und doch blieb Mama - trotz vieler Chancen und Angebote - ein Leben lang ledig. Wir lebten zu viert in dem Haus, in dem Mama 1928 geboren wurde: Großvater, Mutter, Cousin Ruedi und ich. Mama arbeitete, Großvater kochte. Ein liebevoller, fürsorglicher Großvater, der mich nie anbrüllte oder schlug. Er entstammte einer Emmentaler Hufschmiede-Familie und wollte, nachdem er um sein Erbe geprellt worden war, mit meiner Großmutter zusammen am Bodensee ein Hotel aufbauen; der Erste Weltkrieg führte jedoch zum Bankrott. Großvaters Devise war: Gegessen wird, was Mutter Natur anbie- tet. Bio total, aus seinem riesigen Garten, in dem Früchte, Beeren, Gemüse wuchsen, der sogar Fleisch lieferte, dank Großvaters Hüh- nern und Hasen. Ruedi war zehn Jahre älter als ich und hatte ebenfalls keinen Vater. Der hatte sich geweigert, meine Tante zu heiraten. Worauf sie ihn verließ, um ihr Glück bei einem anderen Herrn zu finden. Meine andere Tante - Großvater hatte drei Töchter und zwei Söhne - stand ihren Schwestern in nichts nach. Sie brachte eben- falls ein uneheliches Kind zur Welt.
- 2 4
- Die ungewöhnliche Häufung unehelicher Kinder aber sollte nicht der einzige dunkle Fleck in unserer Familienchronik sein. Mein Onkel übertraf seine Schwestern in dieser Hinsicht: Er er- schoss seine Freundin! Trotzdem bewundere ich ihn. Er war mir ein verlässlicher, guter Freund. Und seine heutige Frau, meine liebe Tante, stammt gar aus der Familie der Toten. Sie hatte meinen Onkel im Gefängnis kennen und lieben gelernt. Nicht nur sie, son- dern die meisten Urner haben ihm seine Tat vergeben. Nicht genug damit: Wir waren Protestanten in einem erzkatho- lischen Umfeld. Zur Zeit der Kindheit meiner Mutter wurden in der Schule gar Namen abgeändert, wenn sie nicht katholisch genug klangen: Aus Heidi wurde Adelheid, aus Ruth eine Edeltraut. Wie viele Frauen ihrer Generation sollte Mama früh in die Fabrik gehen, um »das Haushaltsgeld aufzubessern«. Da kam Hilfe aus Basel von ihrem Onkel, einem Richter. So wurde die Stadt am Rheinknie für sie das Tor zur Welt, wie später auch für mich. In Basel wurde sie verwöhnt, geliebt, modern eingekleidet. Ganz anders als ihre Geschwister in den Urner Bergen. Mama half dem Onkel, kümmerte sich um sein Büro, um die eingehenden Telefon- anrufe, um seine Zeitplanung. Er überredete Mamas Eltern, sie gemeinsam mit einer Cousine für ein Jahr in die Westschweiz zu schicken, damit sie Französisch lernen konnte. Als sie in dem klei- nen Dorf im Waadtland ankamen, fragte Mutters Cousine: »Irmeli! Meinst du, es wird dir hier gefallen?« Was für eine Frage! Irmeli strahlte. Wieder in Altdorf, besuchte sie die Sekundärschule. Für Mäd- chen zu dieser Zeit - wir sind im Kriegsjahr 1944 - sehr ungewöhn- lich. Noch ungewöhnlicher für ein Mädchen aus einer verarmten Familie, deren Großvater Hufschmied war. Nach der Schule absolvierte Mama eine Lehre als Verkäuferin - und ging anschließend in den Kanton Tessin, um auch noch Italie- nisch zu lernen. Die Schweiz ist bekannt für ihre vier Sprachen. Aber es war damals unüblich, dass ein Frau drei davon sprechen konnte.
- 2 5
- Ihr Leben im Tessin beschreibt meine Mutter als eine wunder- schöne, glückliche Zeit. Ihre Schwester arbeitete in Lugano als Saal- dame in einem Hotel. Mama wurde Filialleiterin bei Coop. Sie freundete sich mit einer wohlhabenden Signora an, einer Unterneh- merin, die wiederum meine Mutter einer Familie aus Glasgow vor- stellte. Wo sich ihr, mein, unser Schicksal entschied. In einer Nacht. Nein. Meinen mir unbekannten Vater vermisste ich in meiner Kindheit nicht wirklich, schließlich hatte ich meine Familie. Mein Papa war eben unsichtbar. Er hinterließ mir nichts, nicht mal ein Foto. Mein Vater war weder bei meiner Geburt noch bei meiner Taufe oder bei meinen Geburtstagen dabei, er stand nie am Spielfeldrand, spielte ich Fußball oder Tennis, nie am Pistenrand, fuhr ich Skiren- nen. Mein Großvater jedoch war stolz, als ich die erste und einzige Medaille meines Lebens in einer Sportart holte, die außerhalb der Schweiz absolut unbekannt ist: Schwingen. Die Fotos, die ich heute besitze, zeigen immer nur mich, manch- mal mit anderen, weißen Menschen. Den kleinen schwarzen Buben, mal mit weißen Milchzähnen oder als »Negerkuss« auf einem Schneefeld. Oder als »Jim Knopf« auf dem Dampfschiff »Uri«, das mich und Großvater über den Vierwaldstättersee dampfte. Immer war ich adrett gekleidet, immer benahm ich mich tadel- los. Die Packung Kekse, die ich für die Fahrt über den Vierwald- stättersee erhielt, hätte ich immer mit anderen Kindern geteilt, erzählte mir meine Mutter später. Ich grüßte, auch wenn ich geschnitten wurde. Werte wie Anstand, Benimm, Teilen lernte ich von meinen Vorbildern: Mama und Großvater. Es dauerte lange, bis ich mir meiner dunklen Hautfarbe bewusst wurde. Bei einem Spaziergang mit meinem Großvater - ich mag vier, fünf Jahre alt gewesen sein - fiel mir auf, dass mich all die Leute, denen wir begegneten, irgendwie seltsam anschauten. Ich erzählte dies meiner Mutter, die mir erklärte: »Das ist halt, weil du schwarz bist!«
- 2 6
- Heute weiß ich: Mama und meine Familie haben gegen so viele gesellschaftliche, urbürgerliche »Das gaht doch nid« verstoßen, dass der Alltag nur mit absolut korrektem Verhalten zu ertragen war. Meine Mutter hat seit dem Tag meiner Geburt alles für mich getan. Sie arbeitete hart, vor allem für mich. Sie wechselte ihre Arbeitsstelle, um mir mehr bieten zu können. Sie verzichtete auf eine neue Beziehung, mir zuliebe. Sie wollte nicht, dass ich erst an zweiter Stelle käme. Obwohl sie meinetwegen auf vieles verzichtete, gab sie mir nie das Gefühl, ich sei schuld daran, dass sie etwas ver- passe. Ich fühlte mich nie als Last, nie als Klotz am Bein. Weil Mama die Dinge schlicht nicht so sah. Während ich dies schreibe, liegt wieder der Urnersee vor unse- rer Haustür. Im Norden das Riitli, die »Wiege der Schweiz«, die nur eine Wiese ist. Auf der sich im Jahre 1291 drei Männer getrof- fen haben sollen, die durch ihren berühmten Riitli-Schwur die zer- strittenen Schweizer zu einer Eidgenossenschaft machten. Am Ost- ufer die Tellkapelle, Wallfahrtsort für alle Fans von »Wilhelm Teil«, den der deutsche Dramatiker Friedrich Schiller zum Nationalhel- den der Schweiz geschrieben hat. Und ich fühle mich in die Kin- dergarten- und Schulzeit zurückversetzt.
- Kindergarten, Krippenspiel oder Ich, der Mohrenkönig
- Mit fünf kam ich in den Kindergarten. Unüblich früh, weil Mama den ganzen Tag arbeiten musste. Meine Kindergartenlehrerin war ein Engel. Doch nicht in sie verliebte ich mich, sondern in Kathy.
- Meine erste Flamme. Wir wären ein tolles Paar geworden: Wir beide waren die einzigen Protestanten. Damals, in den langen Sommern und den kalten Wintern, waren wir eine große Familie im Kindergarten. Mit meinen Freunden und meiner Familie erlebte ich minderschöne Wochen: War es heiß, badeten wir im kalten Urnersee, fuhren mit den Doppelrad-Dampf- schiffen nach Luzern. Im Winter auf den nahen Bergen Ski und Schlitten. Den eisigen Wind im Gesicht. Mama arbeitete, um mehr Geld zu verdienen, bei »Dätwyler« an der Altdorfer Gotthardstraße, heute ein global agierendes Un- ternehmen für Kupfer- und Glasfaserkabel. Damals luden die Dätwylers ihr Personal zu Weihnachten noch persönlich zu einem Krippenspiel. Mir wurde eine Rolle angeboten. Logisch: Ich war die Idealbesetzung für die Rolle des Mohrenkönigs. Mich, den Schwarzen, musste man nicht anmalen. Der Nachteil: Ich hatte leichte Schwierigkeiten beim Lesen, war, wie ich rückblickend weiß, Legastheniker. Die Maria des Stückes, Ursula Isenrich, Tochter eines Direktors der Firma, schlug mir vor, die Rolle mit mir auswendig zu lernen und zu proben. So wurde aus dem Nachteil ein Anlass für viele schöne Nachmittage bei der Direktorenfamilie. Dort lernte ich auch andere Mädchen kennen, Freundinnen von Ursula. Die ich alle ab sofort sonntags in die Skischule begleitete. Das war nicht selbstverständlich in einer Zeit, als Paare noch hei- raten mussten, um überhaupt gemeinsam eine Wohnung beziehen zu dürfen. Denn die Schulen in Uri waren getrennt nach Ge- schlecht. Ich sah sonst Mädchen nur an Wochenenden oder freien Nachmittagen. Wenn mir mal eine gefiel, war ich zu schüchtern. Was auch daran lag, dass ich langsam den Unterschied zwischen arm und reich erfühlte. Sich in mir das Gefühl einschlich: Urs, für Mädchen bist du nicht gut genug! Trotzdem wuchs ich reich auf. Wir brauchten kein Geld, um Badeferien zu machen, um im Winter in die Berge zu fahren. Ich wurde groß, wie es in vielen Ländern nur sehr reichen Kindern
- 2 8
- möglich ist. In einer der schönsten Gegenden Europas, wenn nicht der Welt. Außerdem hatte ich das schönste Fahrrad des Dorfes. Ein Ge- schenk von Mama: mit königsblauem Rahmen. Eine Sensation, die ich - ohne jemals auf Stützräder angewiesen gewesen zu sein - fast Tag und Nacht vorführte. Besonders befreundet war ich mit drei Jungen, von denen zwei Max hießen: Der kleine Max Weber war der Sohn unseres Urner Nationalrats, der Vater des großen Max führte das beste Uhren- und Juweliergeschäft im Dorf, Thomas, der dritte, war neben mir der Größte in der Klasse. Seinem Vater gehörte die Papeterie. Als mir einmal, ich weiß nicht mehr wann, ein älterer Schüler »Buschneger« nachrief, ging Thomas mit den Fäusten auf den weit- aus Alteren los. Wir waren eben Freunde. Sie luden mich, den Vaterlosen, zu sich nach Hause ein. Gemeinsam machten wir Haus- aufgaben, spielten. Ihre Papas hatten schöne Häuser, dicke Autos, neue Fernseher und Haushälterinnen, die immer einen kleinen Imbiss bereiteten. Es war herrlich. In der fünften Klasse führte uns die Schulreise nach Bern, wo wir dank Nationalrat Weber das Bun- deshaus besuchen konnten und sogar von Bundesrat Nello Celio in seinem Büro empfangen wurden; dieser setzte mich vor lauter Freude über den herzigen schwarzen Buben auf seine Knie. In meiner Kindheit und Jugend erlebte ich kaum Rassismus, ich fühlte mich hundertprozentig integriert. In einem gewissen Sinn ist dies paradox: 1970, ich war vierzehn Jahre alt, warf die Ausein- andersetzung um die sogenannte Schwarzenbach-Initiative gegen die »Überfremdung« der Schweiz hohe politische und emotionale Wellen. Die Initiative wandte sich vor allem gegen die italienischen Gastarbeiter in der Schweiz. Einmal gingen wir mit einer befreun- deten italienischen Familie in ein Restaurant, in dem tatsächlich die Italiener nur auf der linken, die Schweizer auf der rechten Seite sassen. Meine Mutter setzte durch, dass wir alle an einem Tisch essen konnten. Der Sohn der Familie, Dimitri, wurde wenig später mein einziges Patenkind; heute ist er Landrat des Kantons Uri.
- 2 9
- «
- Mit meinen Freunden spielte ich Fußball, wir gingen Pony rei- ten oder schwimmen, wir fuhren Fahrrad und Ski. Es gab einen katholischen und einen reformierten Turnverein. Man schwitzte konfessionell getrennt. Daneben gab es vier Sportclubs - für Hand- baller, Fußballer, Schwinger und Velofahrer die Gott sei Dank konfessionslos waren. Ich entschied mich für den evangelischen Turnverein plus den konfessionslosen Fußballclub. Zumal ich nur ein Ziel hatte: Schule sausen lassen, Fußball spielen! So wie Pelé, der Wunderstürmer aus Brasilien. Die Hautfarbe stimmte, immerhin das.
- Mädchen, Tanzen, Fühlen oder Der erste Kuss und verlorene Unschuld
- Mädchen fanden mich definitiv toller als ich sie. Das hat sich bis heute nicht geändert. Ich liebe Frauen, bin mit vielen sehr eng befreundet. Doch am Ende fehlt mir stets ein unbedingter Erobe- rungswille. Natürlich war ich als Schüler diesseits der Pubertät vom »schwa- chen Geschlecht« angezogen. Das ging - wie ich später erfuhr - auch Karl Lagerfeld, Gianni Versace, Giorgio Armani, ja selbst Truman Capote, dem bis heute unbestrittenen Doyen der schwu- len Intelligenz New Yorks, so. So trieb ich mich vor den Häusern der gerade Angebeteten he- rum und tat so, als müsse ich ein Problem an meinem Fahrrad behe- ben, bis die Mädchen aus dem Haus kamen und mich begrüßten.
- 3 0
- >
- K
- Leider war dies meist das Ende der Szene. Ich stand da, lief als Schwarzer rot an, brachte kein Wort heraus, jetzt, wo ich sie end- lich aus dem Haus gelockt hatte. Für Manuela machte ich sogar immer einen Umweg, wenn ich Ski fahren ging. Da konnte ich ihr - Zufall, Zufall - über den Weg laufen. Aber das war auch schon alles. Für mehr war ich einfach zu schüchtern. Einmal, an einem verschneiten Winterabend, lud mich ihr Bru- der Remo oben auf dem Berg ein, bei ihnen zu übernachten, damit ich nicht den weiten Weg ins Tal und am nächsten Tag wieder den weiten Weg auf die Piste unter die Füße nehmen müsste. Eine einmalige Chance, Manuela auch mal abends näherzukom- men. Nur eben: Ich hatte Angst, mich lächerlich zu machen. Manuela und Remo. Das waren reiche Kinder. Mit einem arbei- tenden Papa und einer Mama daheim. In mir, dem kleinen schwar- zen Jungen, kroch das Gefühl hoch: Urs! Die sind etwas Besseres! So schob ich meine Mutter als Ausrede vor: »Danke, Remo. Aber ich muss nach Hause. Mama macht sich sonst Sorgen. Und wir haben ja kein Telefon!« Irgendwie war dies ein Schlüsselerlebnis. Im Sinne von: Urs, du musst im Leben alles richtig machen! Du musst freundlicher, bes- ser, attraktiver sein als alle anderen. Du bist arm, schwarz, ein Arbei- terkind. Die Reichen sind einfach anders als du. Obwohl ich heute weiß: So anders sind die gar nicht. Geld ist und bleibt eben doch nur bedrucktes Papier. Irgendwann schaffte auch ich die größte Hürde, die das Leben einem jungen Mann bereithält: den ersten Kuss! Es war einer dieser dörflichen Tanzabende. Der - wie in der Urschweiz üblich - im katholischen Kirchenhaus stattfand. Ich war nervös und aufgeregt, trug einen hautengen orangefarbenen Woll- pullover. Dazu wahnwitzig enge Hosen, unter denen meine top- modischen, vorne gemein spitz zulaufenden Lederschuhe hervor- guckten. Natürlich gewienert. Mit Spucke, Farbe, Mamas bestem Schal.
- 3 1
- Ich sah aus - hoffte ich - wie einer dieser tollen Schlagerstars aus der Zeitschrift »Bravo«. Damals die Bibel für alle in meinem Alter. Okay! Mit meinen vierzehn Jahren war ich vielleicht ein bisschen zu jung für diese Rolle. Egal! Auf so was stehen doch die Mädchen! Als die Band einen sehr, sehr langsamen Blues intonierte, über- wand mein lüsternes Ego das Ich des Schüchternen: Enger, immer näher rückte ich dem Mädchen. Meine Handflächen schwitzten. Egal! Auch wenn es unhöflich, ja unerhört ist, eine Frau, egal wel- chen Alters, näher und näher an sich zu pressen - ich konnte nicht anders. Ich musste. Und dann der große Moment. Herbeigesehnt in schwülen Näch- ten daheim: der erste Kuss! Natürlich ohne Zunge. Eher ein flüchtiges Hauchen über die fremden Lippen. Trotzdem: der erste Kuss! Als die Showband einpackte - das war lange vor Mitternacht - schwebte ich auf Wolke sieben. Und machte meine Unhöflichkeit, dieses Herumdrücken und diesen Kuss, natürlich wett: Ich beglei- tete das Mädchen ritterlich nach Hause. Mein Velo neben mir her schiebend. Wochen später ging es endlich meiner Unschuld an den Kragen. Ich verlor sie. Aber - typisch Mohr Urs - nicht einfach so. Hier muss man wissen, dass es bei uns in der Schweiz sogenannte Grümpelturniere gibt. Da treffen sich mehr oder weniger zufällig aus jungen und nicht so jungen Kickern zusammengewürfelte Mann- schaften, um mit Lust und Laune den Lederball ins gegnerische Tor zu bugsieren. Mein Grümpelturnier fand in Sempach statt. Klar, hatte ich mal wieder Angst: Ob Mama es mir wohl erlauben würde, dort zu über- nachten? Immerhin gab mir selbst der Schuldirektor für diesen Samstag frei. Seinem »Pele«. Der Samstag begann auch gut. Wir gewannen die ersten Spiele, bauten neben dem Fußballfeld unser Zelt auf - und stürzten uns in das Sempacher Nachtleben. Das aus einer Festhütte und einer Schießbude bestand.
- 3 2
- Meine Freunde tranken Bier, ich begnügte mich mit Cola. Schließlich wollte ich Fußballprofi werden. Damals trank ich kei- nen Schluck, rauchte nicht eine Kippe. Logisch, hatte ich mich herausgeputzt. Hose, Hemd, Schuhe - das musste schon harmonieren. Clearasil gegen Pubertätspickel brauchte ich nicht. Als ich gerade das Gewehr anlegte, um ein Röhrchen wegzuknip- sen, betrat eine Frau die Szene: große Brüste, noch größerer Aus- schnitt, blond plus knallrote Lippen. Die älteren Jungen waren bei diesem Anblick sofort hin und weg. Grinsten. Sabberten, wie schön es wäre mit der. Und überhaupt. Ich hatte mein Ziel im Visier. Und das mit dem Küssen war ja so toll auch nicht gewesen. Um alldem zu entgehen, floh ich ins Gemeinschaftszelt. Wo ich bald lautstark geweckt wurde. Der Reißverschluss der Zeltplane wurde hochgezogen, meine Freunde stolperten herein. Das blonde Gewitter, die Blondine, im Schlepptau. Ich stellte mich schlafend. Zu meinem atemlosen Ent- setzen setzte sich die Frau neben mich. Einer meiner Freunde ver- teilte Bier. Alle waren von der Rolle. Sie zogen sich bis auf Unter- hemd und Hose aus, spielten an sich rum, begrapschten mit ihren unerfahrenen Fingern die Frau. Der das zu gefallen schien! Blinzelnd, durch meine halb geschlossenen Augen, sah ich auch bei mir eine mir wohlbekannte, aber bisher private Wölbung, vorne in der blütenweißen, von Mama gewaschenen Unterhose. Wahn- sinn! Die Frau ließ sich von meinen Freunden anfassen, küssen, bis auf Höschen und BH ausziehen. Ich war fassungslos. »Warum zieht ihr nicht einfach Streichhölzer? Um zu sehen, wer das größte zieht. Und als Erster von euch darf?« Schon krochen meine Freunde auf allen vieren. Auf der Suche nach Streichhölzern. Bei diesem hektischen Gewühl lag ich im Weg. »Komm schon, Urs, steh endlich auf, du musst auch ziehen!« Ein seltsamer Schauer lief mir über den Rücken. »Nein, nein ... danke, das ..., das überlasse ich euch.« Mir war nicht danach - schon gar nicht vor Publikum. Ich hatte
- 3 3
- noch nie mit einer Frau geschlafen, hatte null Erfahrung, kannte nur die Abbildungen aus den Medizin-Büchern. Wie so was tech- nisch vor sich geht. Sie ließen mich in Ruhe und zogen ihre Hölzer. Als der Sieger feststand, konnte ich nicht mehr stillliegen. Ich wollte zusehen. Also setzte ich mich aufrecht hin - und war beeindruckt. Mein Freund wirkte so selbstsicher und erfahren und rieb sich - so schien es mir - sehr gekonnt den Penis mit seinem Speichel ein. Ebenso gekonnt presste das blonde Objekt seiner Begierde aber die Schen- kel zusammen. Nun entstand ein wirres Durcheinander. Der Sieger rief, fast plat- zend: »Ein Pariser! Ein Pariser!« Andere suchten hektisch nach Kondomen. Neben mir spritzte einer meiner Freunde beim Versuch, sein bestes Stück und eines der gefundenen Kondome zusammen- zuführen, auf sich und die Luftmatratze. Dann ihr Befehl an die Meute: »So nicht! Ihr dürft alle, aber ich suche den Ersten aus.« Stille. Sie deutete auf mich. Einer meiner Freunde - auf dem Spielfeld Verteidiger - erklärte ihr hastig: »Der gehört nicht zum Team!« Die anderen aus Mittelfeld und Sturm aber grölten: »Komm schon, Urs, sei kein Spielverderber.« So kam, was kommen musste. Ich nenne keine Details. Ich schoss mein erstes erotisches Goal. Ganz ohne Deckung. Nebenbei: Am nächsten Tag verloren wir unser Spiel. Die Besten von uns waren einfach lendenlahm, irgendwie müde.
- 3 4
- Fußball, Lernen, Modeschau oder Aus der Traum vom Fußballprofi
- Das Uberraschende im Leben ist nie das, was man will, sondern das, was man anfangs von Herzen ablehnt - um es dann zu seinem geliebten Beruf zu machen. Als Mama mich in Zürich anrief, um mich zu bitten, als Manne- quin an einer Modeschau teilzunehmen, war ich achtzehn. Mein Leben bestand aus fünf Terminen: aufstehen, Fußballschuhe pa- cken, im Tram das Nötigste lernen, den Vormittag überstehen - dann Fußball. Meine Leidenschaft. Mein Leben wäre anders verlauten, hätte Mama nicht gesagt: »Urs, du kennst doch unser Modegeschäft Körner in Altdorf. Die veranstalten eine Modeschau. Ich habe mir gedacht: Du könntest doch denen helfen. Und mitmachen! Weil du ja immer so perfekt in die Kleider passt.« »Mami, das ist nichts für mich. Ich bin Fußballer, keine Tunte.« Ich hörte förmlich, wie meine Mutter am anderen Ende der Lei- tung die Stirn runzelte. »Was ist eine Tunte, Urs?« »Das sind Schwule.« »So spricht man nicht. Solche Worte habe ich dir nicht beige- bracht«, tadelte sie, um dann anzufügen: »Urs. Ich meine ja n u r . . . Du könntest mir eine große Freude machen.« Das wars. Mama jobbte jeden Samstag im Modegeschäft Körner - um zusätzlich Geld zu verdienen, für mich.
- 3 5
- Also nahm ich an den Proben teil. Und kam auf die Welt: Him- mel, diese »lebenden Kleiderstangen« nehmen ihren Job ja ernst! Diese schönen Körper. Das waren professionelle Modelle! Sie zeig- ten mir, wie ich zu laufen habe, wie ich das Jackett auf dem Lauf- steg öffnen muss, um den Zuschauern einen Gesamteindruck des Anzugs zu offenbaren. . Die Hälfte des Publikums kannte ich. Und jetzt war schon ich dran, im Skianzug, mit Skiern auf der rechten Schulter! Ich zitterte mich Meter um Meter nach vorne. Dann der erste, der zweite Klat- scher. Schließlich feierten mich alle. Winkten, lachten mir zu! Nach der Show gratulierten mir die anderen Modelle, die pro- fessionellen. Als ein Dressman mich mit Küsschen abbusselte, ret- tete mich eine Dame: »Hände weg von unserem Knaben!« Zu meiner Überraschung erhielt ich von Trudy Körner einen wei- ßen Umschlag. Inhalt: 200 Franken. An ein Honorar hatte ich über- haupt nicht gedacht. Und keine Stunde später kam Pauli Baumann, der früher bei Körner angestellt war und zu Head gewechselt hatte, auf mich zu und bot mir an, im Hotel International in Zürich für die Show des großen US-Sportswear-Herstellers zu laufen. »Ich weiß nicht, Pauli! Muss meinen Trainer fragen. Wegen dem Fußballtraining.« »Na, Donnerstagabend um 20 Uhr trainierst du garantiert nicht.« »Verdiene ich da auch etwas?« »600 Franken.« Ich sagte Pauli und Head zu. Zwei Wochen später war es so weit. Auf der Head-Show sprach mich ein Henri Charles Colsenet an, ein Designer exklusiver Skianzüge und Tenniskleider der Marke HCC: »800 Franken pro Tag. Modewoche in München. Spesen für Reisen, Hotel, Essen exklusive.« Der Grundstein für meine Modellaufbahn war gelegt. Doch lange vorher war ich erst einmal durch die Aufnahmeprüfung für das Lehrerseminar in Uri gefallen und hatte in Basel eine Lehre als Chemielaborant bei Ciba-Geigv begonnen, obwohl Chemie und Physik mich nicht die Bohne interessierten.
- 3 6
- Ich, Urs Althaus aus Altdorf, die »schwarze Perle auf dem grü- nen Rasen«, wie mich eine Zeitung nannte, wollte damals nur eines: Fußball spielen! Mein Traumverein: der FC Zürich. Aber ich - allein in Zürich? Zu heiß für Mama. Also Basel, wo Mamas Schwes- ter wohnte, die mich mit strengem Auge überwachte. Obwohl ich den rot-blauen Dress des FC Basel als hässlich emp- fand, wurde ich zum Probetraining in die Inter-A-Juniorenmann- schaft des FC Basel aufgenommen. Immerhin war Basel damals Schweizer Meister, Ottmar Hitzfeld 1973 Torschützenkönig. Eine aufregende Zeit! Meine Kollegen kamen mit einer Gruppe von Freundinnen zum Fußballplatz. Bei mir daheim, in Altdorf, gab es so etwas nicht! Eines dieser verführerischen Geschöpfe stand auf mich. Klein, prächtige Kurven, tiefdunkle Augen, kecker Bubikopf: Franzi. Sie war reifer als ich, aus sehr gutem Haus. Der Verlauf der folgenden Romanze ist ein Steinchen in meinem Lebensmuster: Urs! Du bist schwarz! Unehelich. Du kannst Fränzi doch nie das Wasser reichen. Doch wer lässt schon, schwer verliebt und ehrgeizig, solche Gedanken zu? Das erste Treffen mit Fränzis Eltern war ein Fiasko - für mich und meine Vorurteile. Was erwartete ich? Reiche Menschen, Villa, Swimmingpool - garantiert Rassisten, denen ein Schwarzer nicht in das blau getäfelte Bassin kommt! Schwachsinn: Ich war der Rassist! Sie hatten nicht das Gerings- te gegen meine Hautfarbe. Gut, Fränzis Mutter wäre Tennis lieber gewesen als Fußball. Als ich ihr sagte: »Madame. Ich spiele auch Tennis«, wollte sie mich sofort in ihren Club aufnehmen lassen. Fränzis Vater war begeistert von meinem »ordinären« Sport. Irgendwie verstanden die beiden aber die Zeitachse der Liebe nicht. »Urs und Fränzi«, sagten sie ernst. »Wir sind noch zu jung, um für euch aus unserem Haus auszuziehen.« Mir verschlug es die Sprache. Fränzi und ich waren nicht mal volljährig - schon ging es um Hochzeit, Ehe, Haus, Familiengrün- dung.
- 3 7
- Und bald kam es so, wie es eigentlich immer kommt, wenn arm und reich sich paaren: Der Kleine kann sich die Große am Ende doch nicht leisten. Lehrlingslohn gegen Taschengeld, Tante gegen Villa - und das mit Mamas Erziehung («Bub! Du musst eine Frau ernähren können!«) war zu viel. Wir trennten uns. Als Fußballer erntete ich beim FC Basel einmal den falschen Applaus. Teófilo Cubillas, ein Weltstar, in Südamerika vergöttert, wurde in Basel erwartet, um hier seinen Vertrag zu unterschreiben - genau an dem Tag, als ich ein Spiel mit der Interjunioren-B-Mann- schaft anschauen wollte - und fröhlich auf der Tribüne saß. Da wurde ich plötzlich frenetisch beklatscht. Der Applaus wärmte mein Herz. Doch die Fans verwechselten mich mit Cubillas, seine peruanische Braun-Blässe mit meiner innerschweizerisch-nigeriani- schen. Am nächsten Tag stand die Episode in der Zeitung. Fußball ist ein hartes Geschäft! Gerade noch hatte mich Junio- ren-Cheftrainer Toni Schnyder beim FC Basel aufgenommen, schon plante er die nächste Saison ohne mich. Flugs wechselte ich zum FC Concordia, zu deren Inter-A-Mannschaft, und wurde in die Nordwestschweizer Auswahl aufgenommen. Eine Episode aus dieser Zeit: Bei einer Fahrt dieser Schweizer Auswahl nach Deutsch- land entdeckte ein Grenzwächter durch die ungetönten Scheiben mein getöntes Gesicht! Befahl: »Aussteigen!« Machte einen auf »Menschenschmuggel im Fußballbus«. Fußballerisch war ich zufrieden. Aber meine Lehrstelle als Che- mielaborant war ein Graus: Tropfen zusehen, wie sie im Sekunden- takt in ein Reagenzglas fallen, damit ich den pH-Wert irgendeiner Lösung kontrollieren konnte. Mein Laborchef, Doktor Schröder, verstand mich. Ich erzählte ihm alles: dass ich die Lehrstelle nur angenommen hatte, um beim FC Basel trainieren zu können. Dass ich meiner Mutter verspro- chen hatte, einen anständigen Beruf zu erlernen, dass ich sie nicht enttäuschen wollte. Doktor Schröder verschaffte mir eine neue Lehrstelle, beim Rei- seunternehmen Wagons-Lits Cook an der noblen Freie Straße in
- 3 8
- Basel. Statt mit Reagenzgläsern beschäftigte ich mich mit Men- schen. Und hatte den Kopf frei für das runde Leder. Beim sechsten Spiel der Saison traf meine Concordia Basel auf den FC Zürich. Meinen Traumclub. Am nächsten Tag erhielt ich ein Angebot von Zürich. Doch meine Mutter war dagegen! Erst als der damalige FCZ- Präsident Edi Nägeli ihr versprach, sich um mich und eine Lehr- stelle in Zürich zu kümmern, gab Mama nach. Tatsächlich rief Nägeli seinen Freund Jack Belli an. Der war zwar Mäzen des Riva- len, der Zürcher Grasshoppers. Wichtiger aber: Bolli war Chef des Schweizer Reisegiganten Kuoni. So siedelte ich um. Ich wohnte beim Juniorenobmann des FC Zürich und arbeitete im Kuoni- Außenbiiro im Fünfsternehotel Zürich. Warum? Damit - wie Jack Bolli sagte -, die anderen Lehrlinge nicht mitbekamen, dass ich jeden Nachmittag trainieren durfte. Beim Training des FC Zürich lernte ich dann all meine Idole ken- nen: Köbi Kuhn, Rosario Martineiii, Daniel Jeandupeux und den knallharten Trainer aus dem deutschen Ruhrpott, Timo Konietzka. Es war ein mörderisches Training. Mit Übungen, zu Folter- zwecken erfunden. Zum Abschluss jagte uns Konietzka die Tri- bünentreppen hoch und runter. Glücklicherweise bot mir Daniel Jeandupeux, ein technisch versierter Pfiffikus und Mitglied der Nationalmannschaft, an, sein Trainingspartner zu werden. Ich wusste bald, wieso. Er hasste dieses Aufbautraining ebenso wie ich. Er schummelte, wo er nur konnte. Von ihm lernte ich, wie man Lie- gestütze vortäuscht. Wie man Übungen echt aussehen lassen kann, ohne einen Tropfen Schweiß zu vergießen. Mit anderen Lehrlingen der Reisebranche verbrachte ich einen Monat in London, um Englisch zu lernen; hier sah ich in der U-Bahn zum ersten Mal in meinem Leben größere Gruppen von Schwarzen. Eines schönen Tages musste ich als Jahrgang 1956 zum Schwei- zer Militär, zum sogenannten Stellungstag. Viele simulierten Platt- füße, Atem- oder Herzbeschwerden. Keiner wollte gerne zum Dienst an der Waffe. Ich entschied mich für schreckliche Oberschenkel-
- .39
- krämpfe. Die traten plötzlich auf, während des Dauerlaufs, bei dem ich in Führung lag und am Ende nur mehr ins Ziel humpeln konnte. Es funktionierte. Trotzdem konnte ich mich dank viel Bier auf der Terrasse des Restaurants Löwenbräu aufraffen, allen Frauen zuzugrölen: »Ja, Mutter, schau, das ist dein Sohn! Er ist im Urner Bataillon...« Doch man soll nie simulieren. Am Ende fällt es auf einen zurück: Bei einem Trainingsspiel kugelte ich mir die Elle aus. Operation. Ergebnis: Ich konnte meinen Arm weder strecken noch beugen. Zweite Operation. Ergebnis: keine Besserung. Eine weitere Operation in einer Privatklinik änderte auch nicht viel. Schließlich das grausame Urteil: Urs Althaus! Vergessen Sie eine Karriere als Profisportler. Bauen Sie sich ein neues Leben auf. Nicht nur eine Karriere als Fußballer konnte ich vergessen, mit einem beinahe lahmen Arm wäre es kaum mehr möglich, zu Auf- tritten als Modemodel zu kommen. Doch wider Erwarten enga- gierte mich der beste Schweizer Herrenmodedesigner, Hannes B., für seine Modeschau. Starfotograf Ernst Wirz lichtete mich für eine Modestrecke in der »Schweizer Illustrierten« ab. Alle meinten: »Urs! Du musst dich bei einer großen Modelagentur bewerben.« Und meine Mutter? »Wenn du meinst, dass du eine Chance hast - versuch es!«
- 4 0
- München, Bangkok, Hongkong, Tokio, Paris oder Ich gewöhne mich an die Laufstege
- Und ich versuchte es. »Mami, stell dir nur vor, ich kann als Model in drei Tagen mehr Geld verdienen als in einem ganzen Monat im Büro. Ich könnte reisen und die Welt kennen lernen!« Schon kamen Angebote, die Welt wartete. Zum Beispiel Tokio, Präsentation der neuen HCC-Kollektion. Mit einem verlockenden Reiseplan: Flug von Zürich nach Bangkok - drei Tage frei, Weiter- flug nach Hongkong - drei Tage frei. Anschließend eine Woche Arbeit in Tokio. Wahnsinn! Schon ein Flug Zürich-Tokio kostete damals 6000 Franken. Und dann sollte ich auch noch 6000 Franken Honorar bekommen. Sagenhaft. Was würde ich eigentlich als Reisekauf- mann mit Lehrabschluss bekommen? Höchstens 1500 Franken, pro Monat! Bloß den Abschluss als Reisefachmann hatte ich noch nicht: also wenigstens das erledigen. Als angehender Fußballprofi wären mir meine Noten bei der Abschlussprüfung egal gewesen. Aber jetzt wollte ich gut abschneiden. Mama brachte mir in Altdorf Stenografie bei. Französische Models paukten mit mir nach einer Modeshow in Genf Franzö- sisch, englische gaben mir in ihrer Sprache Nachhilfe. Und in Zürich bildete ich mit drei weiteren Prüfungsanwärtern, einem Jun- gen und zwei Mädchen, eine Lerngruppe. Und da soll mir mal jemand sagen, Showbusiness verführe zu
- 4 1
- Drogen! Nein! Es war die Schule: Wir nahmen Speed und lernten Tag und Nacht. Ich setzte alles auf eine Karte und hämmerte mir die Antworten auf alle Fragen zu internationalen Flügen, Charter-Reisen, Ticke- ting, Visumsanträgen ein - ich erschien zur Prüfung mit meinem Reisegepäck, in der Hoffnung, ich würde dann nur zum Thema Flugreisen befragt; alle anderen Bereiche ließ ich weg, ich hätte über Bahnreisen keine Auskünfte geben können. Doch meine Risikobereitschaft zahlte sich aus. Und fünfzehn Minuten nach dem bestandenen Examen saß ich im Taxi, Richtung Flughafen Zürich Kloten. Genauer: Richtung Asien. In Bangkok schämte ich mich für meine hässlich-dicken Lands- leute, die sich ordinär mit Thai-Girls unterhielten. In Hongkong besuchte ich Antiquitätenläden, auf der Suche nach einem Ge- schenk für meine Mutter. Ich fand eine Vase. Mir selbst gönnte ich einen H u n d aus Porzellan. In Tokio wurde ich als Einziger bei der Einreise kontrolliert. Und, logisch, mein Schweizer Pass wurde als gefälscht erachtet. Ich lernte einmal mehr: Ein Schweizer kann nicht schwarz sein! Also ab ins Polizeibüro, zum Verhör, japanische Köpfe wurden rot, ge- beugt über meinen roten Pass mit dem weißen Kreuz. Vorurteile? Die pflegte auch ich in Tokio. Abends im Nobelho- tel bediente mich ein Kellner, der so groß war wie ich. Völlig ver- dattert fragte ich auf Englisch: »Sind Sie Japaner?« »Ja, warum?« Schon bald ging es nach Paris. Natürlich im Pariser Look à la Althaus: knallrote Fiorucci-Jeans, dunkelblaues Béret, schwarze, synthetische Jacke von Yves Saint Laurent mit Lackoptik. Très chic. Da musste doch schon im Zug, selbst in der zweiten Klasse, jeder sehen: Voilà - hier kommt ein Topmodel. Das Topmodel war übri- gens perfekt ausgerüstet mit Schnappschüssen, aufgenommen bei Mode-Events in Zürich. In Paris schwang ich mir - wie später in der legendär-schwulen Parfüm-Kampagne von Jean Paul Gaultier - lässig meinen See-
- 4 2
- mannssack über die Schulter, bestieg wie ein Superstar ein drecki- ges Taxi. Nannte die Adresse von Peter, einem Freund aus Zürich, von Beruf Tänzer, mit Wohnung im Quartier Montparnasse, der Schlüssel war hinterlegt. Peters Pariser Wohnung war klein, char- mant, Mansarden-Schick, Holzbalken an der Decke, Wände in purem Weiß. Mit Peter gings am ersten Abend ins In-Lokal, den »Club 7« an der Rue Ste-Anne. Ein Schwulenclub mit Gourmet-Restaurant. Gäste waren die Reichen und Schönen, Anna Picasso, Yves Saint Laurent, Kenzo, Rudolf Nurejew. Und ein Besitzer, der schlaksig auf mich zukam, mich höchstpersönlich zu einem Drink meiner Wahl auf Kosten des Hauses einlud. Peters Kommentar: »Ich glaube, Paris liebt dich.« Gegen zwei Uhr morgens Nachtspaziergang. Avenue de l'Opéra. Laternenlicht und leere Straßen, Louvre, Jardin des Tuileries, der Eiffelturm. Leise fiel der Regen auf die menschenfreie Place de la Concorde, das Laternenlicht spiegelte sich im Kopfsteinpflaster, dazu die Stille und Schönheit dieser wunderbaren Stadt. Und dann fing Peter an zu tanzen und sang »I'm Singing in the Rain«. Bis heute besuche ich bei jedem Aufenthalt in Paris - sollte es regnen - in der Nacht die Place de la Concorde. Am nächsten Morgen weckte mich Peter mit frisch aufgebrüh- tem Kaifee, ofenfrischen Butter-Croissants und einem Stadtplan mit vielen Punkten - den Adressen all der Modelagenturen, die eigentlich nur auf mich warteten. Beziehungsweise andersrum: »Urs, du musst vorbereitet sein. Die Konkurrenz ist groß. Es wird hart. Du kannst nicht durch Paris schlendern und denken, der Rest ergebe sich von allein.« Egal. Ich war überzeugt, Paris war meine Stadt. Mit und ohne Stadtplan. Was machte mich nur so verdammt gelassen und selbst- sicher? Zur ersten Agentur kam ich zu früh. Als ich um zehn Uhr zurück- kehrte, ließ man mich warten: »Haben gerade eine Kollektion!« Keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte.
- 4 3
- Dann empfing mich eine kleine, drahtige Frau, Sophie, sympa- thisch, aber hart. Ich fragte: »Darf ich Ihnen meine Fotos zeigen?« Ein Blick genügte: »Sorry, Baby, wir haben schon einen Black. Wir nehmen nur einen. Und der ist der neue Star von Paris...« »Wer ist es?« »Du kennst ihn eh nicht. Er heißt Marion!« Doch, ich kannte ihn. Er hatte in Zürich einmal bei mir über- nachtet, weil er nicht gerne alleine in Hotelzimmern schlief. Das sagte ich nicht. »Ich kenne ihn. Aber Marion ist doch bei der Agentur Elite!« Sie lächelte. »War er bis gestern. Jetzt ist er bei uns.« »Das heißt...« »... geh doch zu Elite! Vielleicht nehmen die dich ja, da Marion jetzt bei uns ist!« Sophie, die später meine Topbookerin werden sollte, schrieb mir die Adresse von Elite auf. Das wars. Schüchtern suchte ich Elite auf. Eine ältere Dame saß an einem Pult, telefonierte lauthals, rauchte eine Zigarette nach der anderen. Sie reichte mir die Hand, murmelte ihren Namen: »Isabelle.« Ich begann innerlich zu beten: Lieber Gott! Bitte nicht gleich wieder eine Absage!
- 4 4
- Ford, Elite, Saint Laurent oder Erstmals Kokain - bei Andy Warbols Afterparty
- Damit man mein Leben in dieser verrückten Modemodelwelt ver- stehen kann, muss ich etwas ausholen. Es war John Robert Powers, der das Modelbusiness erfand. Er hatte um 191.5 die Idee, sich für eine Seifenwerbung zusammen mit dem damaligen Stummfilmstar Mary Pickford ablichten zu lassen. Drei Tage lang erschien John beim Fotografen - keine Mary weit und breit. John aber kassierte pro Tag 30 Dollar. Das ist es, sagte sich John und heuerte am Strand von Venice einige Möchtegern-Schauspielerinnen an, überredete außerdem einige bereits leidlich bekannte, ließ sie fotografieren - und schick- te den Katalog mit ihren Porträts, Maßen und Beschreibungen an Werbefotografen, Kaufhäuser und Kunstmaler. 1932 hatte er ein dickes Hardcover-Buch mit Models, die bei ihm als Fixum pro Tag 25 Dollar bekamen. Den Rest sackte John ein. Powers war übrigens auch der Erfinder von Modelpartys. Dazu lud er Milliardäre aus den Familienclans der Vanderbilts, Rocke- fellers und Mellons ein, die in den Powers-Girls willige Gefährtin- nen für ausgedehnte Lustreisen oder sonstige lustvolle Spiele sahen. Meute taucht der Name John Robert Powers allerdings nur mehr in akademischen Dissertationen auf. Auf ihn folgten Hochstapler und Ganoven. So wurden Harry Conover und Walter Thornton, die zu den ersten Modelagenten gehörten, verhaftet, und ihre Kar- rieren endeten mit Schimpf und Schande.
- 4 5
- Dann säuberte Eileen Ford das Geschäft mit eisernem Besen. Als ihr Mann Jerry in den Krieg musste, wurde Eileen Stylistin, Wer- betexterin, vermittelte als Sekretärin Freundinnen für Modekata- loge, brüllte sie an: »Wrenn du nicht pünktlich sein kannst, hau ab!« Oder Fotografen: »Wenn Sie besoffen sind, werden Sie nie mehr eins meiner Mädchen bekommen!« So wurde Eileen Ford die Urmutter der Modelagentinnen, Gegenspielerin der Machos, ob schwul oder hetero, in der Szene der weltweiten Mode. Sie brachte Zucht und Ordnung in diesen brodelnden Morast aus Schönheit und Geld, Sehnsucht und Neid, Tücke, Glamour, Habgier und unfassbarem Ruhm. Die Models sind die visuellen Projektionen der Träume von Milli- onen, gelten als Ikonen des jeweils aktuellen Lifestyles, obwohl sie ganz offensichtlich in einem oberflächlichen Milieu leben. Sie sind die Metaphern für Dinge von großer soziokultureller Bedeutung wie Gewinnstreben, Sexualität und Ästhetik. Im Dienste der Image-Ver- käufer preisen die Models in Filmen, Videos, Spots, Fotos und Anzeigen nicht nur Kleider und Kosmetika an, sondern ein komple- xes psychologisches und gesellschaftliches Ambiente: eine gewaltige kommerzielle Fiktion, die sich Lebensstil nennt. Das alles weiß ich aus der Erfahrung vor und hinter der Kamera, als Model wie als Modelagent. Und so läuft das Geschäft: Kunden, Werber, Designer, Fotogra- fen und Moderedakteure erfinden Storys, um Produkte zu verkau- fen. Models sind die Stars dieser Geschichten. Junge Männer schinden ihren Körper, um auszusehen wie Marcus Schenkenberg. Junge Mädchen hungern sich fast zu Tode, um zu sein wie Bünd- chen, Moss, Schiffer. Nur wenige haben die Gnade Gottes, einfach wunderschön geboren zu werden, wie etwa mein Lieblingsmodel Iman aus dem Sudan. Alles würde nicht funktionieren ohne die Agenturen. Diese sind freilich eher Managementcenter als soziale Werkstätten. Alles, was der Eigentümer einer Agentur wirklich besitzt, ist ja nur das Recht, für die Models einen Job zu finden.
- 4 6
- Der eigentliche Ansprechpartner eines Models ist nicht die Agenturchefin oder der Agenturchef: Es sind die Bookerinnen oder Booker, die über Aufträge verhandeln und Jobs an Models weiter- leiten. Sie nehmen die Rolle des Arbeitgebers ein, als eine Art Kreu- zung zwischen Banker, bestem Freund und Seelsorger. Agenturen verdienen ihr Geld alle auf ähnliche Weise. Sie nehmen zwanzig Prozent vom Kunden und zwanzig Prozent vom Model. Bis es aber so weit ist, müssen Agenturen erst Geld in das Model inves- tieren. Gut aufgehoben sind Models nur in guten Agenturen. Durch gute Kontakte gelingt es einer Agentur, die »new faces« seriösen und erfolgreichen Fotografen für Tests zu vermitteln, die dazu dienen, ein Testbuch des Models zusammenzustellen. Erst dann geht es zu den Kunden. Anfangs vor allem zu den Redak- tionen, um möglichst schnell ein redaktionelles Modelbook zu erhalten. Schließlich begleitet man »the new face« zu den Mode- designern, den besten Fotografen und den großen, erfolgreichen Werbeagenturen. Der Booker unternimmt alles, um das Model zum Star aufzu- bauen. Wird ein Model nicht von einer Topagentur vertreten, ist der Traum vom Topmodel nicht zu realisieren. Nur wer zu den zwanzig Besten der Weltmodelszene gehört, kann es zu großem Reichtum bringen. Wer es unter die Top-Zweihundert schafft, hat zumindest ausgesorgt. Früher regierten nur zwei Managementagenturen die Model- szene: Ford und Elite. Heute hat sich diese Szene in viele neue und gute Agenturen aufgesplittet. So haben auch Agenturen wie IMG, Women, Fashion, dna, Next, Wilhelmina, Storm, Bananas und an- dere große Stars unter Vertrag. Elite wurde 1972 von den Lebemännern John Casablancas, Gerald Marie und dem Schweizer Alain Kittler in Paris gegründet. John Casablancas brachte Sex ins Geschäft, der Eidgenosse Alain Kittler als stiller Mann im Hintergrund das Management- Know-how, dass man eine Agentur wie eine Bank zu führen hat. Und Rechnungen in der Schweiz ausstellt. Da hier die Gebühren,
- 4 7
- die Steuern, ja das gesamte Business lohnender sind als zum Bei- spiel in Paris oder Mailand. Nebenbei: Heute wird das Modell von Elite von fast allen Agenturen weltweit kopiert. Mit den US-Agenturen von Eileen Ford und Gertrude Wilhel- mina, die als prüde galten, lieferte sich Elite erbitterte Kämpfe. John Casablancas, der auf Sinnlichkeit setzte, übertrumpfte beide. Ford und Casablancas dealten immer wieder zusammen, zerstritten sich wieder. Der eigentliche Agenturkrieg begann, als John in New York eine Filiale von Elite eröffnete. Bis dahin hatten sich Ford New York und Elite Paris die Modelwelt geteilt. Noch in Paris hatte ich John versprochen: »Wenn du in New York Elite eröffnest, dann werde ich bei dir arbeiten.« Und so kam es auch. Ich hielt mein Wort, als ich für das Cover von » G Q « gebucht wurde: Elite bekam den Agenturanteil und nicht Zoli. John Casablancas war begeistert und meinte: »Urs, du hast einen Wunsch frei.« Jahre später sollte ich den einfordern. Es war eine fantastische Sache, eines der ersten Models von Elite in New York zu sein. Ich spürte die Aufbruchstimmung in der Agentur, die in den ersten Tagen nur spärlich eingerichtet war. Top- bookerin Monique Pillard, eine Französin, wechselte von Ford zu Elite. Stars wie Christie Brinkley kamen, Beverly Johnson, das erste schwarze Model auf dem »Vogue«-Cover, und die tolle Janice Dickinson. Wir waren eine verschworene Bande, lachten viel, halfen uns gegenseitig. Auf dem Boden sitzend, aßen wir Pizza. John, Moni- que und ich schrien jedes Mal vor Freude, wenn wieder ein Top- model von Ford New York zu Elite New York wechselte. Für mich ist und bleibt es John Casablancas, der das heutige Top- management der Agenturen einführte. Bevor Elite in New York eröffnete, verdienten wir Männer und Frauen 75 bis 100 Dollar die Stunde, 600 am Tag. Als Elite richtig loslegte, stiegen die Honorare auf 150 die Stunde und 900 am Tag. Nur eine oder zwei Wochen später lagen die Honorare bei 1500 am Tag. Dann stiegen die Superhonorare bis auf
- 4 8
- 5000 Dollar. Lauren Hutton und Margaux Hemingway erhielten die ersten Millionenverträge. Isabella Rossellini sagte mir mal: »Es ist verrückt. Ich kriege 8000 am Tag und könnte noch mehr verlangen. Das finde ich absurd. Bin doch schon mit den 8000 zufrieden.« Casablancas war es auch, der den Kunden klarmachte: Okay, ihr habt Supermodel Linda Evangelista gebucht - also verlange ich auch eine prozentuale Beteiligung, wenn der Umsatz steigt. John wusste, dass gewisse Gesichter in einem Katalog, auf einem Plakat oder in der Werbung einfach mehr Kleider verkaufen als andere. Als die Kunden auf diese Umsatzbeteiligung nicht eingin- gen, verlangte John 25000 Dollar am Tag plus die Rechte. So ver- dienten die Topgirls inklusive der Rechte an Anzeigen leicht über 100 000 D o l l a r - p r o Tag! Hollywood hatte in diesen Zeiten keine echten Stars zu bieten. Also gingen Modehäuser und Designer dazu über, exklusiv »Ge- sichter« für horrende Gagen zu verpflichten. Genau das ist der Grund, warum bis heute Supermodeis wie Linda Evangelista, Cindy Crawford, Christy Turlington und Kate Moss zu »Marken« wurden, die fast jede Frau auf diesem Erdball kennt. Doch das alles lag noch in weiter Ferne, als ich in Paris schüch- tern bei Elite eintrat. Die ältere Dame am Pult telefonierte und rauchte nicht nur, neben ihr stand auch ein Glas Bier. Bei jedem neuen Anruf, den sie entgegennahm, lächelte sie mir kurz zu und meinte mit rauchiger sexy Stimme: »Excusez-moi.« Und als das Telefon endlich mal nicht klingelte: »Was machst denn du hier?« Umständlich begann ich, mich auf Französisch zu erklären, wurde aber sofort unterbrochen. Sie lachte. »Du bist Schweizer! Na, dann lass uns Schweizerdeutsch spre- chen!« »Hast du ein Buch?«, fragte sie und fügte an: »Bitte entschul- dige, aber wir haben gerade Kollektion, und das Telefon klingelt nonstop.«
- 4 9
- »Was für ein Buch?« »Na, dein Modelbuch!« »Nein«, versuchte ich ein Lächeln. »Ich habe kein Modelbuch. Ich fange gerade erst an. Aber ich habe Fotos mitgebracht.« »Mon Dieu, auch noch ein Anfänger!« Ich war beleidigt. »Nein, ich bin kein Anfänger«, verteidigte ich mich, »ich habe in der Schweiz an vielen Shows mitgemacht.« Sie lächelte nachsichtig. »Na, dann zeig mal her.« Stolz überreichte ich ihr meine Fotos, alle in der Größe von Post- karten. Sie betrachtete meine Bilder mitleidig, dann mich: »Immerhin! Du siehst ganz gut aus. Aber warum - um alles in der Welt - kommst du erst jetzt? Am vorletzten Tag der >Pret-ä-porter<?« Sie erklärte: »Das sind die Shows, auf denen die Modedesigner ihre neue Kollektion der Presse und den Einkäufern vorführen. Modelle von Kleidern, die erst später hergestellt werden. Da hät- test du sehr gut arbeiten können. Jetzt ist es zu spät. Sorry.« »Aber ich bin extra nach Paris gefahren, um eine Agentur zu fin- den«, stammelte ich, »in der Schweiz gibt es für Schwarze keine Arbeit im Modebusiness.« Prüfend sah Isabelle mich an. »Okay, ich probiere mal was.« Und dann rief sie bei Yves Saint Laurent an. Sie pries mich in den höchsten Tönen, sprach von New York, dem neuen Star, dem »gar^on noir«. Als sie den Hörer auflegte, meinte sie nur: »Voilä, Urs. Du triffst heute um 1.5 Uhr Yves Saint Laurent. Ich habe gelogen und gesagt, du kommest frisch vom Flughafen, aus New York. Also bitte, zeig niemandem deine Fotos, sonst machst du dich lächerlich, und ich verliere meine Reputation. Du kommst aus New York und hast dein Modelbook verloren, klar? Ach, und sei absolut pünktlich!« Auf einen Zettel notierte sie: Loulou de la Falaise und Pierre Berge, und die Adresse - Avenue George V.
- 5 0
- In dem palastartigen Gebäude begrüßte mich Monsieur Berge, führte mich in ein Museum von Kleidern und Kronleuchtern. Ich hatte viel Zeit, mich umzusehen: Der große Meister würde kom- men, wenn er eine freie Sekunde fände. Dann rauschte plötzlich jemand herein, in einem weißen Dok- torkittel. Er kam auf mich zu, lächelte, gab mir die Hand, sagte: »Bonjour.« Natürlich war er nicht allein, eine Entourage begleitete ihn. Trotzdem erkannte ich ihn nicht. »Wer sind Sie?« Stille im Saal. Ich schluckte. »Oh«, lächelte er schüchtern, »excuse-moi. Ich bin Yves. Yves Saint Laurent.« Das Eis war gebrochen. Zumal er ungläubig lächelte, als ich ihm sagte: »Monsieur. Ich bin Schweizer!« Ein schwarzer Schweizer? Das hatte selbst dieses Genie der Mode noch nicht gesehen. Egal. Er rief nach einem Outfit. Ich musste mich ausziehen. Bis auf die Unterhose. Wurde von dienstbaren Geistern angestarrt: Der da! Ein Schweizer! Und schwarz! Das Outfit kam. Ein Traum aus schwarzem Satin und Seide, ein marokkanischer Smoking, den Saint Laurent mit wenigen Hand- griffen kurzerhand in einen Kosaken-Look verwandelte. »Ich hoffe«, sagte er mit seiner leisen, fast brüchigen Stimme, »dass du morgen die Show für mich laufen wirst.« Statt ein »Yes, Ja, Oui« rauszubrüllen, nickte ich artig. »Ich zähle auf dich. Ich mache dir extra Kleider.« Ein Händeschütteln, und weg war sie, die Modelegende. Wieder in der Agentur, umarmte mich Isabelle. Auf ein großes Blatt Papier - in der Branche »Chart« genannt -, auf das alle Jobs eingetragen werden, schrieb sie vor meinen Augen: »Yves Saint Laurent, confirmed«, Buchung bestätigt. Dann wurde ich - der angeblich soeben aus New York angeflo- gene schwarze Topshot - von den Bossen der Agentur empfangen: vom charismatischen Rebellen John Casablancas und dem Genius Gerald Marie. Marie, der als Tänzer begonnen hatte, war damals
- 5 1
- noch jung und amüsant, wie ein Kind in einem Süßwarenladen, vol- ler Ehrfurcht, weil er mit den schönsten Mädchen der Welt anban- deln konnte. Das Wichtigste an diesem Tag: Ich bekam 500 Francs Vorschuss, in bar, von der Buchhalterin, die so aussah wie die Buchhalterin, die mir für die Ferienjobs bei der Dätwyler AG in Altdorf mein kar- ges Honorar ausgezahlt hatte. Am nächsten Morgen, acht Uhr, auf die Sekunde pünktlich stand ich da. Für Yves Saint Laurent. Das Gebäude war abgesperrt, Sicher- heitsleute überprüften mich, ließen mich rein, zum größten Laufsteg, den ich je gesehen hatte. Es herrschte ein unvorstellbares Gewusel. Ein hypernervöser Saint Laurent, Assistenten, Make-up-Artisten, Hair-Stylisten, ältere Damen, ohne die nichts geht: die Schneiderin- nen. Und dazu die schönsten Frauen und Männer der Welt. Die langbeinige Texanerin Jerry Hall, spätere Ehefrau von Rol- ling Stone Mick Jagger - und Marion, das männliche Supermodel, ein Prachtskerl, mit einem Gesicht, als wäre es gemeißelt: »Mensch, Urs! Welcome to Paris!« Ingo, ein Deutscher, sah mich an, und meinte dann, mit Seitenblick auf Marion, spöttisch: »Urs, schön, dass du da bist. Dann hat die Diva hier endlich mal Konkurrenz.« Tatsächlich traf ich hier alle die berühmten Models, die ich vor- her nur aus der »Vogue« oder von Plakatwänden her kannte. Ein eleganter Herr im Anzug strich mir durch die Haare und sagte zu einem Hair-Stylisten: »Kann man so lassen.« Dann ging es los. Tosender Applaus, als die Mädchen vom Lauf- steg zurückkehrten. Jetzt war ich dran. Ja, ich will, will, will den Applaus! Ich war in Paris, lief für das Modegenie. Und das bei einer Show, die Modegeschichte schrieb: Yves Saint Laurent und seine Russian-Collection. Auf der anschließenden Party begegnete ich Catherine Deneuve, dem Picasso-Clan und Andy Warhol. Der lud mich, den schönen schwarzen Urs, und den eleganten Zürcher Kunsthändler Thomas Ammann zur Dinner-Party in seine Pariser Wohnung ein. Thomas Ammann, der bis heute unerreichte, kometenhaft auf-
- 5 2
- gestiegene Schweizer Kunsthändler und Sammler, der 1993 viel zu früh versterben sollte, setzte 1977 Warhol mit einem Katalog sämtlicher bis dahin geschaffener Warhol-Werke ein Denkmal. In seiner Zürcher Galerie, Thomas Ammann Fine Art, gingen die Reichsten der Reichen ein und aus: Fiat-Chef Gianni Agnelli, Kosmetikzar Ronald Lauder, Reeder-Tycoon Stavros Niarchos und Kunst- beziehungsweise Stahlmilliardär Hans Heinrich Thyssen- Bornemisza. Irgendwann an diesem Abend reichte mir irgendwer eine ele- gante Silberplatte. Auf der war ein Häufchen weißes Pulver. Ahn- lich dem Backpulver, das Mama früher mit frischer Milch vom Nachbarhof verrührte. Was sollte ich damit? Ich warf Thomas einen hilfesuchenden Blick zu: Was ist das? Was muss ich damit machen? Wie muss ich das nehmen? Löffeln? Aber warum dann das Röhrchen? Thomas, ein Herr mit absolutem Geschmack, raunte mir zu, wie sich dieses Glückspulver genießen lässt, wie man sich den von Sigmund Freud hochgelobten »Schnee« via Röhrchen in die Na- senlöcher snifft. Ich war dermaßen ungeschickt, dass mir ein Teil des weißen Pul- vers vom Silbertablett rutschte und sich als feine Staubwolke über den Boden zu meinen Füßen ergoss. Sofort sanken einige der be- rühmten Damen und Herren vor mir theatralisch auf die Knie und machten eine Show daraus, möglichst viel von dem auf dem Boden verstreuten schneeweißen Puder zu ergattern, indem sie es aufleck- ten oder in die Nase zogen. Und wie wirkte das Kokain bei mir? Lang, breit, ausgiebig erklärte ich Thomas: »Also, bei mir wirkt das Zeug überhaupt nicht!« Thomas sah mich nur an: »Okay! Dafür redest du, der sonst den Mund nicht aufbringt, wie ein Wasserfall.«
- 5 3
- Schwarz, 21, ein Star oder Aus dem Terminkalender eines Topmodels
- Einige Monate des Jahres 1978 im Schnelldurchgang, zwischen Europa, Amerika und Asien, Heimweh nach Bergen und Mama. Wieso ich die Daten so genau weiß? Meine in dunkelbraunes Leder gefasste Agenda lügt nicht. 1. Januar. SR-Flug 559 von Zürich nach München. Shooting für die neue Kampagne von Mustang. Fotograf: Michael Doster. Auftraggeber: Topwerbeagentur Beckmann. 4. Januar. Air France 731 von München nach Paris. 5. bis 9. Januar. New York. Shooting für den Departmentstore A&S. 13. Januar. Shooting für Kings. 20. Januar. Fitting bei Calvin Klein. 24. Januar. Proben für die Calvin-Klein-Show. Vier Stunden. 600 Dollar. 25. Januar. Fotoaufnahmen für Van Heusen. 26. Januar. Calvin-Klein-Show. 28. Januar. Shootings für den Modebuchautor Jack Hicks, der in neuartiger Form den Amerikanern zeigen will, was Mode ist. 30. Januar. Fotoaufnahmen mit Klaus Egger. Kunde: die große Kosmetikmarke Avon. 31. Januar. Der bekannte Zürcher Werber Max Wiener lädt mich ins Majestic Theater am Broadway ein. Live-Auftritt von Liza Minnelli. Anschließend Dinner im legendären »Sardi's«. Am Tisch
- 5 4
- hinter uns: Liza Minnelli und Halston, der weltberühmte Mode- designer. Er entwarf den Hut, den Jackie Kennedy zur Inaugura- tion ihres Mannes John F. als Präsident der Vereinigten Staaten trug. Halston erkennt mich. Wir werden an Lizas Tisch gebeten. Der pfiffige Max sagt: »Urs! Du musst Liza einfach sagen, dass du Schweizer bist! Das zahlt sich aus!« Recht hatte der alte Fuchs: Als ich es Liza ins Ohr raunte, lachte sie auf. Liza und ich sollten uns von Stund an noch häufig treffen. Zum Dank lade ich Max ins »Studio 54« ein. Er hatte bisher ver- geblich um Einlass gebeten. Kein Problem. Marc Benecke, der Tür- steher, sieht mich, lässt uns rein, nicht aber einen blonden Schrank von Mann. »Du, die lassen Curd Jürgens nicht rein«, sagt Max leise zu mir. Also flüstere ich kurz mit Marc - schon sind Max, Curd Jürgens und ich im »Studio 54«. 2. Februar. Fitting bei Bill Blass für Aufnahmen zu einer Anzeige. Zweieinhalb Stunden. 4. Februar. Bill-Blass-Show für Privatkunden im Bonwit-Teller- Store. 5. und 6. Februar. Schneesturm in New York. Alles abgesagt. Nichts funktioniert. Nur ich bin glücklich: endlich Schnee, echter Schnee! Mit meiner Kamera laufe ich durch die verschneiten Stra- ßen und fotografiere: den Mann in Anzug und Krawatte, der auf Langlaufski sein Büro zu erreichen versucht, die Damen, die auf Bleistiftabsätzen die Fifth Avenue hinunterrutschen. 9. Februar. Fotoaufnahmen mit Pipin. 21. Februar. Ich laufe für Stardesigner John Anthony im Rain- bow Room des Rockefeiler Center. 22. Februar. Ich lande in Zürich mit Swissair 101 von New York. Fahre mit dem Zug nach Altdorf. Mama besuchen. 24. Februar. Fliege von Zürich nach Paris, dann weiter nach Istanbul. Große Show für Vakko, das größte Modehaus der Tür- kei. Wohne in einer Suite im »Hilton«, wache auf und sehe den Bosporus. Werde von Zeitungen interviewt, als Starmodel. 25. Februar. Mein Geburtstag. Hauptprobe für die Vakko-Show,
- 5 5
- am Abend Dinner mit Vakko-Kunden in einem Nobelrestaurant. Eine Geburtstags-Uberraschungsparty für mich, mit feinster Kü- che und sensationellen Bauchtänzerinnen. 26. Februar. Täglich zwei Shows. Sonst frei. Genieße Bäder im Hamam, Ausflüge in die Stadt und den Bazar. 3. März. Flug nach Ankara. Grandhotel Ankara. Täglich zwei Shows. 5. März. Flug nach Izmir, zur »Perle der Agäis«. Shows. Hotel, Bazar, Blumen, Feigen, nach Ephesus, zu Kunst und noch mehr Kultur. 7. März. Technische Probleme des Flugzeugs bei der Rückreise. Also Flug von Izmir nach Izmir. Bin nervös. Muss spätestens am 9. März in New York sein. Flug von Izmir via Istanbul und Rom. Umsteigen nach New York. 8. März. New York. Endlich daheim. Steige aus dem Taxi, Ecke 54. Straße und First Avenue. Ein Möbelwagen vor meiner Tür. Be- laden mit Möbeln, die mir sehr bekannt vorkommen. Meine dama- lige Mitbewohnerin Magda Reyes erklärt: »Darling, ich habe die Miete nicht bezahlt!« 9. März. Fitting für die Modeschau für das Modehaus Bergdorf Goodman. 10. März. Meine Agentur bucht mir ein Hotelzimmer. Abschieds- essen mit Magda. Am Nachbartisch Schweizer. Drei junge Men- schen. Wortführer ein gewisser Jack Aebischer. Unterwegs mit sei- ner Schwester Katharina und seinem Freund Michael. Katharina sagt: »Jack hat mir erst jetzt erzählt, dass er mit einem Mann zusam- men ist. Ich habe nichts dagegen, die beiden sind süß«, erklärt sie, »aber Jacks Freundin in Zürich, mit der er mehrere Jahre zusam- men war, weiß noch nichts von ihrem Glück.« 13. März. Abschiedsparty von Katharina bei ihrem Bruder Jack, an der 112 Central Park South, im 17. Stock des Hotels Navarro. Katharina öffnet, gibt mir eine Handvoll Reis in die Hand: »Für die beiden Verlobten!«, sagt sie. Ihre Art, sich mit Michael, dem Lover ihres Bruders anzufreunden.
- 5 6
- 14. März. Katalogaufnahmen. 20. März. Die Show für Bergdorf Goodman, an der Fifth Avenue, Ecke 57. Straße, wird zur Sensation: Ich laufe als erster Schwarzer für dieses elegante, traditionsreiche Modehaus. 24. März. Jack Aebischer versucht mich zu erreichen. Treffen zum Lunch. Jack ist geknickt, er sei sehr einsam, wolle einfach mit mir reden. 25. März. Mein Agent überzeugt mich, die Prêt-à-porter-Shows in Paris abzusagen. Ich soll mich ganz auf Big Apple konzentrieren. 26. März. Jack Aebischer lädt mich ein, bei ihm zu wohnen, im »Navarro«. 28. März. Lerne »Option« kennen, das knallharte Modelbusi- ness in Amerika! Soll heißen: Models bekommen von Kunden eine Option. Das ist wie an der Börse. Du nimmst eine Option auf eine Aktie und verkaufst sie. Im Modelbusiness nimmst du eine Option auf mehrere Models für einen Job. Erst kurz vor dem Job entschei- det sich der Kunde, mit welchem Model er arbeiten möchte, und bestätigt oder annulliert die Option. Das heißt: Ist das vom Kun- den gebuchte Topmodel nicht frei, erhalten all die eine Chance, die zuvor mittels Option bei Stundenbuchungen getestet worden sind. Bei diesen Stundenbuchungen muss man absolut pünktlich und zuvorkommend sein, richtig angezogen erscheinen und allem und jedem in den Arsch kriechen. Ein wichtiger Gegensatz zum euro- päischen Markt: In Europa akzeptieren die Models keine Stunden- oder Halbtagesbuchungen. Andererseits bedeutet die Umstellung von Diva in Europa zu Nobody in Amerika keinen finanziellen Rückschlag. Wer es in der Neuen Welt schafft, kann dort ein Mehrfaches von dem in Europa verdienen. 12. April. Ich tanze und gewinne einen Wettbewerb. Wo? Lo- gisch, im »Studio 54«, bei einem Benefizabend. Meine Tanzpart- nerin: das schwarze Top-Laufsteg-Mannequin Pat Cleveland. Ein tolles Mädchen, das 99-mal an Modeschauen von »Ebony«, der Modezeitschrift für Farbige, auftrat. Sie wurde von der legendären
- 5 7
- »Vogue«-Chefredakteurin Diana Vreeland zum damals besten Fotografen Irving Penn geschickt. Eileen Ford wollte, dass Pat sich die Nase operieren ließ. Pat schmiss alles hin, ließ sich die Haare raspelkurz schneiden, trampte als Junge durch Ägypten, verliebte sich in Mick Jagger, den sie am Ende mit Jerry Hall bekannt machte. 2. Mai. Bin den ganzen Monat ausgebucht. Werde von Gordon Munro mit einer weißen, sympathischen Frau namens Susan für Ambiance fotografiert. Die quasselt in der Umkleide ständig was von »Jack« - als müsste man den unbedingt kennen. Wer ist dieser Jack? »Das ist ein Berufskollege von mir. Er heißt Jack Nicholson.« Nachfrage: »Dann sind Sie gar kein Model?« Antwort: »Nein, ich bin Schauspielerin, ich bin Susan Sarandon.« Ich stelle mich beim Posing ganz selbstverständlich neben Susan. Aufruhr hinter der Kamera! Unmöglich. Eine weiße Lady und ein schwarzer Kerl, die gemeinsam in die Kamera lächeln? Unverkäuf- lich! Die Redakteurin: Undenkbar, verboten. Susan protestiert laut. Es hilft nichts, wir werden fotografisch getrennt. Sie in der Mitte des Bildes, mein Gesicht am Seitenrand. 10. Mai. Fitting für Daniel Hecbter, einen der ersten Sportswear- Designer. Bin für ihn im Herbst in Paris gelaufen. Freue mich auf seine erste New Yorker Show im Madison Square Garden! 15. Mai. Show für Reveillon. Lasse mir meine Gage in Form von Anzügen zahlen. 20. Mai. Ich laufe und laufe, stehe vor Kameras, für Kataloge, Werbung. Ich bin was Besonderes. Wie Renauld White, das bis auf mich einzige schwarze Männermodel, das es schaffte, beinahe so gut zu verdienen wie die weißen Männer. 5. Juni. Calvin Klein, der neue Star am US-Designerhimmel, bucht mich für seine erste Männerkollektion. Shooting mit Star- fotograf Arthur Elgort. Calvin, ein großartiger Mensch, ist begeistert, wie ich seinen Mantel präsentiere, legt selber Hand an, damit alles sitzt. Er bewun- dert Yves Saint Laurent, will alles von mir wissen. Er will in Ame- rika Mode machen, die auch für die Mittelschicht erschwinglich ist.
- 5 8
- 10. Juni. Dass der große Calvin einen Black gebucht hat, geht in der Szene rum, 12. Juni. Shooting mit Calvin Klein. 13. Juni. Shooting mit Calvin Klein. 16. Juni. Modeaufnahmen in Miami, Florida. 19. Juni. Saks bucht mich. Das Traumhaus für Mode zeigt plötz- lich amerikanische Designer neben Yves Saint Laurent, Givenchy, Pierre Cardin, Dior und mich, den Schwarzen aus der Schweiz. 20. Juni. Fliege von New York nach München. Aufnahmen mit dem großen deutschen Fotografen Werner Janda. Das Ergebnis: eine zwanzig Seiten lange Modestrecke für das Magazin »Der Mann« - und eine Lektion fürs Leben: Als meine Augen, zuerst müde, dann plötzlich glänzend, mich verraten, etwas Verbotenes konsumiert zu haben, nimmt mich Werner beiseite: »Urs! Ich will dich! Nicht irgendwelche Hilfsmittel.« 21. Juni. Hotel in München. Eine Mitteilung: »Sofort anru- fen. Daisy, Agentur.« Rufe sofort an. Daisy: »>Ebony< hat dich ge- bucht!« »Ebony«? Die Bibel der schwarzen Männermode, das beste Black-Magazin? Daisy: »Du musst aber am 25. Juni da sein, in Chicago.« 22. Juni. Fliege in die Schweiz, um Mama zu besuchen. Leider nur einen Tag. 25. Juni. Chicago. Im Taxi zur Redaktion von »Ebony«. Ich bin nervös. »Ebony«, der Ritterschlag für den Neger aus Altdorf. Die Dame an der Reception ist kühl. »Hey. Ich bin Urs Althaus, ich bin das Model, ich soll Miss Johnson treffen.« »Aha, okay. Warten Sie!« Auftritt Miss Johnson. Schlagartig wird alles freundlich. Kein Wunder: Diese Miss ist Mitglied des Johnson-Clans, einer der ein- flussreichsten schwarzen Familien Amerikas, Besitzer von »Ebony«. 26. Juni. Anprobe für das »Ebony«-Shooting. Laut Bookerin Daisy geht es um elegante Mode. Nur: Was bekomme ich? Einen hässlichen braunen Anzug aus synthetischem Material, ein hell- blaues H e m d mit Rüschchen, billig-braune Schuhe. Kostüm eines
- 5 9
- Drittklass-Clowns! Genau! Die Aufnahmen sollen in einer schwar- zen Limousine stattfinden. Miss Johnson: »Urs! Worauf wartest du? Ich möchte sehen, wie du darin aussiehst.« »Sorry, Miss Johnson. Ich ... ich ...«, stottere ich. »Ich dachte, das ist doch ein Shooting. Für die Redaktion. Nicht für einen Wer- bekatalog.« »Natürlich«, erwidert sie leichthin, »es geht ums Editorial.« »Aber - in diesen Kleidern? Die sind billig, schäbig. Es ist ein Hohn.« Ihre Antwort haut mich um: »Unsere Zielgruppe sind Schwarze! Mit uns arbeiten eben keine Topdesigner.« Was ist mit Calvin Klein? Dem macht es doch nichts aus, wenn Schwarze seine Kleider kaufen. »Hey, wenn du Calvin überreden kannst, noch so gerne!« Ich rufe Calvin an. Er erklärt sich sofort bereit, alle gewünsch- ten Kleidungsstücke via Federal-Express-Sendung nach Chicago zu schicken. Und versichert: Es sei eine Ehre für ihn, mit »Ebony« zu arbeiten. Doch die Welt ist nur umgekehrt zu begreifen! Die Stylistin von »Ebony« ist begeistert. Nicht der Johnson-Clan! Warum? Ich ahne es. Sage es: »Ihr zeigt und fotografiert doch nur die alten, unmodischen Klamotten von Sears! Frei nach dem Motto: >Seht her, ihr Schwarzen! Das ist der letzte Schrei!<« Calvins Angebot wird abgeschmettert. Ich bin fassungslos! »Ebony«, das Magazin der Schwarzen, behandelt Amerikas schwarze Bevölkerung als zweitklassig, verhökert ihr zweit-, dritt- klassige Mode. Und dafür habe ich meine Mutter sitzen lassen? 30. Juni. Das Kostümfestival in Chicago ist vorbei. Flug AA 32260 bringt mich nach New York zurück. Treffe Freunde, feiere im »Stu- dio 54«. Den ganzen Monat Juli war ich voll ausgebucht. 1. August. Nationalfeiertag. Nicht in Amerika, in der Schweiz. Mama wird am 7. August fünfzig Jahre alt. Hofft Mama, dass ich komme? Mit einem Geschenk?
- 6 0
- Mama hat keine Kette. Keine aus Gold. Keine mit Perlen. Viel- leicht finde ich was bei Tiffany's, dem Nobeljuwelier von New York? Die Perlenkette, die ich toll finde: dunkelgrau, zu teuer. Aber diese Königinnen-Kette: golden und erschwinglich. 6. August. Freitag. Swissair-Flug 111 nach Zürich. 7. August. Samstag. Ich klingle an Mamas Tür in Altdorf. Fest- essen in der gediegenen Hostellerie Sternen in Flüelen. Mein Ge- schenk. Dann müssen Mama und ich am Bahnhof schon wieder Abschied nehmen. Ich muss zurück nach New York. 8. August. Flug Zürich-New York. Ich döse. Erinnere mich an Jack Aebischer, den Schweizer. Jack, der mich erreichen wollte, um mich zu sehen. 10. August. Ich rufe Jack an. Wir treffen uns zum Lunch. Er sieht noch trauriger aus. Fragt nach meinem Hotel, »Na. Ein einfaches eben, nicht so toll wie dein >Navarro<.« »Urs, warum ziehst du nicht bei mir ein?« »Und dein Lover Michael?« Jack: »Keine Sorgen. Er mag dich. Außerdem bist du viel unter- wegs. Da kannst du, bist du was Besseres findest, ohne Probleme bei mir wohnen.« Als ich zwei Tage später in meinem Hotel eine Kakerlake im Badezimmer entdecke, rufe ich Jack an: »Ich komme! Zu dir ins >Navarro<.«
- 6 1
- Pavarotti, Beckenbauer, Nurejew oder Meint' Nachbarn in New York City
- Das muss sein: Eine kleine O d e an meine New Yorker Adresse, das Hotel Navarro an der 112 Central Park South, zwischen der Ave- nue of the Americas und der Seventh Avenue. Ein Relikt aus den wilden Zwanziger- und Dreißigerjahren, als das »Navarro« bekannt war für hohe Spieleinsätze und illegalen Alkoholausschank. Später als Herberge für skurrile Gäste wie Jimi Hendrix oder The Doors. Nun darf man sich das »Navarro« nicht als Hotel im üblichen Sinne vorstellen. Es war ein Haus voller Apartments, 2.5 Stock- werke hoch, 1927 erbaut und sofort der Inbegriff von Luxus in Manhattan. Auf unserem Stockwerk gab es drei Suiten. Eine bewohnten mein Freund Jack und ich. Bevor wir sie mieteten, hatte Leonard Bern- stein darin gewohnt, der Dirigent und Komponist von »West Side Story«, ein in New York bis heute verehrtes Genie, das Männer und Frauen liebte und am Ende seines Lebens mit seinem Klassik-Feind Herbert von Karajan eine gemeinsame Abschiedstournee plante, die nur daran scheiterte: Wer dirigiert das erste Konzert? Wer das letzte? In der zweiten Suite wohnten Alison Robertson und Francis Murphy. Ich lernte sie kennen, als Jack eine Party gab. Wir lach- ten, tranken Champagner, unterhielten uns - und hörten laut Mu- sik. Da klingelte es an der Tür. Ich öffnete. Auf dem Flur stand eine
- 6 2
- wunderschöne junge Frau mit blondem Haar, die mich freundlich bat, etwas ruhiger zu sein. Ich ging nicht darauf ein. Und wies ihr frech die Tür. Minuten später klingelte es wieder. Diesmal stand ein kleiner, dün- ner, junger Mann mit langen roten Haaren im Flur und erkundigte sich: »Warum haben Sie meine Frau derart frech abgewiesen?« Kurzerhand lud ich beide ein mitzufeiern. So wurden wir Freunde. Alison stammte aus einer reichen texanischen Erdöldynastie, stu- dierte Schauspiel, wurde mit der Limousine zur Schule gefahren. Sie ließ den Wagen immer einige Blocks vor der Schule halten, damit die anderen Studenten nicht merkten, wie reich sie war. Ihren Nerz färbte sie rot, damit man nicht gleich sah, dass er echt war. Als Alison mich später, in ihrem rotem Nerz, ins »Studio 54« begleitete, stürzte Modeschöpfer Ralph Lauren entsetzt auf uns zu. »Was um Himmels willen haben Sie mit meinem Pelz gemacht?« Alison kühl: »Ich habe ihn gekauft.« Die dritte Suite auf unserer Etage hatte keinen ständigen Bewoh- ner. Allerdings wohnte ein Stammgast des »Navarro«, sofern er in New York weilte, in dieser Suite. Auch ihn lernte ich durch einen amüsanten Zufall kennen. Das war im Morgengrauen. Nach einem langen Besuch im »Stu- dio 54«. Todmüde, wollte ich nur eins: schlafen! Wurde aber von Stimmübungen geweckt. Da übte einer mit lautem Organ Tonlei- tern. Wieder und wieder die gleichen Dreiklänge, dieselben Ton- leitern in chromatischer Folge. Jedes Mal mit ein bisschen mehr Tonumfang, jedes Mal mit mehr Tragkraft in der Stimme. Entnervend! Ich war sauer. Stocksauer. Zumal mein junger Hund, der wunderbare Xtazy, sich jetzt auch aufgerufen fühlte, den Gesang mit eigenem Grummein, Jaulen und Kläffen zu begleiten. Die Stimme verstummte. Schwere Schritte näherten sich unse- rer Suiten-Tür. Ein dicker Mann in weitem Bademantel stand auf dem Flur und beschwerte sich: »Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen! Ihr H u n d bellt! Und das ständig!«
- 6 3
- Übermüdet konterte ich gereizt: »Auch ich kann nicht schlafen, weil Sie nachts versuchen, das hohe C zu treffen!« Die Reaktion des dicken Herrn erstaunte mich. Er ließ ein dröh- nendes Lachen aus seinem dicken Bauch entweichen. »Wissen Sie eigentlich, wer ich bin?«, fragte er. »Nein. Will ich auch gar nicht!« »Normalerweise beschweren sich die Leute nicht über meinen Gesang«, meinte er, immer noch lachend. »Mein Name ist Pavarotti, Luciano Pavarotti.« Selbst der Lift im »Navarro« war ein Ort unglaublicher Begeg- nungen. Dort traf ich Franz Beckenbauer, ebenfalls ein Bewohner des Hauses. Franz spielte damals bei Cosmos New York. Wir plau- derten über Fußball. Ich erzählte ihm von meiner Zeit bei der Reserve des FC Zürich. Prompt lud er mich zu einem Probetrai- ning bei Cosmos ein. Beckenbauer: »Keine Angst! Sie sind ja noch so jung - keine Sor- gen. Hier spielen ja viele Exstars, die weit über dreißig sind.« Er lächelte, fügte hinzu: »Okay. Ist nicht ganz das europäische Ni- veau.« Ich grinste. »Nicht ganz ...« Beckenbauer: »Herr Althaus. Ich werde mich beim Probetrai- ning persönlich um Sie kümmern! Und Ihnen sagen, ob Sie es draufhaben oder nicht. Wir spielen einfach mal zusammen. Ganz einfach.« Nein. Dazu fehlte mir dann doch der Mut. Egal. Bei der nächs- ten Liftfahrt lud mich Beckenbauer ein, mir wenigstens mit ihm und seiner damaligen Freundin Spiele der europäischen Ligen im Fernsehen anzusehen. Jeweils samstags bei ihm. »Kommen Sie doch, wenn Sie Lust haben.« Das »Navarro« war unglaublich. Wie ich den Mut fand, Cock- tailpartys für Kunden und Freunde zu geben - und Beckenbauer, Pavarotti und Ballett-König Rudolf Nurejew einzuladen, die auch tatsächlich kamen! Auch Andy Warhol war da und der Modefoto- graf Francesco Scavullo.
- 6 4
- Ich bewegte mich in einem illustren Kreis von Berühmtheiten, in dem gegenseitige Einladungen und gegenseitiges Vorstellen von ein- flussreichen, berühmten oder einfach unterhaltsamen Freunden an der Tagesordnung waren. Auf diese Art wurde der Bekanntschafts- kreis aller stetig größer, man schuf wertvolle Kontakte. Nicht nur die Bewohner des »Navarro« pflegten diese Tradition der Einladungen. So verhalf mir etwa meine gute Freundin Charlotte Chandler zu vie- len interessanten Begegnungen. Charlotte kannte von Berufs wegen viele Persönlichkeiten: Sie schrieb Biografien über Groucho Marx, Federico Fellini, Billy Wilder, Bette Davis, Joan Crawford und Alfred Hitchcock. Sie lud mich an eine Filmpremiere ins Lincoln Center ein, an der ich den deutschen Regisseur Rainer Werner Fassbinder und die Schau- spielerin Hanna Schygulla kennen lernen durfte. Außerdem be- gegnete ich dort der großartigen italienischen Regisseurin Lina Wertmüller. Als Markenzeichen trug sie eine weiße Brille. Sie sagte mir auf die Nase zu: »Sie sind ein Schauspieler!« Ich: »Nein, Model.« Sie: »Doch, Sie sind Schauspieler!« Lina sollte ich später in Rom wiedersehen. Manchmal wusste ich bei all diesen Einladungen nicht mehr, wie es eigentlich dazu gekommen war, dass ich plötzlich im VIP- Bereich saß. So landeten Jack und ich bei der Gala zur Wieder- eröffnung der Radio Music City Hall unverhofft in der Loge der Familie Rockefeiler. Es war übrigens eine tolle Vorstellung mit der legendären Tanz- company The Rockettes. Zum Abschluss sang Liza Minnelli »New York, New York«, mit der für alle im Showbusiness gültigen Devise: Wenn du es hier, in New York schaffst, schaffst du es über- all. Doch es war einmal mehr im Lift des »Navarro«, wo ich meine spektakulärste Begegnung hatte. Ich fuhr nach unten, als ein Mann einstieg. Mir verschlug es die Sprache. Nicht, weil er schwarz war, was man im »Navarro« nicht oft sah, sondern - weil es Pelé war, der brasilianische Fußballgott, mein größtes Idol! Der von 1974 bis
- 6 5
- 1977 ebenfalls bei Cosmos New York gespielt hatte und jetzt sei- nen alten Freund Beckenbauer besuchte. Natürlich stellte ich mich sofort vor - und wir plauderten, unten angekommen, in der Lobby weiter. Ich erzählte ihm die Geschichte unserer ersten Begegnung, Jahre zuvor. Als Pelé in Zürich spielte und ich in seine Kabine durfte, weil die Sicherheitsleute dachten: Das ist ein kleiner Brasilianer. Doch konnte ich kein Portugiesisch, und dann wollte man mich schnell aus der Kabine schmeißen. Da stammelte ich: »Pelé... Pelé...« Und der Zauberer am Ball kam - obwohl er gerade duschen wollte - lachend auf mich zu, streichelte mir über den Kopf und gab mir ein Autogramm. Diese Geschichte erzählte ich nun meinem Idol aus Kindertagen. Und fügte gleich noch an, dass diese Autogrammgeschichte nicht meine einzige Begegnung mit ihm gewesen war. Als ganz kleinen Buben nahmen mich Großvater und Mama ins Restaurant des Flughafens Zürich mit. Und ich bekam etwas zu trinken. Als Groß- vater die Rechnung zahlen wollte, wurde abgewinkt: »Schon be- zahlt!« Pelé war mit seiner Frau in genau jenem Restaurant - ich glaube, sie waren auf Hochzeitsreise - und hatte beim Verlassen des Restaurants die Getränke aller Anwesenden bezahlt. Ohne, dass jemand es merkte, sehr elegant. Aber erst bei der dritten Begegnung, hier im »Navarro«, konnte ich zum ersten Mal mit ihm sprechen. Nie werde ich sein Gesicht, die Kraft und Herzlichkeit, die er ausstrahlte, vergessen. Und sei- nen Charme, als er sich entschuldigte, dass er sich nicht an mich erinnern könne.
- 6 6
- Liebe, Jack, die Pille oder Wie ich zum ersten Mal auf den Hund kam
- »Nimmst du mit mir eine Ecstasy-Pille?« »Jack! Was zum Teufel ist das?« Es war ein Freitag im August jenes ereignisreichen Jahres 1978. Ich saß mit meinem neuen Freund Jack Aebischer im Wohn- zimmer unseres Hauses mit Swimmingpool in den Pines auf Fire Island, wo wir die freien Tage verbrachten, direkt am Strand. »Keine Angst! Die Pille wurde von einem Professor der Univer- sität Berkeley entwickelt, für die Psychologieforschung - um die Seele der Patienten zu öffnen.« »Und? Wie wirkt die?« »Du wirst high davon, aber nicht wie bei Cola. Es stimuliert die Sinne, öffnet dich ...« »... und ich verliere die Kontrolle über mich...« »... nein. Das ist ja das Verrückte daran. Du kannst runterkom- men oder high sein - ganz wie du willst. Auf und ab.« Na, das hörte sich ja interessant an. »Eines musst du aber wissen!« »Was? Ist es doch nicht so harmlos?« »Keine Angst. Man sollte Ecstasy nicht alleine nehmen. Denn es öffnet die Sinne dermaßen, dass jede Streicheleinheit zu einem Er- lebnis wird.« Erlebnis? Mit Jack hatte ich schon einige Erlebnisse gehabt. Ich war bei ihm im »Navarro« eingezogen. Wir wurden ein Paar. Jetzt
- 6 7
- saßen wir im Wohnzimmer auf Fire Island, in einem Haus, das Jack und ich teilten; wo ich einmal mehr meine Grenzen auslotete, dies- mal mit dieser Pille namens Ecstasy. »Vertrau mir, Urs.« Jack sah mich an. »Die Pille kann nicht schädlich sein. Ein Freund hat sie direkt vom Professor. Ich würde doch sonst nie so etwas n e h m e n . . . « Dann wurde Jack philosophisch, er kannte meine esoterische Grundeinstellung: »Urs! Nach meiner Erfahrung ermöglicht Ecs- tasy dir, endlich das zu werden, was du eigentlich schon bist. Dich richtig zu sehen, zu begreifen, was du kannst und willst.« Ich zweifelte. Jack insistierte: »Freunde von mir haben durch diese Pille entdeckt, dass sie heiraten müssen, und sind seither glücklich vereint.« Was Jack da auf Fire Island, der Insel südlich von Long Island, dem St-Tropez vor den Toren New Yorks, sagte, klang wie das moderne Orakel von Delphi. Und, was war schon so eine kleine Tablette gegen diese Dünen, den Sand und das Meer, dieses Haus, diesen menschenleeren Strand, mit Nachbarn wie den Modedesignern Calvin Klein, Donna Karan und Diane von Fürstenberg sowie Mode-Tycoon Liz Claiborn? Ohne Drogen war es schön. Mit Drogen wunderschön. Und schon erwischte mich die Wirkung. Menschen verschwan- den zu Umrissen. Liefen uns am Strand entgegen, weg, zurück. Seele und Meer wurden eins. Ich verließ die Natur. Ich konnte zoo- men wie mit einer Digitalkamera - dabei gab es die damals noch gar nicht. Ich verschmolz mit Jack. Er nahm mich in den Arm. Das Normalste auf der Welt. Dann unerwartete Zärtlichkeit am Strand. Eine Umarmung. Ein Lecken an meiner Wange. Ich erwiderte die Umarmung. Es war nicht Jack. Es war ein Hund. Erstmals in meinem Leben hatte ich keine Angst vor einem Hund. »Jack, Jack!«, sagte ich aus heiterem Himmel. »Ich wünsche mir einen Hund.« Was so eine Pille verändern kann! Nur eine Stunde nach ihrem
- 6 8
- Konsum hatte ich bereits so etwas wie den Wunsch nach einer Familie geäußert. Nur: Einen H u n d kauft man nicht wie eine Pille. Zumal ich ge- nau so einen wollte wie den vom Strand: einen französischen Bri- ard. Sehr gefragt, schwierig zu bekommen. Die Züchter führten lange Wartelisten. Durch Glück kam ich aber schon Tage später zu einem herzigen Briard-Welpen, dem unvergesslichen Xtazy. Wieder in unserem Haus, entschieden wir uns für eine zweite Pille. Danach hatten wir Sex. Tollen Sex. Jack hatte nicht zu viel ver- sprochen. Jede Berührung war ein Ereignis. Gigantisch, was man da erleben konnte. Da fiel es auch viel leichter, sich eine gemeinsame Zukunft vor- zustellen: »Hör mal Urs, ich wollte schon lange was mit dir bespre- chen.« Jack räusperte sich. »Ich finde, du solltest eine Firma gründen und Kapital schlagen aus deinem Erfolg. Du bist so begehrt in New York, alle lieben dich!« An Aufträgen mangelte es nicht. Ich hatte damals für den Rest des Jahres Shootings für A&S, Saks und andere Werbekampagnen sowie Agenturaufnahmen mit bekannten Fotografen, ich traf mich mit den Supermodeis Jasmin, Alexandra King und Donna Palmer, hatte Meetings mit Calvin Klein, der Werbeagentur Walter Thomp- son, Aufnahmen mit John Peden, lief in Paris, hatte einen übervol- len Terminkalender. Jack wusste das und kam gerade deshalb auf die Idee, ich solle doch eine eigene Agentur gründen. Ich lachte. »Jack, mach langsam. Ich bin gerade erst als Model angekom- men. Ich habe gar nicht genug Geld, um eine Firma aufzubauen.« Seine großen, schönen Augen lächelten liebevoll. »Dafür bin ja ich da. Schließlich bin ich der Banker. Du solltest deine eigene Agentur haben, und ich weiß auch, wer uns das finan- zieren wird.«
- 6 9
- Mein Magen zog sich zusammen, kurz, aber heftig. »Urs. Komm. Wir können das hier und heute ausdiskutieren. Die Pille hilft dir, die für dich richtige Entscheidung zu treffen. Stell dir doch nur mal vor: Du hast schon Wahnsinniges erreicht! Du bist der erste schwarze Mann auf dem Titel von >GQ<. Wenn du, genau du, jetzt eine eigene Agentur gründen würdest, würde das einschla- gen wie eine Bombe!«
- Aus Ecstasy wird Xtazy oder New York im Modelwahn
- Am 1. September 1978 gründeten Jack und ich die Xtazy Ltd. Nicht irgendeine Firma, nein, »The World's First International Modeling Ensemble«. Auch nicht irgendwo, sondern in New York City, wo der Name Programm war. Die Idee war denkbar einfach. Nicht der Einzelne, der Egoist, sondern das Team, die Gruppe ist die Attraktion. Statt eine Dres- sur des Fleisches, des Models, wollten wir die Leichtigkeit des Seins, weg vom Ich, hin zum Wir. Statt einer geschlossenen Agenturge- sellschaft mit der Ich-Jagd egozentrischer Models versuchten wir den Gegenentwurf: das Ich hinter dem Wir verschwinden zu las- sen, statt einer Ich-Erlösung die Selbsterlösung durch die Gruppe. Das klang wahnsinnig gut. Es war auch wahnsinnig gut gemeint. Nur eben: In unserer esoterischen Euphorie verloren wir die Rea- lität der kapitalistisch-westlichen Welt aus den Augen. Und die setzte nicht auf eine rauschende Kultur aus liebevoll miteinander umgehenden Mitmenschen, sondern auf das absolute Gegenteil:
- 7 0
- eine Welt voller Egomanen. Mit dem Motto: Du als Einzelner trans- portierst eine Botschaft, nicht die Gruppe. Heute weiß ich: Wir waren zu blauäugig. Nicht nur ich, auch mein Freund Jack. Ach, hätte ich doch nur auf den Rat des großen Johns, des John Casablancas, wenigstens in einem Punkt gehört: Er hatte uns ange- boten, sich an seiner Agentur Elite zu beteiligen. Da Elite Investo- ren suchte. Hätte ich das doch nur gemacht! John Casablancas, mein Freund und mein Agent. Er glaubte nicht an das Model-Ensemble. Nie werde ich vergessen, wie wir in seinem Büro hoch über New York saßen und er mir in die Augen schaute. »Urs! Du kennst doch das Modebusiness. Eure Idee mit dem Model-Ensemble kann nicht funktionieren!« Nach einer kurzen Pause: »Du musst Jack davon überzeugen: Es ist keine gute Idee!« Ich hörte nicht auf ihn. Ein Riesenfehler. Was solls: Es war ja nicht der einzige, den ich damals machte. Zumal etwas den Blick für die Realität beträchtlich trübte: Ecstasy, die Droge, die bei unserem Ensemble-Namen Pate stand. Die Pille war zunächst nur an ausgewählten Orten erhältlich, wie dem »Studio 54«, wo sie zum Partyhäppchen der Reichen, Schö- nen und Berühmten wurde. Wer bei dem Namen nicht an Drogen dachte, dachte zumindest an Porno. Also kam Jack auf die Idee, die Schreibweise zu ändern. Der Presse erklärte er: »Wir suchten einfach einen Namen, der von Menschen mit verschiedensten Sprachen verstanden wird.« Ich hatte in meinem Leben schon viele Ideen geboren. Und dabei jeweils schnell festgestellt: Ohne Geld geht nix! Also mussten wir einen Financier finden, der unsere grandiose Idee mit Geld unter- fütterte. Jack fand einen Investor: den Schweizer Reto Gärtner, der Jack viel Geld zu verdanken hatte; Jack hatte es in Börsengeschäften mit Kaffee. Sojabohnen, Gold und Silber vermehrt. Das war ja Jacks
- 7 1
- Spezialgebiet: Er arbeitete im Nervenzentrum des Geldes, an der New Yorker Wallstreet. Reto Gärtner hatte in der Schweiz eine Import-Export-Firma, mittels deren er für die brasilianische Staats- agentur einen enormen Handel mit ebenjenen Naturprodukten betrieb. Jack und Reto kannten sich also bestens vom Monopoly um Futures. Beide sprachen über Geld und Summen in einer Art, dass es mir, dem unehelich geborenen schwarzen Buben aus Altdorf, die Sprache verschlug. Reto roch Geld und investierte sofort 600 000 Dollar in unser Model-Ensemble-Projekt. Er wurde Vorstandsmitglied. Jetzt konnten wir durchstarten! Und das machten wir. Und wie! Für Xtazy war nur Kaviar gut genug, sprich: die schönsten Models, der beste Art-Director. Unser Angebot war verlockend für alle Models: ein Vertrag über 60000 Dollar für die Dauer von einem Jahr, also ein garantiertes Monatseinkommen von 5000 Dollar pro Monat. Ohne dass sie sich selbst um Aufträge, Kunden, Arbeit kümmern mussten! Und sie kamen in Scharen. Von der schwarzen Prinzessin bis zum exzentrischen Töchterchen eines US-Senators, das sich schnell den Nachnamen »Ich-mache-euch-garantiert-Arger« erarbeitete. Klar, dass auch nur die besten PR-Leute des Landes für uns in Frage kamen. Das waren Gifford & Wallace, die so unterschied- liche Sachen wie den Friedensmarsch nach Washington, das Musi- cal »Hair«, die Radio City Music Hall und das »Studio 54« medial gemanagt hatten. Michael und Ed Gifford - Michael war übrigens eine Frau - hat- ten für das »Studio 54« eine simple Formel erfunden: »Das Kon- zept ist wie ein Gemälde, das zu neunzig Prozent fertiggestellt ist. Dem Einlasser fällt somit die Aufgabe zu, es jeden Abend aufs Neue zu vervollständigen: Er muss gezielt die richtigen Leute einlassen.« Als ich Michael Gifford zum Lunch im »21 Club« am besten Tisch neben Roy Cohn traf, erzählte sie gerade eine Geschichte: Wie sie gestern fernsah, CBS, ein Interview mit Calvin Klein. In-
- 7 2
- teressanter als Klein sei das schwarze Model gewesen, das Calvins neue Kollektion präsentiert und sich einfach auf den Boden gesetzt habe, als es ihm beim Interview zu langweilig geworden sei. Michael fand, dass diese ungezwungene lässige Art ein Trend sein könne, um Mode neu zu zeigen. Michael erkannte mich nicht. Ich war das Model, das sie gesehen hatte. Nun fehlte für unser Xtazy-Model-Ensemble ein Art-Director. Wir wollten Joe Eula, weltberühmt durch die Illustrationen für »Vogue«, Valentino, Halston. Für Liza Minnelli schuf er das »Liza« mit dem großen »Z«, er machte Plattencovers für Miles Davis, Bette Midier, The Supremes, entwarf Mode für Jerome Robbins und George Balanchine, war Creative Director von Halston - schlicht der Beste, den es in New York gab. Er wollte 50000 Dollar Vor- schuss, bar in Zwanzigdollarscheinen! Das Business-Meeting fand bei Eula zu Hause statt, wo er uns - pardon - scheißend auf seiner Toilette empfing. Wir leerten ihm an Ort und Stelle die 2500 Zwanzigdollarscheine über den Kopf. »Okay, Boys«, meinte er, »geht ins Wohnzimmer. Mixt euch ei- nen Drink. Ich unterschreibe den Vertrag.« Unsere Wohnung im Hotel Navarro wurde ein Tollhaus. Kur- zerhand mieteten wir eine weitere Suite. Kam Jack abends von der Arbeit an der Wallstreet nach Hause, stolperte er über Arbeiter, die zusätzliche Telefone installierten. Und dazwischen Models, weiße, schwarze, Männer, Frauen, Mädchen. Alles gemanagt von unserer Sekretärin Roseanne, die Jack von der Wallstreet kannte und die zu Xtazy gewechselt hatte. »Da hat jemand angerufen und behauptet, er sei Rockefeller.« Roseanne grinste. »Ich habe ihm gesagt, ich sei Marilyn Monroe. Aber ihr müsst zurückrufen.« Sie gab Jack die Nummer. Es war Nelson Rockefeller, der ihm ein Angebot für eine Beteiligung machte. Jack lehnte ab. Am 10. Oktober 1978 sollte der Open Call von Xtazy im Mark Hellinger Theatre stattfinden, dem Broadway-Theater in Midtown Manhattan, das 1991 sinnigerweise zur Times Square Church um-
- 7 3
- gebaut wurde. Wir waren entschlossen, die schönsten New Yorker an Bord zu holen. Dank der genialen Giffords hatten wir bereits im Vorfeld unglaublich viel Presse. Sie hatten Anzeigen vorbereiten lassen - mit von Xtazy ausgewählten Models sowie leeren Foto- Feldern, in denen ein Fragezeichen stand. Die Message war simpel, aber effektvoll: Bist du der Nächste, der sich einen 60 000-Dollar- Vertrag holt? Genau an dem Tag, als wir unsere Anzeigen für den Open Call, die Eröffnung, schalten wollten, streikte die New Yorker Presse! Kein Problem für uns; wir ließen zehntausend rote Xtazy-Open- Call-Plakate drucken, die Joe Eula kreiert hatte, und tapezierten in einer Nachtaktion die Innenstadt. Es war ein großartiges Bild und eine der größten Posterkampagnen, die New York City je gesehen hatte. Natürlich sollte Mama an meinem großen Tag dabei sein. Ich hatte ihr ein Zimmer im Hotel Navarro gebucht, mit Aussicht auf den Park. Es war Herbst, der Indian Summer hatte es von Kanada bis nach New York geschafft: Der Park zeigte sich in voller Farben- pracht. Und so kam es, dass meine Mutter, frisch im Hotel ange- kommen, aus ihrem Fenster sah und meinte: »Plier sieht es ja aus wie bei uns daheim in den Bergen!« Die Castingshow wurde ein Riesenerfolg. Die Presse musste draußen bleiben! Wir ließen den Event live auf eine Leinwand in der Theaterlobby übertragen - damals ganz schön modern und ori- ginell. Das Casting war unglaublich. Oder wie die »New York Post« schrieb: »They lined up along, thousands of them.« Den ganzen Tag über präsentierten sich junge und weniger junge Schönheiten, Studentinnen, Schauspieler, Balletttänzer. Alle muss- ten vor Eula und mir den klassischen Theatersatz auf der Bühne sprechen: »Pussycat, Pussycat, where have you been? IVe been to London to visit the Queen.« Und, falls sie uns gefielen, dazu den Satz: »Thirty purple birds sitting 011 a bone, chirping and burping.« Dieser Nonsens wurde uns artig vorgetragen. Sogar Polizisten standen draußen, nicht um für Ruhe und Ordnung zu sorgen, son-
- 7 4
- dem um einen 60 000-Dollar-Vertrag zu bekommen. Rund fünftau- send Menschen warteten in Endlosschlangen vor dem Theater. NBC, CBS, ABC und Chanel 5 berichteten live. Die »New York Post« veröffentlichte ein Bild, das die riesige wartende Menschenmenge zeigte. Die »Soho News« nannte unsere Show »die teuerste Ein-Tages-Audition«. Alle überschlugen sich. Auch mein Jack. Der sagte: »Dieser Tag kostete 35 000 Dollar - aber mit dem budgetierten Umsatz von drei Millionen Dollar im ersten Jahr können wir uns das locker leisten.«
- Xtazy-Höhenflug nach Paris oder Valentino weiß von nichts
- Einer unserer ersten großen Aufträge sollte uns nach Paris führen. Die Xtazy-Model-Ensemble-Karawane, mit fünfzehn Models, PR- Leuten, Anwälten, Sekretärinnen und meinem Briard-Welpen, wurde an Bord eines Air-France-Jumbos verfrachtet. Die Presse begleitete uns zum Kennedy-Airport, schließlich hatte Joe Eula angekündigt: In Paris treten wir in der Valentino- Show auf. Er selbst zeichne als Art-Director verantwortlich für die Modegala. Valentino freue sich unheimlich auf unsere Teilnahme, der Vertrag sei reine Formsache. In Paris holte uns die Presse wieder am Flughafen ab. Unser Tross checkte - immer noch auf Kaviar - ins Palasthotel George V ein. Mit Blick auf die Couture-Geschäfte. Dennoch beklagte sich eines der Models sofort über diese unbequemen französischen Toi- letten. Sie meinte das Bidet. Dann stürmte Joe in den Salon von Star-Figaro Jean Louis David
- 7 5
- und erklärte, der große römische Starcouturier Valentino bestehe darauf: Er wolle uns alle sehen, jetzt sofort! Eula zerrte die Mädchen mit halb geschnittenem, halb nassem oder halb aufgewickeltem Haar aus dem Salon. Niemand wusste, wozu. Ging es um die Parfüm-Werbung? Um die Proben für die Show? Bald stellte sich heraus, dass Valentino gar nichts von uns wusste und auch nicht im Sinn hatte, unser Ensemble zu engagie- ren. Valentinos Geschäftspartner Giammetti wäre bereit gewesen, uns für einen Durchgang zu buchen, wenn ich an der Spitze des Ensembles gelaufen wäre. Doch Jack war dagegen; er befürchtete einen Gesichtsverlust unserer Gesellschaft, wenn ich weiterhin als Model statt als »Executive Vice President« von Xtazy in Erschei- nung träte. Wenigstens hatten wir in Paris zwei Meetings - mit Kenzo und Issey Miyake. Gemeinsam mit The Village People traten wir im Finale eines französischen Discofilmes auf - und machten ein Pres- sespektakel daraus. Mit dem amerikanischen Fotografen Francis Murphy, den wir eigens eingeflogen hatten, der aber - lag es am Schneefall in Paris? - ohne Film in seiner Kamera geknipst hatte. Nach dieser missratenen Paris-Episode feuerten wir Joe Eula und engagierten Laura Weyher, eine New Yorker Gesellschafts- dame, die ein Haus an der Upper East Side besaß, gleich neben Rockefeller. Der Plan war einfach: Mit Lauras Hilfe wollten wir kurzfristig Meetings mit allen großen US-Designern und vor allem Buchun- gen für unser Ensemble organisieren. Auf die Buchungen waren wir angewiesen, um überhaupt Geld zu verdienen. Doch wochenlang tat sich kaum etwas. Aber hatten wir nicht Reto Gärtner, unseren Schweizer Teilha- ber, Vorstandsmitglied von Xtazy Ltd.? Hatte der mir nicht versi- chert, weitere 600 000 Dollar in unser Model-Ensemble zu inves- tieren? Doch das Geld kam und kam nicht. Das Nervenflattern begann. Auf einer Konferenzschaltung erklärte uns Reto, er sei, sorry, sorry,
- 7 6
- auch gerade nicht, flüssig. Aber keine Sorge: Er werde jetzt seine eigene Firma verkaufen und dann noch weit größere Beträge in Xtazy investieren als vertraglich vereinbart. »Ihr dürft unter keinen Umständen Konkurs anmelden«, bet- telte er. »Damit gefährdet ihr den Verkauf meiner eigenen Firma!« Kurzum: Wir feuerten alle unsere Angestellten, verhandelten mit Kreditgebern. Ich vermittelte unsere Models an eine der großen Agenturen. Dann bekam Jack einen Anruf von Retos Chefbuchhalter. Er fragte: »Zu welchen Konditionen hat Xtazy die ersten 600 000 Dol- lar von Reto erhalten?« Seltsame Frage. Reto war doch Teilhaber - und haftete. Nie war die Rede davon gewesen, dass er das Geld zurückerhalten würde. Im Gegenteil: Wir alle hatten gehofft, das Geld zu vermehren. Es kam noch schlimmer: »Wie steht es mit euren Lebensversi- cherungen?« Eine noch verdächtigere Frage! Instinktiv reagierte ich richtig: »Jack! Annulliere alle Versiche- rungen! Sofort!« »Warum?« »Ich habe keine Lust, erschossen zu werden.« Diesmal hörte Jack auf mich. Da Reto derjenige war, der das Geld eingebracht hatte, hatten Jack und ich bei Lloyd's je eine Lebensversicherung abgeschlossen und ihn als Begünstigten ein- getragen. Jetzt, wo Reto Gärtner in finanziellen Schwierigkeiten steckte, war es das Beste, die Versicherung sofort aufzulösen. Ich realisierte, dass mein plötzliches Ableben anderen viel Geld einbringen würde, ahnte aber nicht, dass ich mich im Umfeld eines tödlichen Finanzskandals befand. Also bestand ich darauf, dass eine Fax-Kopie von Lloyd's in Lon- don umgehend an Reto Gärtner und seine Firma geschickt wurde. Zu unserer Sicherheit stellten uns die Giffords ihr Haus in East Hampton zur Verfügung, das Reto nicht kannte. Anfang Dezember flog ich in die Schweiz, um mit Reto Gärtner zu reden. Ausgerechnet ich! Ich hatte von Finanzen nun wirklich
- 7 7
- keine Ahnung. Jack hatte mich Tag und Nacht auf diese Aufgabe hin geschult. Damals verstand ich noch nicht, weshalb Jack nicht selbst in die Schweiz fliegen und die Sache erledigen konnte. In Genf wurde ich mit Zahlen konfrontiert, die ich bisher nicht mal vom Träumen her kannte: Irgendwie fehlten Reto 15 Millionen Dollar. Schlimmer: Es drohte ein Verlust von unvorstellbaren 60 Mil- lionen Dollar. In meiner Hilflosigkeit klingelte ich in New York Jack aus dem Bett. Von dem ich aber nichts als Ausreden hörte, warum er nicht nach Genf kommen könne, um mit Reto zu reden. Schließlich gestand Jack: »Ich kann, darf nicht mehr in meine Heimat, die Schweiz, zurück! Ich habe Angst, verhaftet zu wer- den.« Und geheimnisvoll flüsterte er: »Das hängt mit dem Skandal um die Bank des Vatikans, den Banco Ambrosiano, zusammen. Und mit meiner Schweizer Bank ...« Erst im Lauf der Zeit fand ich heraus, was es damit auf sich hatte. Die Privatbank, bei der Jack in Zürich angestellt gewesen war, hatte mit der Mailänder Privatbank Banco Ambrosiano, auch »Priester- bank« genannt, Geschäfte getätigt. Es führte zu weit, hier den gan- zen Skandal um den Banco Ambrosiano aufzurollen. Nur das: Durch den gewaltsamen Tod seines Präsidenten Roberto Calvi - er war im Juni 1982 an einer Londoner Brücke hängend aufgefunden worden - kam ein unglaubliches Geflecht illegaler Machenschaf- ten ans Licht: Handel mit gefälschten Wertpapieren, Steuerbetrug, Geldwäscherei, Verbindungen zum internationalen Drogenhandel, zur Mafia, zur Geheimloge P2 - und zum Vatikan und dessen Ban- kier, Erzbischof Paul Marcinkus. Schon Jahre zuvor hatte Jacks Privatbank die geschäftlichen Beziehungen zum Banco Ambrosi- ano abgebrochen. Jack kannte Calvi und den ebenfalls involvier- ten Finanzjongleur Michele Sindona. Bevor er von seiner Bank als Sündenbock herhalten musste, war er nach New York gezogen, was ihm wahrscheinlich das Leben gerettet hatte. Hümmel Herrgott! Nichts, kein Wort hatte mir Jack, mein Freund, mein Liebhaber, mein Lebenspartner, vorher davon erzählt!
- 7 8
- Ich fühlte nicht Wut, nicht Trauer - es war eine tiefe Enttäu- schung. Auch über mich und meine Träume, die jetzt ein Scherben- haufen waren. Meine Mutter hatte recht behalten! Mit ihrem Gefühl, ihrem Instinkt für Richtig oder Falsch: »Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt.«
- Offener Brief an meine Mutter oder
- Was ich Mama erst heute schreiben kann
- Liebe Mama In eine/n gewissen Sinn sind wir beide die Opfer der neuen, modernen Zeit geworden. Du, Mama, genauso wie ich. jetzt, wo ich so viel an unsere gemeinsame und getrennte Ver- gangenheit denke, fällt mir auf, wie sehr mir Briefe von Dir fehlen - und Dir Briefe von mir. Es fehlen mir heute die Briefe, die ich an Dich geschrieben habe. Ja, hätte schreiben können. Als Schiller, als Fußballtalent, als Model, als Unternehmer, als Mann-, der sich selbst sucht - und immer irgendwo Schiffbruch erlitten hat. Schade, dass ich Dir nicht geschrieben habe, wie der Sonnenuntergang in New' York ist, den ich so geliebt habe. Das Telefon ist schuld. Das wissen wir heute. Anfangs, als ich ein kleiner Bub in Altdorf war, hatten wir als eine der wenigen Familien kein Telefon. Und? Wir waren glück- lich! Wir mussten uns alles erzählen. Nicht einfach eine Nummer wählen und in ein Gerät reden - ivir haben uns damals gegensei- 7 9
- tig gesucht und besucht. Um uns am großen Tisch alles zu erzäh- len. Um unser Herz auszuschütten. Um zuzuhören. So viele Jahre waren wir zusammen. Und dann waren wir so viele Jahre getrennt, auch wenn ich Dich immer besucht habe und Du mich. Es lag in der Natur der Sache, dass ich um die Welt jettete -für meinen Beruf. Und Du daheimgeblieben bist - als mein Mittel- punkt. Immer bereit, mir zu helfen, wo und wann immer ich auf dieser Welt Deine Hilfe nötig hatte. Das Telefoti ist schnell, praktisch, man hat ständig Kontakt, man spricht, hat das Gefühl, dem anderen nahe zu sein, ihn neben sich zu haben. Aber ich weiß heute auch, dass in dem Augenblick, in dem ich den Hörer aufgelegt habe, neunzig Prozent des Gesprächs schon wieder verschwunden waren, vorbei, vergessen. Wie anders sind da Briefe. Obwohl Du kaum einen Brief von mir, ich kaum einen Brief von Dir habe, sind unsere Gefühle zueinander nicht oberflächlich geworden. Liebe Mama, Du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Deine Meinung zählt, ich bewundere Dich zutiefst. Du hast stets dafür gekämpft, mich als Deine Familie zu versorgen. Du gingst einem von Dir nicht gerade geliebten Beruf nach, um mir ein Heim zu bieten. Und Du hast an einer ganz anderen Front - zu Hause - dafür gekämpft, dass ich meinen Berufungen nachgehen konnte. Du hast Dich für mich eingesetzt, dass ich aus meinen Hobbys einen Beruf machen konnte. Ich weiß: Du hast oft geweint wegen mir. Aber hast mich am Ende immer verstanden, bist mir in meinen schwierigen Momen- ten die beste Freundin gewesen. Und Du hast auch etwas verstanden, was ich Dir erst heute - aus meiner Sicht - sagen kann. Es war damals in New York. Wir beide hatten einen tollen Tag.
- 8 0
- Ich hatte Geld, konnte Dich in einer exklusiven Boutique neu ein- kleiden. Star-Coiffeur Jean-Louis David, der inzwischen auch in New York eröffnet hatte, schnitt Dir die Haare sehr modern. Mama! Du hast umwerfend ausgesehen! Abends gingen wir ins berühmte River Café essen. Das Restau- rant auf einem Floß am East River, das einen märchenhaften Blick auf Brooklyn Bridge, Wallstreet und die damals noch intakten Wo rld- Trade- Türme geboten hat. Du warst begeistert. Allerdings nicht vom Essen, das ich be- stellte. Der Kaviar war Dir zu salzig, den Hummer mochtest Du nicht mal ansehen. Das Texas-Steak schmeckte Dir bestens. Eine Woche warst Du damals in New York. Stolz darauf, Deinen Sohn zu sehen, wie er das mit dem Model-Ensemble Xtazy hin- bekommen hatte. In der Neuen Welt, so viele Kilometer von der Innerschweiz entfernt. Erinnerst Du Dich noch an die Party, die Ben Johnson, einer mei- ner Freunde und schwarz wie ich, für Dich damals schmiss? Als er Dich mit einem schwerreichen Mann verkuppeln wollte, der auch noch sehr gut aussah? Und dann der Abend mit Dir im »Studio 54«. Wir ließen uns mit einer Limousine hinfahren. Im Studio bekiim ich - nur wegen Dir! - das begehrteste Sofa, gleich neben der Tanz- fläche. Habe ich Dir damals erzählt, wie das war? Als ich an der Bar die Getränke bestellte und der große Calvin Klein zu Dir hinsah und zu mir sagte: »Urs, die Dame dort drüben sieht aus wie Du in Weiß.« Du hast Dich amüsiert und mir zugezwinkert: »Ach, das darf ich in Altdorf niemandem erzählen, wo Du mich hier in New York überall hinbringst.« Erinnerst. Du Dich noch, wie Dich die Schweizerin Katharina, die bezaubernde und bodenständige Schwester von Jack, zum Tee ins Hotel Plaza entführte? Ja. Und dann kam das Gespräch, das mir heute so präsent ist, als wäre es erst gestern gewesen.
- 8 1
- Ich hatte Dir bereits von Jack Aebischer erzählt. Dass er mein Geschäftspartner geworden sei. Was ich Dir verschwiegen oder nicht wirklich gestanden habe: dass Jack mein Freund war. Und was für ein Freund - genau das war es, um was ich mich rumgedrückt hatte. Uberhaupt! Erst heute wage ich Dir noch anderes zu sagen, bes- ser: zu schreiben. Da ich weiß, Du wirst es heute verstehen. Ich weiß nicht recht, aber ich glaube heute: Du wirst irgendwie schwul geboren. Was ich damit sagen will: Du, Mama, hast jeden- falls keine Schuld. Wie auch? Schivulsein ist ja keine Krankheit, sondern einfach eine andere Art, sich in dieser Gesellschaft ge- schlechtlich zu definieren. Erinnerst Du Dich, als ich damals nach meiner erster Modeschau in München zurückkam? Verwirrt war ich. Da habe ich nicht nur in dem Nobelhotel Bayerischer Hof zum ersten Mal in meinem Leben asiatische Köstlichkeiten gegessen. Nach dem Essen gi//g es in einen Club, mit der Show »Black & White«. Ja, Mama! Ich war betrunken und verliebte mich in den Star der Show, eine reizende Tänzerin. Auf ihrem Zimmer stellte ich fest, dass sie - oder er - ein Transvestit war. Der Sex mit ihr - oder ihm - war auf jeden Fall grandios. Ich weiß bis heute nicht, ob es diese Art von Sex war oder ob es daran lag, dass ich etwas Verbotenes, Verruchtes, Außerge- wöhnliches tat. Oder ob es am Alkohol lag. Ja. Ich genoss die Freiheit, zu tun, worauf ich Lust hatte. Und habe nur einen Tag später das Herz eines vollbusigen, langhaari- gen Mädchens gebrochen. Die hatte sich in mich verliebt, ich nahm sie in den Arm, wir redeten - na ja, nicht nur - bis in den Morgen, frühstückten gemeinsam. Das Mädchen kam zu all meinen Shoivs, stand eine Woche lang jeden Abend vor dem Hotel und wartete auf mich. Und sie ging mir auf die Nerven. Sie hatte sich mir hingege- ben, sich in mich verliebt - und ich schäme mich noch heute, wie schnöde ich sie behandelt habe. Zu so gemeinem Benehmen hast Du, Mama, mich jedenfalls nicht erzogen!
- 8 2
- Überhaupt begann mein Doppelleben schon in Zürich. Ich ver- suchte mich als Fußballer, auch als Bohemien. Ich liebte sowohl Frauen als auch Männer. Mit Fußball- oder Schulfreunden ver- abredete ich mich in der »Kronenhalle« oder im »Odeon«, zwei schicken Orten im Herzen Zürichs. Da traf ich Irene, eine stadtbekannte, wunderschöne Hure, die sogar einmal in einem Film des großen Fellini mitgespielt hatte. A uf meinem Weg von den Bars nach Hause begegnete ich ihr stän- dig - und wurde von ihr angemacht. Sie war total sexy, aber ich wagte es nicht, stehen zu bleiben und mit ihr zu reden. Was, wenn mich jemand sah und erkannte? Ich war hin- und hergerissen. Schließlich nahm ich eine ihrer Einladungen an. Sie lud mich zu einer Party ein, um mich ihren Freunden vorzustellen. Es wurde ein toller Abend, und mit einigen der Leute, die sie mir vorstellte, bin ich bis heute befreundet. Da traf sich eine illustre Gesellschaft, eine bekannte Modedesig- nerin, ein Kunsthändler, ein erfolgreicher Werbefachmann und einer der berühmtesten Hairstylisten der Stadt. Meine neuen Freunde - egal, ob Männer oder Frauen - machten mich tüchtig an. Anscheinend hatte ich einen internen Wettkampf entfacht: Wer würde mich als Erster in die Horizontale kriegen? Ich weiß, Mama, das hörst Du nicht gerne. Aber es ist die Wahr- heit. Meine neuen Freunde interessierten sich nicht für Fußball, viel mehr für die knackigen Oberschenkel, die auf dem Fußballplatz herumliefen. Ich musste oft lachen, ivenn diese Herren und Damen mir in einem mondänen Restaurant erzählten, es sei ein schlechtes Spiel gewesen, »denn der schnugglige Kerl mit den riesigen Ober- schenkeln hat sich gleich nach dem Einlaufen lange Hosen ange- zogen«. Es waren auch diese neuen Freunde, die mir sagten, wie gut ich doch aussehe und dass ich - nun, nach meinen ersten kleineren Modeschauen - doch unbedingt beruflich modeln sollte. Sie stell- ten mir zwei damals sehr erfolgreiche Models vor, Lou und Viktor, die mich unter ihre Fittiche nahmen. Lou hat mich in große Shows
- 8 3
- in Zürich gebracht. Sie nahm mich einfach mit oder erzählte den Kunden, ich sei der neue Star. Durch Viktor lernte ich Schauspie- ler kennen und wie ich als Fotomodell vor der Kamera zu stehen und mich zu bewegen habe. So meldete ich mich bei der Schauspielschule in Zürich an und durfte vorsprechen. Mit dem Ergebnis: »Herr Althaus! Sie haben leider keine Chance, diesen Beruf zu erlernen. Es gibt fast keine Arbeit für schwarze Schauspieler!« Nicht, dass Du denkst, Mama, ich hätte meine Zeit nur mit Män- nern verbracht. Bei einem Drink im »Odeon« lernte ich eine junge, wunderschöne Frau mit blondem Haar in selbstbewusster Pose kennen: Eveline. Die erste Frau nach Franzi. Wir wurden ein Paar. Sie brachte mir in Sachen Sex viel bei. Hinter Eveline hechelte halb Zürich her. Sie kam wie Franzi aus sehr guter Familie. Später wollte Eveline mit mir sogar ins Tessin ziehen. Nur - da kam uns ein Mann in die Quere. Es begann wieder im »Odeon«, an einem Nachmittag im Herbst, ich saß mit Fußballfreunden zusammen. Uns gegenüber eine Gruppe junger Männer und Frauen. Einer davon sah immer wieder zu mir herüber. Verrückt, aber irgendwie schien mir dieser Manu äußerlich ein Mix aus Franzi und Eveline zu sein. Er war wunderschön und wurde mein erster Freund. Er hieß Urs, wie ich, und ich liebte ihn innig, wie ich zuvor die beiden Frauen in meinem Leben geliebt hatte. Doch die Liebe hielt nicht lange. In der Silvesternacht hatte ich - stockbesoffen - Sex mit einer älteren Dame. Urs erwischte uns. Es war vorbei, ich hatte mich wieder mal unfair benommen. Etwas, was ich von Dir, Mama, ganz sicher nicht gelernt habe! Verstehst Du meine Suche in dieser Welt? Mein verzweifelter Wunsch, irgendwie, irgendioo mit irgendwem mein Glück zu finden. Nie zuvor habe ich mit Dir über meine Männer- oder Frauenge- schichten gesprochen. Das musste nicht sein, Du hast Dir so schon
- 8 4
- Sorgen lim mich gemacht, Deinen über alles geliebten Sohn. Wie sollte ich Dir sagen, dass ich mit Männern ins Bett gehe? Du musstest es aber irgendwann ahnen, zumal Jack und ich in un- serer New Yorker Wohnung nicht zwei Schlafzimmer hatten, nur eines. Natürlich wärst Du nie auf die Idee gekommen, unser Schlafzim- mer zu betreten. Dass ich nachts darin verschwand, konntest Du nicht übersehen. Und so saji ich da. Ich erinnere mich genau: Du mit einer Birne in der Hand. Und plötzlich musste ich alles loswerden, Dir alles sagen, auch Dinge, die Du in Deinem heimatlichen Biotop Altdorf nie gehört hattest, geschweige denn zu ahnen wagtest. Oder doch? Ja, ich war ehrlich, schenkte mir und Dir nichts. Erzählte Dir, iv ie schon früh in meiner Kindheit und Jugend gewisse Männer sich an mich rangemacht hatten. Zum Beispiel jener Mann, der mich in der Skihütte mehrmals missbraucht hatte, oder dieser Lehrer, den ich hätte achten sollen. Mama: Homosexualität in der Modebrauche gehört wie die Naht zum Strumpf, das ist das Normale, nicht das Abnormale. Wie in allen großen Kulturen. Die meisten der netten Herren, die sich in New York so liebevoll um Dich gekümmert haben, lieben auch eher Männer als Frauen. Ich musste Dir an diesem Abend alles erzählen. Dass Jack eigent- lich in Zürich eine Freundin gehabt hat, sich dann aber doch zu Männern hingezogen fühlte. Mama, Du musstest schlucken. Ich erinnere mich noch genau: Als ich eine Pause machte, um mir ein Glas Champagner einzugie- ßen, sagtest Du in Deiner schlicht-ehrlichen Art: »Urs, ich habe in meiner Erziehung einen entsetzlichen Fehler gemacht.« Du hast mich schuldbewusst angesehen. »Aber Mami, das ist doch nicht Deine Schuld. Das liegt doch nicht an der Erziehung!« Ich dachte mir: Himmel Herrgott, was habe ich da mit diesen Geständnissen nur wieder angerichtet? Ich hätte doch wissen müs- sen, dass alles, ivas ich falsch mache, Du auf Dich beziehst.
- 8 5
- »Halt, Urs! Jetzt hörst Du mir mal zu«, so hast Du mir damals das Wort aus dem Mund genommen. »Das meine ich doch gar nicht.« Dann hast Du tief Lust geholt: »Erinnerst Du dich noch an unseren Einkaufsbummel in Zürich? Als Dich der Verkäufer so attraktiv fand?« Kunstpause. Himmel, welcher Verkäufer fand mich nicht attrak- tiv? Besonders in Zürich? »Damals habe ich zu Dir gesagt, dass Du mir immer alles erzäh- len kannst. Dass Du jederzeit zu mir kommen kannst, wenn ein Mädchen von Dir schwanger ist oder was auch immer...« Kunstpause. »Ich sagte Dir auch: dass Du mir bitte nie..., dass Du mir nie nach Hause kommen sollst, um mir zu sagen: Mami, ich bin homosexuell!« Ich erinnere mich genau. An die Boutique, an den Verkäufer, an Dich. Du wolltest möglichst schnell raus aus diesem Laden. Wir schwiegen. Ich zitterte. Was habe ich Dir jetzt nur für Schmerzen bereitet! Habe Dir alle Hoffnungen auf ein Enkelkind geraubt! Habe Dich in Deiner unermüdlichen Selbstaufgabe für mich enttäuscht! Fehlanzeige! »Ach, es ist furchtbar«, lächeltest Du mich an. Ganz sanft. »Was ich da gesagt habe, war einfach furchtbar!« Wie bitte? »Buh. Jetzt höre Deiner Mutter einmal richtig zu! Ja, das war schrecklich. Oft habe ich daran gedacht und loollte es zurückneh- men ... sagen, dass ich es so nicht gemeint habe..., aber dann hat- test Du immer Freundinnen ... und ich dachte: Nun gut! Ist doch alles in Ordnung.« »Undjetzt?«, stotterte ich. Du sahst mir direkt in die Augen, fixiertest mich: »Urs, mein Bub, glaube mir, ich meine dies aus vollstem Herzen: Ob Du homo- sexuell bist oder nicht, was spielt das schon für eine Rolle? Du bist und bleibst mein Kind, das ich liebe. Und Liebe kann man bekannt- lich nicht teilen, in mal so, mal anders.«
- 8 6
- Unglaublich, wie Du reagiert hast, meine Mutter! Die Du mich unehelich zur Welt brachtest, ohne den Vater aus dem fernen Nige- ria, uns beide in Altdorf mit harten Jobs über Wasser hieltest - und jetzt einsehen musstest: Dein Bub ist nicht nur schwarz. Er ist auch schwul. Obwohl: Dein Herz konntest Du ja nie ganz ausschalten. Recht hattest Du immer mit den Herren, die ich gerade begehrte oder liebte. Und Jack war der Erste, an dem Du gezweifelst hast, ob aus- gerechnet der Deinem Buben das große Glück bringen würde. Als wir am folgenden Tag gemeinsam aus dem Wallstreet Cen- ter liefen, um zur wartenden Limousine zu gehen, meintest Du: »Urs, darf ich Dich etwas fragen, ohne dass Du gleich böse wirst?« »Natürlich.« Ich nickte. »Was ist denn?« »Bist Du dir ganz sicher mit Jack?« Ich erwiderte schnippisch: »Mama! Wie meinst Du das?« »Weißt Du, ich finde Jack ja nett, sympathisch, sehr lustig und unterhaltsam. Aber irgendwie bin ich überrascht, dass Du ihn ge- wählt hast.« »Mama, worauf willst Du hinaus?« »Urs, ich gönne Dir Deinen Erfolg von Herzen. Das weißt Du. Aber findest Du es nicht schade, dass Du Deine Karriere für dieses Geschäft und diesen Jack aufgibst?« Und dann hast Du den Satz gesagt, der mir bis heute als Leit- faden für mein Leben geblieben ist: »Urs. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt.« Mama. Du hast nicht nur bei Jack die richtigen Worte gefunden. Liebe Mama, das alles konnte ich Dir nie sagen. Das musste ich Dir schreiben. Hier, in meinem Buch, das ich Dir widme. Dein Sohn Urs
- 8 7
- Pleite und Handicap Hautfarbe oder Zwischen Armani und den Obdachlosen
- Ich hatte zwar mein Geld mit Xtazy verloren, doch Jobs als Model wollte ich in dieser Zeit nicht annehmen. Korrumpieren dank mei- nem Aussehen ließ ich mich nicht. Als Rebell bin ich zwar nicht geboren, ich wurde es erst. Doch zum Opportunismus fehlte mil- der nötige Zynismus. G u t gemeinte Ratschläge hörte ich viele - um sie zu überhören. Nur, wer eine Hoffnung begraben musste, weiß, was das bedeu- tet. Nur, wer die Folgen eines Niedergangs an Leib und Seele erlebt hat, ahnt, wovon ich rede. Loyalität, Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit zahlen sich peku- niär vielleicht nicht aus - doch nach einem Verlust, einer Fehlent- scheidung, ja, einem Bankrott kann man sich dafür wieder aufrap- peln und schämt sich nicht, wenn man in den Spiegel guckt. Natürlich hätte ich in meinem Leben andere Register ziehen kön- nen: alle über den Tisch ziehen, Firmen in Unterfirmen in Steuer- oasen aufsplitten; statt die Altersversicherung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzuzahlen, das Geld in irgendwelche Aktien an- legen. Warum nicht? Nur eben: Das bin nicht ich, zu Ehrlichkeit, Nächstenliebe und Respekt erzogen von einer Mutter, die mir als Einzige, als es wirk- lich fast ums nackte Überleben ging, sagte: »Also, du weißt, ich habe ja nicht viel. Aber wenn ich dir helfen kann, ein paar Franken habe ich gespart.«
- 8 8
- Bei Xtazy gelang es mir, alle zu entschädigen. Der Preis war hor- rend, doch mit dem schwindenden Stand meines Bankkontos wuchs mein Glaube, dass am Ende eben doch Ehrlichkeit siegt. Erst danach begann ich wieder als Model zu arbeiten. Und erst jetzt lernte ich die ganze Brutalität des Modelbusiness kennen. Ich gelangte zu neuen Erkenntnissen. Zum ersten Mal begriff ich wirklich, was es heißt, als Schwarzer in diesem Beruf zu arbeiten. Ich musste lernen, wie rassistisch bereits einfache Werbekampagnen sein können, ich erfuhr, wie ver- gänglich der eigene Ruhm ist. Und ich entdeckte Stolpersteine auf den internationalen Laufstegen, die mir bei meiner »ersten« Model- karriere nie aufgefallen waren. Wieder begann alles in New York. Ich musste eine geeignete Agentur finden. Ich wusste, dass Zoli mein idealer Agent war: Seine Agentur verstand mich als Model. Hier hätte ich bestens arbeiten können. Aber Vicky, die neue Chefin der Agentur von Zoli, wollte mich nicht mehr vertreten, zu groß war die Enttäuschung: »Urs, auch wenn du super aussiehst und ich sicher bin, dass du die erste Wahl wärst, wenn ich dich puschen würde: Renauld White war immer loyal uns gegenüber. Ihn muss ich jetzt schützen und kann dich nicht aufnehmen. Das wäre ihm gegenüber nicht fair.« Ich wusste: Mir steht ein harter, harziger Neubeginn bevor. Denn die Agentur sah in mir wie in Renauld nicht den schwarzen Mann, sondern nur den Mann. Dies ist verdammt entscheidend, wenn ein Booker mit Kunden verhandelt. Die Agentur Elite war, dank der Loyalität von John Casablancas, bereit, mich aufzunehmen. Die Männerabteilung von Elite konnte noch nicht im Topbereich mitmischen, doch ich nahm das Ange- bot an - denn es war meine einzige Möglichkeit, überhaupt durch eine Agentur in New York vertreten zu sein. Ich versuchte es auch wieder in Europa. Hier rechnete ich mir größere Chancen aus und hoffte, dass die amerikanischen Agentu- ren dann wieder über den Atlantik schielen, mir zusehen und mich schließlich auch wieder in Topjobs vermitteln würden.
- 8 9
- »Welcome back to the business«, sagte mir Bookerin Patrizia von der Mailänder Agentur Beatrice am Telefon. Leider seien jedoch die meisten Shows ausgebucht, es blieben nur wenige Castings und »Call-backs«, also Treffen zwischen Designer und Model, bei dem der Designer ein Model persönlich sehen will, um zu entscheiden, ob es in die Kollektion passt oder nicht. »Wo möchtest du wohnen?«, fragte sie mich. »Soll ich dir ein Hotel buchen?« Die Art, wie sie fragte, verunsicherte mich. »Wo wohnen denn heutzutage eure Models?« Ich spürte, dass sie auf der anderen Seite der Leitung lächelte. »Nun, die meisten wohnen in Modelapartments.« »Toll«, meinte ich, »buch mich doch bitte auch in so eines.« Patrizia meinte zwar, dass diese Apartments keineswegs luxuriös seien und garantiert nicht dem Standard entsprächen, den ich gewohnt sei, doch erst als ich in der für mich vorgesehenen Bleibe ankam, wusste ich, was sie mir hatte sagen wollen. Statt Designer- möbel ein beängstigend kleines Zimmer, in dem vier junge Män- ner, allesamt neu im Business, wohnten. Als ich mit meinen Desi- gnerklamotten und meinem kompletten Louis-Vuitton-Gepäck in ihre Behausung stürmte, stand ihnen der Mund offen. Und ich war betreten: Wo war ich da bloß gelandet? Am nächsten Tag zog ich um, ins Grandhotel Plaza an der Piazza Diaz, zu einem weichen Kopfkissen. »Du kannst es dir ja leisten«, sagte Patrizia. Ein Spruch, den ich noch oft hören sollte, der aber der Wahrheit nicht entsprach. Dafür lernte ich einmal mehr, was es heißt, schwarz zu sein. Nie- mand wollte einen Schwarzen in seiner Show haben. »Du wirst es nicht glauben«, meinte Patrizia. »Dieses Jahr haben wir Renauld White, aber wir haben riesige Probleme, die Kunden dazu zu über- reden, dass sie ihn sich auch nur ansehen. Niemand will ihn. Dabei ist er so schön und in Amerika ein großer Star.« Schließlich blieben nur noch vier Shows übrig: Venturi, Versace, Armani und Viola. Die Designer und deren Assistenten waren
- 9 0
- überall nett - mehr nicht. Bei Versace wurde ich in einen Anzug gesteckt. Dann wurde eine Frau gerufen. Die musterte mich, er- klärte, der Anzug stehe mir sehr gut. »Aber«, so meinte sie, »diese Saison wollen wir keine schwarzen Models. Sorry, denn eigentlich finde ich dich ganz gut.« Auch Viola und Venturi wollten keinen schwarzen Mann. Den einen war meine Haut zu nigerianisch, den anderen mein Haar zu kraus. Schließlich setzte ich meine Hoffnungen auf Armani. »Geh morgen früh einfach hin und zeig Giorgio dein Buch«, meinte Patrizia. »Wir sind uns ziemlich sicher, dass er dich buchen wird, wenn er dich sieht.« Wieder im Hotel, setzte ich mich an die Bar zu einem Champag- ner-Cocktail. Gedankenverloren nippte ich daran, als eine Frauen- stimme auf Schweizerdeutsch sagte: »Aber, du bist ja der Urs!« Ich drehte mich um und sah in ein lachendes Gesicht. »Was, du erkennst mich nicht mehr?« Sie lachte. »Wir haben uns im Zug getroffen, nach deiner ersten großen Show für Yves Saint Laurent. Ich bin Suzy Mella. Und das ist mein Mann Mario.« Suzy hatte die Schweizer Topagentur Fotogen übernommen und war jetzt Modelagentin. Flugs unterbreitete sie mir ein Angebot, schon versprach ich, für sie meine Schweizer Agentur Time zu ver- lassen. Das machte wenigstens Mut auf morgen, auf Armani. Das Casting fand in Armanis wunderschönem Castello an der Via Durini statt. Kurz nach Mittag traf ich in dieser beeindrucken- den Stätte ein, die viel Ruhe ausstrahlte. Im Innern saßen fünfzig Models, nervös an Lippen oder Fingerspitzen kauend, mit einer Haarsträhne spielend, gegen die Wand gelehnt, durch den Raum laufend, mich anstarrend: »Das ist der, der in Paris alle großen Shows läuft.« »Zeig doch bitte mal dein Buch, damit ich weiß, wie ein Topbuch aussieht.« »Hey, Mann, was machst du eigentlich hier? Weshalb zum Teufel gehst du denn noch an ein Casting?« Ich überspielte meine Unsicherheit, mimte das begehrte Top- model. Bis ein Assistent von Maestro Armani kam, zu mir trat und sagte: »Sorry, dein Typ ist hier nicht gefragt.«
- 9 1
- »Möchten Sie sich nicht wenigstens mein Buch ansehen?« »Nein.« Ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen. »Ciao Männer, ich wünsche euch viel Erfolg!«, meinte ich und trat ab. Langsam, trau- rig, den Tränen nahe, stieg ich die gewaltige Treppe hinunter, als vor dem Eingang ein weißer Jaguar parkte. »Wo willst du denn hin?« Es war Giorgio Armani, der mir diese Frage stellte. »Sorry, dass ich mich verspätet habe. Gehst du jetzt schon? Willst du mich denn gar nicht sehen?« Ich war sprachlos. »Doch, natürlich möchte ich das«, meinte ich zaghaft, »aber anscheinend bin ich nicht der Typ, den Sie suchen.« »Wie bitte? Wer sagt das?« »Ihr Assistent.« Armani trat einen Schritt näher an mich heran: »Bist du nicht das Model vom >GQ<-Cover?« Er sah sich - noch im Innenhof - mein Buch an und gratulierte mir dazu. »Mit dir wollte ich schon immer etwas machen«, meinte er liebenswürdig. »Komm mit hoch. Wenn du in die Kollektion passt, möchte ich, dass du sie vorführst.« Die Kleider passten, ich wurde gebucht. »Nenn mich Giorgio«, meinte er hinterher. Uberhaupt hatte ich mit den Armanis Glück. Giorgios Schwes- ter, Rosanna Armani, gab mir einen meiner ersten Fotojobs: die Wintermodekollektion für das italienische »Playboy«. Wieder im Hotel, hatte Patrizia eine weitere frohe Botschaft für mich: »Signora Agnelli von der italienischen >Vogue< will dich sehen.« Was heißt sehen? Signora Agnelli hatte schon ein Flug- ticket Mailand-Rom für mich. Rom war wundervoll, das Shooting für »Vogue« fantastisch, inszeniert wie ein Fellini-Film. In der Lobby meines Hotels De La Ville oberhalb der Spanischen Treppe traf ich die beiden Top- models Janice Dickinson und Iman. Wir lachten, schwatzten, als ein Herr vom Modemagazin »L'Uomo Vogue« sich mir vorstellte,
- 9 2
- mich an Ort und Stelle buchte, was ich doch bitte auf seinem Zim- mer bestätigen solle. »Verstehe ich richtig? Sie wollen Sex mit mir?« Ich war sprachlos vor Wut. Ich war 24 Jahre jung, mein Körper war durchtrainiert, mein Modelbuch voller fantastischer Aufnah- men. Wie konnte er nur glauben, dass ich bereit war, sein schwab- beliges Hinterteil zu beglücken, nur um einen Job zu bekommen? Nein danke! Die Show von Armani war - natürlich - ein riesiger Erfolg. Als er nach der Show von der Zeitschrift »Newsweek« gebeten wurde, mit Models zu posieren, gratulierte er mir zur Show und bat mich dazu. Am selben Abend lud er mich zu einer privaten Party in seine Wohnung ein, die durch schlichte Eleganz bestach. An diesem Abend war sein Assistent sehr freundlich zu mir. Zwei Tage später war ich bereits in der Schweiz und hatte dank Suzy Mella einen Katalogjob. Es iolgte ein Auftrag in der Türkei für Vakko, ich stöberte durch die Bazare von Istanbul, Ankara und Izmir. Dort erreichte mich ein Anruf von Jack, der mir sagte, dass er unsere gemeinsame Wohnung aufgegeben habe, aber er habe ein Haus am Strand und ein Chauffeur werde mich am Flughafen abholen. Machen wir es kurz: In New York war kein Jack, kein Chauffeur. Mein Gepäck war auf dem Weg über den Ozean auf geheimnisvolle Weise verschwunden - mit ihm meine Kreditkarte und beinahe das gesamte Bargeld, das ich in der Türkei verdient hatte. Ohne Geld setzte ich mich auf eine Parkbank gegenüber dem »Navarro«, in dem wir einst so glücklich waren. Langsam kamen die ersten »bag ladies« an, Obdachlose, die im Park übernachte- ten. Freunde wollte ich nicht belästigen. Und ich wollte auch nicht ins »Studio 54«, um durchzufeiern. Ich beschloss, im Park zu blei- ben, um am eigenen Leib zu erfahren, wie es ist, wenn man kein Dach über dem Kopf hat. Wenigstens eine Nacht lang, symbolisch, filmreif.
- 9 3
- Und ich hielt durch. Mit Gefühlen zwischen Euphorie und Selbstmitleid, Ratlosigkeit bis Ohnmacht. Trotzig wusch ich am Morgen mein Gesicht in der öffentlichen Toilette der Penn Station im Madison Square Garden. Hier trafen sich Obdachlose - und Herren im Anzug, die morgens vor der Arbeit schnellen Sex woll- ten. Mit armen, zum Teil drogenabhängigen Männern und Jungs. Titel meines Drehbuchs für den Film in meinem Kopf: »Welcome to the Bottom of Life«. Schließlich erreichte ich Jack, der nicht in den Pines auf Fire Island wohnte, wie damals in unserer guten Zeit, sondern in Cherry Grove, dem bescheideneren Teil der Insel. Egal. Das Haus war schön, auch ohne Pool. Das Allenvichtigste aber: Xtazy, mein H u n d , war da. Trotz Champagner-Brunch, netten Nachbarn, die mich in »Newsweek« zusammen mit Giorgio Armani entdeckten - ich wollte und konnte nicht mehr hier und mit Jack leben. Ich wollte wieder auf eigenen Füßen stehen. Also kroch ich in New York City bei einem Freund aus Pariser Tagen unter, stand mir in Castings die Füße in den Bauch. Da mich jeder in der New Yorker Modelszene kannte, fielen mir die Castings allerdings immer noch leichter als den Neulingen. Alle waren freundlich, alle fragten mich nach dem Zusammenbruch unserer Model-Company Xtazy. Ich musste zum ersten Mal in meinem Leben mein Geld eintei- len, wirklich rechnen. Und wieder suchte ich eine Agentur. Zoli wollte mich nicht. Joe Hunter, Chef der Ford-Agentur, lud mich zwar zum Lunch ein, wollte mich aber auch nicht vertreten. »Ich habe dir Vorjahren ein Angebot gemacht, Urs, aber du hast dich für Zoli entschieden, dann für Elite, dann wieder für Zoli. Ich glaube nicht, dass wir jetzt die richtige Agentur für dich sind.« Irgendwie hatten die ein Problem mit meiner Xtazy-Vergangenheit. Und ein Problem mit meiner Hautfarbe. Ralph Lauren und andere waren noch nicht so weit, mit einem Schwarzen Werbung zu machen, das Katalogbusiness war fest in
- 9 4
- den Händen der Agenturen, die mich nicht wollten. Bei einem Job für Wodka-Werbung sollte ich am Ende nur 15000 Dollar erhal- ten, während meine Kollegen 100 000 Dollar verdienten, weil deren Plakate in den weißen Vierteln hängen würden, meine nur in den schwarzen - also sagte ich den Job ab! Unweigerlich musste ich an Lina Wertmüller denken. Die be- rühmte italienische Regisseurin, die mich einst im Hotel Navarro in der Lobby angesprochen hatte: »Sie sind ein Schauspieler!« Ich: »Nein, Model.« Sie: »Doch, Sie sind Schauspieler!« Auch was Lina sonst noch sagte, verwirrte mich: »Komisch, wenn ich durch den New Yorker Stadtkern laufe, sehe ich nur Wer- bung mit weißen Models, während ich in den Außenbezirken genau die gleiche Werbung mit schwarzen, asiatischen oder hispa- nischen Models sehe. Wäre dieses Land nicht abgrundtief rassis- tisch, dann wären die Firmen wohl kaum gezwungen, ihre Werbung in drei- oder vierfacher Ausführung zu produzieren.« Und den Vergleich, den sie dann machte, habe ich mir bis heute gemerkt: »Weißt du, in Amerika sind die Apfel wunderschön und verlockend. Aber wenn man reinbeißt, haben sie keinen Geschmack. Bei uns in Italien sind die Dinger ldein und verschrumpelt, aber wenn man reinbeißt, Mamma mia, schmecken sie wie Äpfel!« Irgendwie hatte ich es satt, Model zu sein. Zudem ein schwar- zes, das kaum je so viel verdienen würde wie die weißen Berufskol- legen. Also setzte ich mich eines Tages hin, um eine eigene Damen- Kollektion zu entwerfen. Ich kopierte die schönsten Badekleider, die es seit den Fünfzigerjahren gegeben hat, komponierte einen Uberwurf dazu, der sowohl von schlanken als auch von molligen Frauen getragen werden konnte. Mit der Wahl zwischen V- und Rundhals-Ausschnitt. War dieser Look nicht revolutionär? War das nicht meine Zukunft? Ich nahm mir vor, in Zürich mit Gustav Zumsteg zu reden, dem Chef.des Seidenhauses Abraham, der doch bestens mit Yves Saint Laurent und den anderen Modezaren befreundet war. Das müsste doch hinhauen ...
- 9 5
- Doch zunächst schlug mir das Schicksal ein anderes Schnipp- chen. Nach einem Weekend im August mit Jack fuhr ich allein mit der Fähre von Cherry Grove nach New York City, als mich ein Mann ansprach. »Entschuldigen Sie, sind Sie etwa Schweizer?« »Natürlich bin ich Schweizer!«, antwortete ich gut gelaunt. »Nein, nein«, erwiderte mein Gegenüber, »es gibt doch keine schwarzen Schweizer.« So fing ich zur Belustigung der anderen Passagiere an zu jodeln und meinte in breitestem Urner Dialekt: »Wir können uns auch in Schwizerdütsch unterhalten. Ich heiße Urs.« »Und ich Alex.« Bereits am nächsten Tag rief Alex mich an, lud mich zum Essen ein - und klärte mich auf: »Sorry, Urs! Ich hatte dich in der >New York Post< gesehen, und jetzt habe ich gerade Liz Smith getroffen, die beste Klatschtante der Staaten. Sie erzählte mir deine Ge- schichte und von Xtazy und der ernormen Presse und wie alles den Bach runterging.« Dann erzählte er, dass er die älteste und berühmteste Discothek der Schweiz führe, die »Casa Antica« in Klosters, dem bekannten Skiort. »Klosters?«, spottete ich, »zum Stichwort Skiort fallen mir nur St. Moritz, Zermatt, Crans-Montana ein.« Flugs klärte mich Alex über den Glamour von Klosters auf. Wer dort wohnte oder Ferien verbrachte: zum Beispiel Englands Thron- folger Prinz Charles, Irwin Shaw, die Film-Diven Deborah Kerr und Greta Garbo. »Und die unterhältst du in deiner Dorfdisco mit urchiger Länd- lermusik?« »Willst du mich beleidigen? Ich habe die beste Musiksammlung der Schweiz. Ich bin jeden August in New York, um die neusten Platten einzukaufen. Ich kann dir sagen: Jede Platte, die im >Stu- dio 54< gespielt wird, habe ich. Meine Gäste erwarten und bekom- men nur das Beste.«
- 9 6
- Dann gab ein Wort das andere. Ich erzählte ihm, wie mir das Modeln zum Hals raushänge. Er schwärmte von Schnee, Bergen, High Society, Skifahren: »Also«, fasste Alex zusammen: »Wenn du schon mit dem Modeln aufhören willst - warum kommst du dann nicht im Winter zu mir und arbeitest als DJ in meinem Club?« Mir fiel der Kiefer herunter. »Alex, ich bin kein DJ. Ich kenne nicht mal die Musik!« »Mann, das glaube ich dir nun echt nicht! Du bist doch ständig im >Studio 54<!« Schließlich versuchte ich es mit einem Argument, das auch ihm einleuchten müsste: »Ich verdiene an einem Tag als Model mehr als bei dir in einem ganzen Monat.« Alex ließ sich von seiner Idee nicht abbringen. »Uberlegs dir trotzdem. Du wärst die Sensation für meine Gäste: ein Topmodel als DJ.« »Und wenn ich Shows in Paris, Mailand oder New York laufen muss?« »Kein Problem. Sag es mir vierundzwanzig Stunden im Voraus. Dann kommt ein anderer DJ dran. Nur in der Hochsaison, über Weihnachten und Neujahr kannst du nicht freinehmen.« »Und ... wie viel kannst du mir zahlen?« »3000 Franken im Monat plus Kost und Logis.«
- 9 7
- Polizei in Zürich, Jetset in Klosters oder Meine Zeit als DJ in der »Casa Antica«
- Wäre ich ohne den guten, alten Erwin vom Reisebüro Hauger in Altdorf wirklich von New York nach Klosters gekommen? Erwin hatte mir meinen ersten Flug gebucht - er schaffte es dies- mal, für mich in letzter Minute einen Platz in der First Gass der Swissair New York-Zürich zu ergattern. Mit Stil wollte ich mich von New York verabschieden, »meiner« Stadt. Mit einem Glas Champagner in der H a n d vom Himmel herab Adieu sagen. In Zürich landete ich schnell in der eidgenössischen Wirklich- keit. Bevor ich den Zug nach Hause, zu Mama, nach Altdorf nahm, schlenderte ich nach dem langen Flug in der frischen Herbstluft im Zürcher Hauptbahnhof herum. In hellbraunem Mantel im Fisch- gratmuster von Yves Saint Laurent, dunkelgrauem Seidenhemd mit Malerin-Kragen von Yves Saint Laurent, doppelreihigem Flanell- anzug in Hellgrau - natürlich von Yves Saint Laurent. Meine Füße steckten in dunkelbraunen, handgefertigten Lederschuhen von Rossetti, mein Gepäck war ebenfalls handgefertigt, aus Leder - von Botticelli. Zu viel für die Zürcher Polizisten, die mich in schlechtem Eng- lisch ansprachen - was ich mit bestem Englisch quittierte. Zur Überprüfung meiner Personalien sollte ich mit auf die Wache. Also wechselte ich ins Urner Schweizerdeutsch. Jetzt war aber Feuer unterm Dach!
- 9 8
- Ich wurde sauer, provozierte, beleidigte. So hatte ich mir meine Heimkehr nicht vorgestellt. Das Büro meines Anwalts in Zürich war zu dieser Stunde noch nicht besetzt - also sollten die doch ihre Kollegen in Altdorf anrufen. Ob die einen Althaus Urs mit schwar- zer Hautfarbe kennen ! Langsam, aber deutlich sagte der Innerschweizer Ordnungs- hüter seinen arroganten Kollegen in Zürich: »Ja, wir kennen den Althaus Urs. Ja, der ist schwarz. Ja, wir können uns schon vorstel- len, dass der von Kopf bis Fuß in so komischen Klamotten steckt.« Nach einer Pause dann die herrlichen Worte: »Der ist Schweizer. Hat einen Schweizer Pass.« In Flüelen nahm ich kein Taxi, obwohl ich für den Flug auf einem First-Class-Ticket bestanden hatte. Hier in Uri fuhr ich wie immer mit dem Bus zu Mama, stieg bei der Haltestelle »Kollegium« aus, sperrte die Wohnung auf, rief meine Mutter bei der Arbeit an, dann setzte ich mich hin und hörte Musik. Platten, die im »Studio 54« gespielt worden waren. Wechselte zu Edith Piaf, Georges Moustaki und Jacques Brei. Als »Ne me quitte pas« erklang, flössen meine Tränen. Ich duschte und ging ins Café Kristall. Als meine Mutter um halb sieben Uhr abends nach Hause kam, umarmten wir uns. Ich übergab ihr einen großen Strauß Blumen. Sie kochte wie in meiner Kindheit das Abendessen. An diesem Abend ging ich endlich mal wieder müde, aber glück- lich zu Bett. Voller Tatendrang rief ich am nächsten Morgen die Abraham AG an, um einen Termin mit Herrn Gustav Zumsteg zu bekommen. Schließlich sollte der mir ja helfen, meine selbst ent- worfene Damenkollektion an den Mann zu bringen. Die Zürcher Seidenfirma war weltberühmt, spezialisiert auf Seidenstoffdesign für Prêt-à-porter und Haute Couture. Zu ihren Kunden gehörten die Modehäuser Yves Saint Laurent, Balenciaga, Givenchy, Chanel, Dior und Ungaro. In Paris galt Herr Zumsteg als der König der Seidenhändler, seine Stoffkreationen waren die Highlights der Modewochen. Die- sen Mann wollte ich von meinen Ideen überzeugen.
- 9 9
- Ich bekam einen Termin, zwei Tage später. Das war nach meinem Geschmack: Erst Zumsteg, dann Besuch bei der Zürcher Agentur Fotogen, alte Freunde treffen. Zumsteg schaute sich meinen Kollektionsentwurf an, bat um eine zweiwöchige Bedenkfrist. Fotogen hatte einen Katalogjob für mich. In einem neuen In-Club feierte ich bis zum Abwinken. Dann das zweite Meeting mit Gustav Zumsteg am 7. November. »Ich habe mir deine Idee gut überlegt«, meinte er. »Und ich glaube, dass das für kurze Zeit wirklich ziemlich gut funktionieren könnte. Aber wir von der Abraham AG können es uns nicht leis- ten, da mitzumachen. Wir dürfen nicht in Konkurrenz treten zu all unseren bisherigen, loyalen Kunden.« Er sah mir meine Enttäuschung an und versuchte, mich aufzu- muntern. »Versuch es doch selber, Urs. Ich würde dir unsere Stoffe gerne dazu zur Verfügung stellen.« Doch mich hatte der Mut verlassen, die eigene Kollektion wei- ter voranzutreiben. Zum Glück fiel mir das Telefongespräch mit Jack einige Tage zuvor ein, als er mir mitgeteilt hatte, er habe Lina Wertmüller getroffen und sie wolle mich für eine Rolle in ihrem nächsten Film engagieren - an der Seite von Sophia Loren! Um sicher zu sein, dass ich mich nicht verhört hatte, rief ich Jack noch einmal an: »Meinst du, dass Lina Wertmüller das ernst gemeint hat?« »Ja klar. Die Dreharbeiten sind um den Mai herum geplant. In Rom.« Ich seufzte, jetzt theatralisch: »Also gut, wenn ich keine andere Möglichkeit habe, dann gehe ich eben nach Rom.« Und schon wieder träumten Jack und ich: von einer Wohnung in Rom. Er baut seine alten Bankkontakte auf. Ich drehe Filme. Neuanfang für alle. Trotz allem glaubte ich noch immer an Jack. »Sag Lina, ich komme, ich mache es. Aber ich nehme mir jetzt erst eine Auszeit.« Als ich den Hörer auflegte, war mir leicht ums Herz. Und ich
- 1 0 0
- freute mich auf Klosters. Jeden Tag Ski fahren, abends ein paar Plat- ten auflegen. Ich rief Alex an, sagte ihm zu, unter einer Bedingung: Meine Mutter hatte sich vom 24. Dezember bis zum 2. Januar freigenom- men. Und sie brauchte ein Zimmer. Ach was, das beste Zimmer! Zwei Tage später rief Alex zurück: Mama hatte ein Zimmer im besten Hotel von Klosters, der »Chesa Grischuna«. Ich würde es bezahlen. Was ein DJ macht? Keine Ahnung. Alex am Telefon: »Egal. Du bist ein Topmodel, meine Gäste kennen dich, das reicht.« Und die Platten? »Keine Angst, du kannst keinen Fehler machen. Ich habe ausnahmslos gute Platten, auf drei Kisten verteilt. In einer die lang- samen Songs, in einer die schnellen.« Und wie wähle ich aus? »Ich sitze an der Bar! Gebe dir mit den Fingern Zeichen, aus welcher Kiste du Platten rausfischen sollst.« Am 11. Dezember um 18.20 Uhr traf ich mit der Rhätischen Bahn in Klosters ein, es war stockdunkel. Kein Taxi. Klosters war öde, ausgestorben, es lag kein Schnee. Die »Casa Antica«? Geschlossen. Ich klingelte an der Tür. »Wodka, wie in New York?«, strahlte mich Alex an. Sein Club bestand aus einer halbrunden Bar wie aus dem Mitt- leren Westen der USA, alles aus Holz, mit einem Wahrzeichen des schlechten Geschmacks, einer weißen Kitsch-Gans. Trotzdem: ein Ort zum Wohlfühlen. »So, hier ist dein Drink.« Alex kam auf mich zu und drückte mir ein Glas in die Hand. »Ich zeige dir gleich dein Zimmer.« Mein Personalzimmer lag unter dem Dach. Klein, sauber, mit eigenem Waschbecken. Dusche und Toilette waren auf dem Stock- werk. Und schon stand ich in der Disco, um zu proben, Platten aufzu- legen. Ich übte und übte. Die Deckel der Kisten, in denen die Plat- ten verstaut waren, waren mit Kreuzen markiert. Als die »Casa Antica« abends um zehn Uhr öffnete, war kein Mensch da. Zum Glück. Ich spielte einfach, wie Alex es mir aufge-
- 1 0 1
- tragen hatte, Platten aus der Kiste mit einem Kreuz. Als die ersten Gäste kamen, hob Alex zwei Finger seiner rechten Hand. Also fischte ich eine Platte aus Kiste Nummer zwei. Als ich die Kiste mit den drei Kreuzen zum Einsatz brachte, hatte sich die Tanzfläche zur Hälfte gefüllt. Viele Gäste machten mir ein Zeichen: Musik ist okay! Eine hübsche Frau, die auf mich zukam und meinte: »Super, ihr Schwarzen wisst einfach, wie man Musik auflegen muss!« Genau: Als Tanzmeister sind wir Schwarzen allemal gut genug. Doch ich wurde als DJ immer besser. Der Club kochte. Ich holte aus der Lichtanlage raus, was sie hergab, legte auf, was allen in die Glieder fährt. Ich schaffte es, dass diese kleine Holzbar einen Hauch des großen »Studio 54« ausstrahlte. Durch ihre Klientel hatte die »Casa Antica« das Flair einer internationalen Topdisco - sie war nur intimer, die Gästeschar handverlesener. »Ach, die >Casa<«, sagte ein weißhaariger Herr, der sich mir als Irwin vorstellte, eines Tages beim Mittagessen, »da ging ich früher oft hin. Heute ist mir die Musik zu laut.« Ich lachte: »Nicht, wenn Sie früh am Abend kommen. Da spiele ich ruhige Musik.« Noch am gleichen Abend, gleich um zehn Uhr, als wir aufmachten, hörte ich, wie Alex Irwin begrüßte: »Irwin! Du hast uns schon lange nicht mehr beehrt.« Ich kramte in der Kiste mit einem Kreuz, nahm Platten von Louis Armstrong, Edith Piaf heraus. Zu jedem Song wusste Irwin eine Anekdote. Woher kannte er nur all diese Storys? »Darf ich fragen, was Sie denn so im Leben machen?« Er lächelte. »Ich wohne hier - und schreibe nebenher Bücher.« Es stellte sich heraus, dass er der große Schriftsteller Irwin Shaw war. Der Mann, der die Drehbücher für Kultfilme wie »The Talk of the Town« mit Cary Grant, »Fire Down Below« mit Rita Hay- worth und »Desire Under the Elms« mit Sophia Loren verfasst hatte. Als er sich verabschiedete, versprach er, mich bald wieder in der »Casa Antica« zu besuchen. Irwin war es gewesen, der in den Sechzigerjahren seine Hollywood-Freunde in das Bergdorf gelockt
- 1 0 2
- hatte. Einige - wie Greta Garbo - verliebten sich so in Klosters, dass sie mehrere Jahre dort lebten. Kurz vor Weihnachten - das Dorf war nun voll belebt - traf meine Mutter ein. Am Weihnachtstag saßen Mama und ich mittags im Restaurant der »Chesa Grischuna« und fielen, gelinde gesagt, auf: Ich trug ihr zu Ehren einen Smoking. An einem großen runden Tisch in der Mitte des Raumes saß eine Familie, die sich über uns unterhielt. Kaum hatten wir unser Essen beendet, kam ein Herr auf uns zu, stellte sich als Jerome Hellman vor, Produzent des Filmes »Midnight Cowboy«. »Sie müssen Mutter und Sohn sein«, meinte er freundlich. »Meine Familie pflegt in Los Angeles die Tradition, zur Weih- nachtsfeier stets Freunde einzuladen. Wir würden diese Tradition gerne hier in Klosters weiterführen und gemeinsam mit Ihnen feiern.« Auch einer weiteren Familie waren wir aufgefallen. Den Lear- monds. Zizi Thynne, die Tochter der Familie und Enkelin des Earl of Bournemouth, erzählte mir später amüsiert: »Ich dachte mir damals echt: >Oh, schau mal, ältere Dame mit jungem Liebhaber.<« Zizi kannte jeden Briten hier oben. Die große Zahl an englisch- sprachigen Touristen in Klosters rührt übrigens vom Zweiten Welt- krieg her. Englische und amerikanische Piloten, die im Schweizer Luftraum abstürzten, und die Soldaten, die aus irgendeinem Grund in der Schweiz strandeten, wurden in Klosters einquartiert. Die deutschen interessanterweise in Davos. Und ich traf Sonja Knapp, Mitbegründerin des Modehauses Ungaro. Sie engagierte mich vom Fleck weg. Warum? Sonja hatte mich gesehen, wie ich einen Berg hochlief. In dunkelbrauner ele- ganter Lederhose und einer Kaschmirjacke von Missoni, die spä- ter im Guggenheim-Museum ausgestellt werden sollte. So ausstaf- fiert, war ich auf dem Weg zum »Alpenrösli«, als plötzlich ein Auto scharf bremste, Sonja Knapp am Steuer. Schon war ich gebucht für Emanuel Ungaros erste Männershow in Paris.
- 1 0 3
- Rom, Sex auf offener Bühne oder Erste Gehversuche als Schauspieler
- Paris war gut zu mir. Klosters auch. Jetzt aber wollte ich nach Alt- dorf, bevor ich mich nach Rom auf die Socken machte, um dort beim Film mein Glück zu versuchen. Einmal mehr half mir mein Freund Erwin vom Reisebüro Hau- ger in Altdorf. Er schaffte es, meinen geliebten H u n d Xtazy in der größten gerade noch zulässigen Hundekiste von New York nach Zürich zu fliegen. Beruhigt mit einer halben Valiumtablette, die ihm Jack vor dem Abflug verabreicht hatte. Wackelig auf den Beinen, aber glücklich sprang er in Zürich in meine Arme. Von der Schweiz aus wollte ich mit Xtazy nach Rom ziehen. Alles war organisiert, als ein Anruf meine Pläne durchein- anderbrachte. Ein Angebot von Armani - in Wien. Flug First Class! Hotel: das berühmte »Sacher«. Nur: Was mache ich mit Xtazy? H u n d e in Schlafwagen waren nicht erlaubt. Was blieb? Ein Privatabteil erster Klasse, im Nachtzug Zürich-Wien. Und in Wien? »Hunde nicht erlaubt, mein Herr!«, sagte der Chefportier des »Sacher«. »Nicht einmal bei Liz Taylors H u n d ha- ben wir eine Ausnahme gemacht.« Also zogen wir in eine hundefreundliche Herberge. Und zum Dank stahl Xtazy mir die Show, als wir gemeinsam für Armani lie- fen. Der Choreograf war derart begeistert von meinem Hund, dass er ihn in letzter Sekunde in die Modeschau einbaute.
- 1 0 4
- Genau der richtige Zeitpunkt, der richtige Ort! Die Modeschau fand nämlich auf dem Set eines Filmes von Franco Zeffirelli statt. Es war eine der eindrücklichsten Kulissen, vor denen ich je gelau- fen bin. Mir kam außerdem die Ehre zu, das Finale zu laufen. So schritt ich als Bräutigam die enorm lange Treppe hinunter, die am hinteren Ende der Bühne aufgebaut worden war. Unten angekom- men, klopfte ich rechts an eine Tür - heraus kam die Braut, an der Leine Xtazy. Jubel und Applaus. Xtazy war der Star. Immerhin ver- diente ich mehr als er! Gemeinsam fuhren wir mit dem Zug von Wien nach Rom, das für die nächsten paar Monate unser Zuhause werden sollte. Jack hatte uns eine Einzimmerwohnung in einem Apartment- hotel im Trastevere reserviert, einem Viertel der Altstadt, das meine Liebe erweckte. Hier wollten wir wohnen, bis wir eine eigene Woh- nung hätten. Und schon hatte ich einen Job - für Valentino, der mir sofort anbot, seine Kollektion sozusagen an mir abzustecken. Für mich war das Timing perfekt. Bei einem der besten Mode- designer der Welt konnte ich gutes Geld verdienen, das mir die Freiheit ließ, meine Schauspielpläne in Ruhe zu verfolgen. Schließ- lich wollte ich mir eine zweite Karriere als Schauspieler aufbauen. Bevor ich den Vertrag erhielt, lud mich Valentinos Geschäfts- partner, Giancarlo Giammetti, auf einen Drink zu sich nach Hause ein, um Einzelheiten zu besprechen. Er wohnte im Parioli, in einer noblen Wohnung. »Urs, du bist doch der von Xtazy?« Ich nickte. »Nun, wir geben dir den Vertrag. Aber du musst mir verspre- chen, dass im Zusammenhang mit Xtazy nichts mehr auf Valentino oder mich zukommt. Okay?« Ich verstand nicht ganz. »Natürlich verspreche ich das. Aber das ist doch absurd. Ihr hattet ja mit Xtazy gar nichts zu tun.« Da erzählte mir Giancarlo, dass jemand versucht hatte, ihn und Valentino im Zusammenhang mit Xtazy zu einem New Yorker Gerichtsverfahren vorzuladen. Und dass sie jeden erdenklichen
- 1 0 5
- Trick angewandt hatten, um dem Gerichtsangestellten, der, wie damals in New York üblich, mehrmals versucht hatte, ihnen die Vorladung persönlich zu Hause zuzustellen, nicht zu begegnen. »Wir hatten echt Schiss damals. Ständig drückte sich der Kerl in der Nähe unseres Hauseingangs herum, wenn wir nach Hause woll- ten. Wir mussten zusehen, wie wir überhaupt ungesehen in unsere Wohnung kamen ! Stell dir vor, ein Verfahren in Amerika ! Wir wuss- ten ja nicht, wer uns was anhängen wollte.« Ich lachte. »Giancarlo, das waren bestimmt unsere Anwälte, die euch vorladen wollten. Die wollten euch garantiert nichts anhän- gen. Es war wohl wegen Joe Eula, unserem damaligen Art-Direc- tor und eurem Grafikdesigner. Wahrscheinlich wollte man eure Aussage. Denn Joe hatte ja uns und der Presse erzählt, dass ihr das Model-Ensemble für eure damalige Prêt-à-porter gebucht hättet. Nur wegen diesem Vertrag sind wir ja damals nach Paris geflogen.« »Vertrag?«, rief Giancarlo erstaunt. Nun erzählte er seine Ver- sion der Geschichte. Er und Valentino wussten absolut nichts von einem Vertrag. Joe habe sie einfach eines Tages etwas nervös um eine Sitzung gebeten und davon erzählt, dass er Xtazy gerne in die Show einbauen würde. »Natürlich lehnten wir ab«, fuhr Giancarlo fort. »Wir buchen keine Models, die wir nicht kennen.« Da ging mir ein Licht auf. »Ach, deshalb stürmte Joe den Coif- feursalon und schrie, wenn wir die Show machen wollten, dann müssten wir ruckzuck bei Valentino auftauchen. Er wollte euch die Models so schnell wie möglich vorstellen, damit ihr sie doch noch buchen könntet.« Giancarlo lachte nun ebenfalls. »Und ich hab mich gewundert, weshalb eure Models mit Haarwicklern bei uns vorbeikamen.« »Keine Sorge, Giancarlo, das Geschäft wurde eingestellt.« »Keine Sorge, Urs, du hast den Job.« Schnell entdeckte ich, dass es nicht ausreicht, eine Agentur in Rom für das Modeln zu haben - ich brauchte eine zweite für mei- nen Wunsch, Schauspieler zu werden.
- 1 0 6
- Zunächst traf ich mich jedoch mit Lina Wertmüller, um meine Rolle als Liebhaber von Sophia Loren zu besprechen. Ich war mehr als unsicher, ob es sich da wirklich um eine große Rolle handelte. Aber Lina war überzeugt von mir. Ich war ihre erste Wahl. »Sie müssen es wissen«, sagte ich zu ihr. »Schließlich sind Sie der Boss.« Sie sah mir tief in die Augen, ohne zu lächeln: »Nein, ich bin der General.« »Keine Sorge«, meinte sie dann leichthin, »ich kann gemein und hart sein. Aber ich werde alles aus dir herausholen - auch, wenn du heulen musst.« Am nächsten Tag ging ich in die Filmstadt von Rom, die legen- däre Cinecittä. Dort traf ich Linas Assistenten und Castingdirek- tor Gianni Arduini, der mindestens so überrascht war wie ich, dass Lina mir eine so große Rolle zugedacht hatte. Mir, einem blutigen Anfänger. »Wer ist dein Filmagent?«, fragte mich Gianni. »Ich habe keinen«, erwiderte ich. Er grinste, mitleidig, belustigt: »Du brauchst aber einen. Für den Vertrag, und alles, was es mit sich bringt. Ich kenne einen, der ist spezialisiert auf ausländische Schauspieler. Fernando Piazza. Wenn du willst, ruf ich ihn an.« Gianni telefonierte und drückte mir eine Telefonnummer in die Hand. »Du kannst ihn morgen nach zehn Uhr in seinem Büro errei- chen.« Am nächsten Tag rief ich Fernando an. Er wollte mich nicht in der Agentur treffen, sondern auf der Piazza Santa Maria im Traste- vere, gleich bei mir um die Ecke. »Mich werden Sie ohne Probleme erkennen«, sagte ich, »ich bin schwarz.« »Was?! Sie sind schwarz?« »Ein Problem für Sie?« Fernando lachte. »Aber nein: Ich bin nur erstaunt, weil Gianni mir von einem Schweizer erzählte. Er sagte nicht, dass Sie schwarz
- 1 0 7
- sind. Kein Problem für mich. Und ich habe eine Überraschung für Sie. Zwei Uhr auf der Piazza?« Um zwei Uhr saß ich mit meinen H u n d Xtazy im Café, mit herr- lichem Ausblick auf die alte Kirche, das goldene Zifferblatt der Turmuhr und den davorliegenden Brunnen. »Na, Sie müssen Urs sein«, sagte plötzlich eine freundliche Stimme hinter mir. Ich drehte mich um. Vor mir ein elegant geklei- deter Herr mit Hut und Mantel, der mich anlächelte. Der Mantel war weiß. Der Herr war schwarz. »Sehen Sie«, meinte Fernando zufrieden, »ich sagte ja, ich hätte eine Überraschung für Sie!« »Eins vorweg, Urs! Sag nie jemandem, dass du ein Model bist«, wies Fernando mich an. »Sonst wirst du als Schauspieler nie ernst genommen, und: Ich kann dir keine andere Rolle besorgen, bis der Film mit der Loren draußen ist.« »Und mein Job bei Valentino?« »Ist okay. Die Abmachung mit Valentino ist super. So kannst du Geld verdienen, ohne in Italien öffentlich als Model zu erscheinen.« Fernando nahm mich in seine Agentur auf und wurde ein Freund. Leider verstarb er Anfang 2009, kurz bevor ich dieses Buch beendete. Wenig später rief mich die Produktionsleitung von Lina Wert- müller an: Der Drehbeginn muss verschoben werden! Als ich mir abends die TV-Nachrichten ansah, wusste ich warum: Die Produktionsfirm a Gaumont hatte einen großen Investor, des- sen Name mir allzu gut bekannt ist: den Banco Ambrosiano. Diese Bank steckte nun knietief in Schwierigkeiten. Tags darauf empfing mich Lina bei sich zu Hause zum Tee und meinte, es könne sicherlich ein neuer Investor gefunden werden. Leider behielt sie nicht recht. Der Film mit mir als Liebhaber der Loren wurde nie gedreht. Mein schwarzer Agent Fernando fand dies keineswegs traurig: »So kann ich dich für andere, kleine Rollen vorschlagen.« Schon plätscherten andere Angebote rein. Darunter eine Rolle, die in ei-
- 1 0 8
- nem Sexclub spielen sollte. Ich sollte dort mit einer jungen Tänze- rin schlafen. »Ein seriöser Film?«, wollte ich wissen. »Absolut. Kein Sexfilm.« Nein. Mich nackt zu zeigen - damit hatte ich keine Schwierig- keiten. Auf diese Weise, dachte ich, kann ich mich als Leinwand- liebhaber üben, bevor meine große Rolle kommt. Heute weiß ich: Sophia Loren kann froh sein, dass ich nie ihr Liebhaber wurde, sondern erst mit einer anderen üben konnte. Himmel, was war ich für ein blutiger Anfänger! Ich dachte doch tatsächlich, ich müsse so richtig mit der Dame schlafen. Als mir in der Garderobe am Filmset eine halbe Unterhose angezogen wurde, die meinen Penis überdeckte, war ich überrascht. Der Schauspie- lerin wurde eine Art Netz zwischen die Beine geklebt, was mich ebenfalls wunderte. Auf jeden Fall war ich sehr erleichtert, dass wir es nicht wirklich miteinander treiben mussten. Vor Dutzenden von Beleuchtern, Make-up-Artisten, Kabelträgern und Assistenten. »Schade, dass man im Kino nur spielt und ich nicht richtigen Sex haben kann«, versuchte ich witzig zu sein. Die italienischen Män- ner fanden diese Bemerkung toll. Die Schauspielerin weniger. Ebenso wenig gefiel es ihr, dass ich mich Minuten später auf sie legte, sie zärtlich in die Arme nahm und sie zu küssen begann. »Stopp!«, rief der Regisseur. »Urs, bitte lass das!« Die Schauspielerin, erleichtert: »Grazie, Maestro!« Ich schämte mich, entschuldigte mich sofort. Dafür brachte mir die Dame bei, wie man Zungenküsse spielt. Es erstaunte mich, dass man sich dabei keineswegs gegenseitig die Zunge in den Mund steckt. Nach dieser Lektion ging es weiter. Plötzlich rief der Regisseur irgendetwas, und alle liefen vom Set. Meine Partnerin erklärte lakonisch: »Essenszeit! Danach drehen wir die Szene.« Als wir am Nachmittag die Szene drehten, war meine Partnerin wie ausgewechselt. Sie gab alles und stöhnte, was das Zeug hielt. Ich hingegen begann, zärtlich das Haar der Dame zu streicheln.
- 1 0 9
- »Stopp!«, rief der Regisseur. »Was machst du da, Urs?« »Liebe«, antwortete ich. Der Regisseur lachte. »Ich will kein Vorspiel sehen. Die Szene spielt in einem Sexclub. Ihr tut es dort öffentlich, auf der Bühne, für Geld. Da will keiner Zärtlichkeiten sehen. Alles klar?« Ich hatte an diesem Tag viel gelernt und bekam für die Rolle so viel Geld, dass ich meine erste Monatsmiete bezahlen konnte. Zwei Tage später schickte mich Fernando zu Regisseur Giuseppe Fina. »Viel Glück, Urs. Giuseppe Fina ist ein echter Signore, der in einem noblen Palazzo gleich bei der Spanischen Treppe wohnt. Also, zieh dir was Elegantes an - und nimm deinen H u n d nicht mit.« Das Treffen verlief bestens. Ich bekam meine zweite Filmrolle. Diesmal in Kleidern. Einige Zeit später lud Jack mich, den Protestanten, zur Weih- nachtsmesse des Papstes im Vatikan ein. »Ich habe gute Plätze«, meinte Jack. »Gute Plätze? Seit wann kann man in einer Kirche Plätze reser- vieren?« Jack lachte und erzählte mir eine unglaubliche Geschichte. Er hatte einen Kardinal im Vatikan aufgesucht, um Tickets für die Weihnachtsmesse zu ergattern. Und bekam prompt zwei Plätze beim Eingang. Die Tickets waren weiß. Stinkfrech fragte Jack den Kardinal: »Was für Tickets benötigt man denn für ganz vorne?« »Rote«, erwiderte der Glaubensmann. Rote Tickets konnte Jack nicht kriegen, die waren Staatsober- häuptern vorbehalten - aber blaue, die es uns tatsächlich ermög- lichten, an Weihnachten sehr weit vorne im Petersdom zu sitzen. Nur: Zu Beginn war es alles andere als feierlich. Vor dem Dom begehrte eine Menschenmenge kreischend Einlass. Nichts da. Die Gitterschranken und Sicherheitskontrollen erinnerten an ein Pop- konzert. Wir durften rein, die anderen nicht. Eine von weit her angereiste Nonne war so aufgeregt, dass sie vor freudiger Erregung, den Papst zu sehen, auf den Marmor
- 1 1 0
- kotzte. Als der Papst den endlosen Mittelgang entlangschritt, wur- de er mit Applaus empfangen. Ein schwarzer Priester hatte sich wohl verspätet. Er wurde mit »Hopphopp«-Rufen angefeuert, sei- ner Heiligkeit zu folgen. Ein Junge neben mir sagte auf Deutsch zu seiner eleganten Mut- ter: »Ach, das ist ja noch schöner als im Zirkus!«
- 840 000 Franken Verlust, Valentino sauer oder Zwischen Mode und Film
- Trotz meiner ersten Filmchen kam mein Traum, Schauspieler zu werden, in Rom nicht in Schwung. Wir hatten uns eine Wohnung im Parioli gemietet, doch zu Beginn des Jahres 1982 war sie immer noch nicht bezugsbereit. Jacks Geschäfte liefen mal wieder schlecht. Ich sprach noch immer nicht fließend Italienisch und hatte Schwierigkeiten, mich an den Lebensrhythmus von Rom zu gewöhnen, der so ganz anders war als der Herzschlag New Yorks. Der Film von Lina Wertmüller mit Sophia Loren, weswegen wir überhaupt nach Rom gezogen waren, wurde definitiv abgesagt. Ich hatte genug von der Kocherei in der kleinen Wohnung, genug davon, den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als mit meinem Briard Xtazy durch die Stadt zu spazieren. Und wir brauchten wieder Geld, dieses verdammte bedruckte Papier! Also musste ich einfach wieder mehr modeln. Wo? In Rom? Hart. Paris? An den Modewochen? Immerhin eine sichere Einnah- mequelle.
- 1 1 1
- Meine Bookerinnen sahen mich allerdings ganz anders als ich mich selbst: »Urs, wir haben dich ausschließlich für die Topdesig- ner gebucht. Die kleinen Shows, die willst du ja sicherlich nicht machen. Du brauchst das Geld doch gar nicht. Dein Freund Jack ist ja superreich, und wir dachten, du willst nur mehr das Beste vom Besten machen.« Ich war entsetzt. Erklärte, dass ich das Geld brauche. Fehlan- zeige: »Aber Jack ist doch Multimillionär!« Bis ich ihnen schwor: »Das stimmt nicht! Ich brauche das Geld! Ich bin finanziell auf jeden Auftrag angewiesen ! « Nun sputeten sich die Bookerinnen: Schon war ich wieder in der Türkei. Als ich zurückkam, ging es Schlag auf Schlag: Fotoaufträge für Zeitschriften wie »Harper's Bazaar«, »Playboy«, »Esquire«. Ich lief für Kenzo, Givenchy, Lanvin, Cardin, Gucci und andere. Vor einem Jahr wäre ich über ein solches Comeback überglück- lich gewesen. Doch innerlich hatte ich mich vom Beruf Model ver- abschiedet. Meine Träume und mein Ehrgeiz galten der Schauspie- lerei. Genährt durch die Hoffnung, die mir wieder Lina Wertmüller gab: Sie hatte auf mich eine Option für die Monate Juli und Au- gust. Gerade als ich auf dem internationalen Modemarkt wieder ge- fragt war, rief mich mein Fümagent Fernando an: »Urs! Das ist jetzt wirklich deine große Chance! Liliana Cavani will dich. Du sollst einen Tunesier spielen.« Einen Tunesier? Meine Mutter ist Innerschweizerin, mein Vater Nigerianer! Egal. Ich zog mich so an, wie ich mir vorstellte, dass ein Tunesier in Paris rumlaufen würde: Béret, blauer Blazer, weiße Hosen, die ich in Cowboystiefel steckte. Und dann nahm ich auch noch meinen H u n d Xtazy mit. Liliana Cavani musterte mich. »So, Sie sind Urs«, meinte sie. »Ich habe Sie mir anders vorgestellt.« Meine Kleiderwahl war zu grotesk. Liliana Cavani gab mir die große Rolle nicht. »Ich biete Ihnen eine kleinere Rolle an. Drei, vier Drehtage.«
- 1 1 2
- Heute weiß ich. Signora Cavani hatte recht! Ich präsentierte mich als ein Chamäleon: Mode am Körper, Film im Kopf. Es stimmte wirklich nichts mit mir - und meinem Kontostand! In jenen Tagen bekam ich einen Brief vom Lausanner Konkursamt. Darin wurde ich an meine Zeit als Chef des Model-Ensembles Xtazy erinnert. Da stand schwarz auf weiß, ich könne alle meine Forderungen gegenüber meinen Geschäftspartnern in den Wind schreiben. Genau: 387566.66 US-Dollar! Das waren rund 848 000 Schweizer Franken! Rechnen wir alle Spesen dazu, so kann ich heute sagen: Ich habe eine Million Franken verloren. Eine Million! Doch wie sagte schon Ernest Hemingway, der Literatur-Nobel- preisträger, als er endlich das Geld für seinen Preis aus Stockholm erhielt: »Geld ist und bleibt nur bedrucktes Papier.« Als mich Liliana Cavani einige Tage später beim Fitting für die Nebenrolle in Cinecittä sah, meinte sie: »Du siehst ja total anders aus! Warum bist du nicht so zum Casting erschienen? Schade, ich habe erst vor drei Tagen die große Rolle besetzt. Trotzdem: Will- kommen am Set.« Ab in die Garderobe des Hauptdarstellers, der an diesem Tag nicht kommen sollte. Sie lag direkt neben dem Zim- mer der Produktionsleitung, und ich sollte dort warten, bis man mit mir alle administrativen Notwendigkeiten durchgehen konnte. Da öffnete sich die Tür, und der Hauptdarsteller Marcello Mastroianni kam doch. Lässig, eine Zigarette im Mundwinkel. »Ciao!«, meinte er und setzte sich, keineswegs überrascht, dass ich in seiner Garderobe saß. »Guten Tag, Mister Mastroianni«, stotterte ich auf Englisch. »Lass den Mister weg. Marcello reicht. Und? Welche Rolle spielst du?« Rolle? Ich? Da erzählte ich dem großartigsten Latin Lover der Filmgeschichte von meinem schlechten Auftritt beim Casting, dass ich überhaupt wie die Jungfrau zur Schauspielerei, dass ich ...
- 1 1 3
- »Alle fangen klein an«, unterbrach der Meister lächelnd und erzählte mir von seinen eigenen Erfahrungen. Wie er auf der Bühne eines römischen Studententheaters begonnen hatte. »Als mich Federico Fellini entdeckte, schickte er mich zuerst einmal wieder zurück auf die Bühne, in die Provinz sozusagen. Er kam und sah sich einige meiner Aufführungen an. Erst danach gab er mir meine erste Rolle.« Die Chance, mit einem der ganz Großen reden zu können, ließ ich nicht ungenutzt vorübergehen. Ich fragte Mastroianni: »Wel- che Art von Ausbildung würden Sie mir empfehlen? Was halten Sie von Method-Acting?« Schließlich wollte ich zeigen, was ich alles schon wusste, was meine ersten Unterrichtsstunden gebracht hatten. »Was meinst du damit?« Method-Acting kannte er nicht? »Du meinst, was heute die amerikanischen Schauspieler ma- chen? Sorry, davon halte ich nicht viel.« Er zündete sich eine wei- tere Zigarette an. »Die Schauspielerei ist Lügen, etwas Vormachen. Wer es beherrscht, kann sich sofort in jede Rolle steigern und sie authentisch verkörpern.« Wieder ein tiefer Zug aus der Zigarette: »Ich halte nicht viel davon, wenn ein Schauspieler sechs Monate lang ins Boxtraining geht, um dann eine Rolle zu spielen. Das ist kein Schauspiel.« Elegant, wie Marcello Mastroianni den Namen Robert De Niro umschiffte, der gerade in den Medien war, weil er sich auf seine Rolle als Jake LaMotta in »Raging Bull« genau so vorbereitet hatte. Was ihm nicht nur zusätzliche Kilos, sondern auch einen Oscar ein- brachte. Plötzlich flog die Tür zur Garderobe auf: »Komm, Marcello, wir gehen mittagessen!« Marcello stand auf, ging zur Tür und drehte sich zu mir um: »Hey, komm schon, hast du keinen Hunger? Wir gehen essen!« In diesem Stil ging es bei den Dreharbeiten weiter. Ich hatte nur eine winzige Rolle. Neben Marcello war auch die Hauptdarstelle-
- rn
- rin Eleonora Giorgi reizend zu mir. Und Tom Berenger kam wäh- rend der Dreharbeiten locker auf mich zu, war froh, jemanden zu treffen, mit dem er englisch sprechen konnte. Dann folgte mein großer Auftritt. Filmszene mit Eleonora und Tom. Beide gaben mir Tipps. Die setzte ich dann offenbar so gekonnt um, dass ich eine Großaufnahme erhielt, die nicht einge- plant gewesen war. Die Drehtage am Set von »Oltre la porta« machten mich glück- lich - und ich kriegte Appetit auf mehr. Viel mehr Filme. Endlich war auch unsere Wohnung im Parioli bezugsbereit, nobel, mit Dachterrasse und Aussicht auf den Park der Villa Bor- ghese. Zusammen mit meinem treuen Vierbeiner Xtazy entdeckte ich die Ewige Stadt von ihren schönsten Seiten. Als lebendiges Museum, in dem es sich gar prächtig leben ließ. In Rom entdeckte ich auch, was mir zu meinem Glück fehlte: der Führerschein! Den aber wollte ich nicht zwischen all diesen Fan- gios und Ferraristi machen, sondern daheim, in Altdorf. Zehn Tage lang nahm ich zu Hause täglich Fahrunterricht, be- kam einen Lernfahrausweis, musste zurück nach Rom, wo ich mir sofort einen Lehrer suchte. »Also, fahren wir los!« Ich lächelte: »Einen Moment bitte.« Ich passte sorgfältig die Sei- tenspiegel an. Noch bevor ich nach dem Rückspiegel griff, rief mein Fahrlehrer unwirsch: »Che cazzo, was machst du denn da?« »Ich stelle den Rückspiegel ein.« »Wie kommst du denn darauf?« Sein Tonfall zeigte mir deutlich, dass ihm bisher nie ein Fahrschüler untergekommen war, der däm- lich genug war, den Rückspiegel eines Autos einzustellen. »Mein Fahrlehrer in der Schweiz hat es mir beigebracht«, vertei- digte ich mich. Mein Gegenüber seufzte resigniert. »Hier sind wir in Italien. Du brauchst den Rückspiegel nicht. Hier fahren wir nach vorne, also schauen wir nach vorne - und vielleicht mal zur Seite.« Als ich endlich fahren konnte, mietete ich ein kleines Auto, um mit Xtazy an die Shows in Paris zu fahren. Und mit Jack, der gerade
- 1 1 5
- nichts zu tun hatte. Wir machten Station in Cannes, dinierten in Transvestiten-Clubs, feierten wie früher, gönnten uns ein Hotel an der Croisette. Doch irgendwie war der Zauber weg. Unsere Freundschaft bröckelte. In Paris wurde Xtazy von Hubert de Givenchy höchstpersönlich in seinen Showroom geladen. Das kam so: Bei einem Fitting muss- te ich schnell mal raus, meinem H u n d frisches Wasser ins Auto bringen. »Wie bitte!«, sahen mich tadelnd die Augen von Givenchy an: »Den H u n d im Auto lassen? Das geht nicht, Urs. Hol ihn hierher.« So wurde Xtazy der wahre Star der Show. Und schaffte es wenig später, auf einer ganzen Seite in »Harper's Bazaar« verewigt zu werden. Wieder in Rom, kam ich zur einzigen Hausangestellten Roms, die einen eigenen Chauffeur hatte. Maria. Ein Glücksfall. Als Maria sich vorstellte, schwatzten wir kurz über dies und das. Bis sie sagte: »Unten wartet mein Chauffeur!« »Sie haben einen Chauffeur?«, fragte ich ungläubig. »Ja«, erwiderte sie schlicht. Und erzählte eine Geschichte, die es wahrscheinlich nur in Italien gibt. Marias Mutter lag lange in einem Spital, bevor sie starb; Maria besuchte sie täglich in ihrem Zimmer, wo auch eine ebenfalls schwerkranke alte Dame lag, welche ihrer- seits täglich von ihrem Sohn besucht wurde. So trafen sich die bei- den Kinder kranker Mütter ständig im Krankenhaus. Eines Tages bot der Sohn der Tochter an, sie jeweüs mit dem Auto mitzuneh- men. Als die beiden Damen starben, blieben ihre Kinder, beide um die sechzig Jahre alt, allein zurück, wurden Freunde. »Und seither fährt mich mein Avvocato zu all meinen Jobs. Und wartet im Auto auf mich.« Ich ließ Maria ihren Fahrer hochholen. Ungläubig schaute sie mich an: »Signore, das ist nicht üblich, das geht nicht.« Ich bestand darauf! Der Awocato brachte mir später bei, wie man beim Poker blufft, während Maria ihre Arbeit verrichtete. Dabei hätte sie überhaupt
- 1 1 6
- nicht arbeiten müssen! Sie hatte einen Riesenbetrag von einem Ver- wandten geerbt, der nach Amerika ausgewandert war. Aber sie war stolz, Hausangestellte zu sein und zu bleiben. Eifersüchtig war Maria schon. Als einmal eine Schweizer Freun- din bei uns übernachtet hatte, meinte sie hinterher: »Ich desinfi- ziere das Gästezimmer!« Auch die Schriftstellerin Charlotte Chandler besuchte uns in Rom. Sie kam auf Einladung von Federico Fellini, der wollte, dass sie seine Biografie schreibt. So trieb Charlotte sich täglich auf dem Set seines Filmes »E la nave va« herum. Dank ihr erhielt ich eine Art Vorstellungsgespräch beim großen Maestro des italienischen Films. Fellini war sehr höflich, zeigte sich interessiert an meiner Lebensgeschichte. Ich traute mich aber nicht, ihn auf mein selbst verfasstes Drehbuch mit dem Titel »Worldpassport« anzusprechen, da ich Charlotte nicht ausnützen wollte. Kurz darauf traf ich jedoch Fellinis Produktionsleiter, der von der Geschichte sehr angetan war und meinte, Fellini hätte sei- nen Spaß daran. Er stellte mir unentgeltlich den erfahrenen Autor Adrian Cook zur Seite. Dieser war von meiner Geschichte begeis- tert, gemeinsam verfassten wir einen Entwurf von 168 Seiten. In »Worldpassport« treffen sich der Papst und andere Herren der Welt in einem Café Roms; es ergibt sich eine irrwitzige Hand- lung, die ich hier aber nicht verraten will; zu leicht könnte man mir die Idee klauen. Wer weiß, vielleicht wird ja doch noch was daraus. Zwischen meinen kleinen Auftritten in Filmen und meinen Model-Jobs verbrachte ich viel Zeit in Valentinos Atelier an der Via Gregoriana, gleich oberhalb der Spanischen Treppe. Mein Arbeits- platz dort war, im Gegensatz zu den Filmsets, Luxus. Oft saß ich stundenlang in dem eleganten Salon und wartete darauf, dass ich gebraucht wurde. Das Warten machte mir nichts aus. Es war Ar- beitszeit. Ich arbeitete im Stundenlohn. Obwohl schon seit Jahren im Modebusiness, konnte ich bei Valentino noch viel lernen. Erstens, wie hart ein Modeschöpfer arbeitet. Valentinos Pensum war ungeheuerlich. Zweitens, wie eine
- 1 1 7
- Kollektion zustande kommt. Der Gruppo Finanziario di Torino, kurz GFT, der wie Fiat zum Imperium der Agnelli gehört, war ein Bollwerk an Macht und Einfluss in der Modewelt. Er hatte Desig- ner wie Valentino, Armani und Ungaro unter Vertrag, produzierte und verkaufte deren Kollektionen weltweit. In Turin hatte jeder Modeschöpfer eine eigene Abteilung. Valentino zeichnete also eine Kollektion. G F T stellte anhand der Entwürfe erste Anzüge her, brachte sie nach Rom und führte sie Valentino vor. Und da kam ich ins Spiel: Ich führte diese Anzüge vor! An mir wurden letzte Änderungen vorgenommen. An mir wurde entschie- den, welche Stoffe und Farben man nehmen wollte. Ich wurde gefragt, wie die Kleider saßen und ob ich mich darin wohlfühlte. Valentino war das Genie der Proportionen. Ich konnte einen Anzug tragen, den ich als makellos empfand, Valentino warf einen Blick auf mich, rief laut »No!«. Schon zupfte er ein wenig hier, ein bisschen dort: »Das hier - zwei Millimeter runter. Das da weiter nach rechts.« Er hatte immer recht. Ein absoluter Perfektionist. Auch als Geschäftsmann war Valentino eine Klasse für sich. Eines Tages meinte er zu mir: »Hol bitte deinen Anzug, den du heute Morgen privat getragen hast, damit ich dem Herrn von G F T zeigen kann, was ich unter Eleganz verstehe.« Dann wandte er sich den Herren zu: »Der Anzug ist aus einer meiner älteren Kollek- tionen.« Ein peinlicher Moment für mich und ihn: »Ah. Der Anzug ist von Yves Saint Laurent.« Valentino hob kurz seine Augenlider: »Urs, denkst du nicht, dass du unsere Kleider tragen solltest?« Frech konterte ich: »Maestro, in Paris erhalten wir Models Pro- zente.« Giancarlo schmunzelte, nahm den Hörer in die Hand, rief die Valentino-Boutique an: »Ab sofort bekommt Urs Althaus die gesamte Kollektion zum Einkaufspreis!« Oft lud mich Valentino auch zu sich nach Hause ein, in sein Haus an der Via Appia Antica. Wir diskutierten über Gott und die Welt
- 1 1 8
- und über Mode. Ich liebte seinen Koch. In ganz Rom gab es kein Restaurant, in dem man so gut essen konnte wie bei ihm. Valentino liebte seinen Beruf, die Mode und uns Models. Dass ich als Schwarzer unter Missachtung litt, verstand der Weltbürger nicht: »Das spielt keine Rolle mehr. Ich arbeite mit vielen schwar- zen Frauen, insbesondere Iman. Du bist nicht schwarz. Du bist ein universeller, moderner Typ.« Leider kühlte sich unser Verhältnis schon bald ab, nachdem ich am Tag vor Heiligabend - meine Mutter war gekommen, um mit mir Weihnachten zu feiern - von einem Assistenten Hals über Kopf zu Valentino bestellt worden war, um dann fünf Stunden lang herumzusitzen wie bestellt und nicht abgeholt; ich verlangte nicht nur den vereinbarten Stundenlohn, sondern auch eine Entschuldi- gung des Assistenten, die ich nie bekam. Ich hatte meinen Urner Dickkopf durchgesetzt und meine Einkommensquelle verloren.
- Actors Studio und kleine Rollen oder Ich, der Bogenschütze
- Während ich in den ersten Wochen des Jahres 1983 mit dem Dreh- buch beschäftigt war, erhielt ich eine schöne Rolle in dem Film »... e la vita continua« unter der Regie des bekannten italienischen Regisseurs Dino Risi, an der Seite von Schauspielerinnen und Schauspielern wie Béatrice Camurat, Renato Cestiè, Clio Goldsmith und Virna Lisi. Ich spielte den - natürlich schwarzen - Freund einer reichen - natürlich weißen - Italienerin. Meine Filmeltern waren schwarz,
- 1 1 9
- ihre weiß. Im Grunde ging es um ein gemeinsames Essen, bei dem sich pikanterweise herausstellte: Ihre Eltern waren ebenso strikt gegen eine Mischehe wie meine. Also eine Art »Romeo und Julia« der Hautfarbe. Bei unseren ersten Aufnahmen trommelte uns Dino Risi auf dem Set zusammen: »Also, ihr kennt alle den Film >Guess Who's Coming to Dinners Im Grunde geht es bei der Szene um dieselbe Geschichte.« Ich hob meine Hand: »Dottore, scusi, ich kenne diesen Film nicht.« »Was, du kennst diesen Film nicht? Du als Schauspieler?« Meine amerikanische Filmverlobte sah mich streng an, begann mir sämt- liche Fakten an den Kopf zu werfen: »1967, vom großen Stanley Kramer, mit Spencer Tracy in seiner letzten Rolle und Katharine Hepburn...« Ich reagierte entnervt: »Erzähl mir einfach die Story...« Dino ergriff das Wort, erzählte mir die Geschichte. Ein liberales Ehepaar wird in den Sechzigerjahren von den stürmischen Ent- wicklungen überrollt: Ihre Tochter bringt einen schwarzen Mann nach Hause, den sie zu heiraten beabsichtigt. Die Mutter (Katha- rine Hepburn) ist schockiert, ihr Vater (Spencer Tracy) noch mehr. Nach wenigen Sätzen war mir klar: »Dino! Ich kenne den Film doch. Ich mag ihn sehr - besonders wegen Sidney Poitier.« Sidney Poitier spielte den farbigen Liebhaber der weißen Toch- ter. Was folgte, war mir neu: Mein Film-Schwiegervater sprach ita- lienisch, seine Frau antwortete auf Französisch. Meine Freundin sprach englisch - ich stotterte auf Italienisch. Was mein Filmvater auf Französisch quittierte! Sagenhaft! In Italien ist es normal, dass Schauspieler in ihrer Muttersprache reden. Der Film wird später einfach synchronisiert. Richtig leben konnte ich nicht von diesen kleinen Rollen, aber mir war nicht bange. Ich reiste nach Paris. Wäre doch gelacht, wenn ich hier nicht wieder wie vor einem halben Jahr die großen Shows laufen würde.
- 1 2 0
- Doch ich wurde von niemandem gebucht. Ich haderte mit der Modewelt. Bis ich die Avenue George V runterlief, an der ich so- eben die Designer von Givenchy besucht hatte, und jemand mei- nen Namen rief. Es war Modedesigner Emanuel Ungaro. Spontan lud er mich in ein Café ein: Nein, eine eigene Männershow wolle er diesmal nicht machen. Aber Ungarns Produzent, der GFT, wollte an der Seine zumindest mit einem großen Stand präsent sein. Für die Einkäufer aus aller Welt brauche er dringend einen Mann, an dem seine Kol- lektion perfekt aussehen würde. Er wollte ein Topmodel für diese vier Tage. Nur: Diese seien entweder schon gebucht oder hätten eine Option. »Urs«, sagte Ungaro, »ich möchte dich. Aber du bist ja sicher schon für alle Shows gebucht!« Frech antwortete ich: »Emanuel! Wenn es für dich so wichtig ist, dann mache ich es! Obwohl - dann muss ich eben andere Shows absagen.« Ungaro war glücklich - und Sophie, meine Bookerin, verlangte ein gesalzenes Honorar. Da ich in letzter Minute dann auch noch von Lanvin und Givenchy gebucht wurde, war dies eine finanziell erfolgreiche Pariser Modewoche. Die Kollektion von Ungaro war ein so großer Erfolg, dass er sich kurzfristig entschloss, sie auch in New York zu zeigen. Als Dank für meine Hilfe in Paris ließ er mich dazu einfliegen. Und schon lief ich für ihn in New York. Bei den Proben traf ich Grace Jones, kicherte mit ihr über gemeinsame Nächte im »Studio 54«. Ihr da- maliger Freund Dolph Lundgren, Schauspieler, Model und Mus- kelpaket, eröffnete mit mir die Show. Bevor es losging, kam backstage ein junger blonder Mann auf mich zu. »Ich heiße Eigil. Ich bin Ihr Dresser und zu Ihrem Wohle hier.« Ich erklärte ihm, wo ich seine Hilfe brauche. Bei meinen Ellen- bogen, dem obersten Hemdknopf. Nach der Show kam Eigil auf mich zu, um sich zu verabschie-
- 1 2 1
- den. »Was, du gehst schon? Kommst du nicht auf die Afterparty?« Er lächelte: »Wir Dresser sind dort nicht eingeladen.« Also lud ich ihn ein. Er war witzig, charmant und wohlerzogen. Er studierte am Fashion Institute of Technology (FIT), in dessen Wohnheim er ein Zimmer hatte. Nach der Aftershow-Cocktailparty wollte ich den Abend nicht allein verbringen, obwohl ich am nächsten Morgen nach Istanbul fliegen musste. Wir gingen essen. Wir lachten, als würden wir uns schon lange kennen. Eigil war ein hübscher blonder Norweger, trinkfester als ich. Schließlich begleitete mich Eigil zu meinem Hotel. Ein letzter Drink. Dann gingen wir schlafen. Als ich aus der Türkei nach Rom zurückkehrte, war es mal wie- der so weit: Ich sprach mit Jack. Uber meine Zukunft. Uber Eigil. Der in mir eine neue Kraft weckte. Und Jack? Der bat mich, ihn doch meinem Schauspielagenten Fernando vorzustellen. Himmel! Wollte jetzt auch Jack Schauspie- ler werden? Irgendwie war das das Letzte, was ich hören wollte. Mir reichte es. Nach den vielen Niederlagen, den vielen Versprechungen, dem ständigen Auf und Ab in unserer Beziehung war es an der Zeit, mich auf eigene Beine zu stellen. Ich fand in Rom eine Wohnung für Xtazy und mich. An der Via del Corso, in einem kleinen Palazzo mit der Hausnummer 18, an dem ein Schild mit der Aufschrift »Goethe-Institut« hing. Ein Mann stand auf einer Leiter, hängte gerade eine Tafel auf: »Affit- tasi - Zu vermieten«. Mietvertrag per Handschlag! Die Wohnung war großartig, ein Loft, wie man es sonst nur in New York kennt. Bald rief Fernando an: »Ich habe wieder eine Rolle für dich. Nur einen Tag Arbeit, kein Text. Wichtig: Regisseur ist Fabio Carpi.« Die Story des Films »II quartetto Basileus« war damals so aktuell wie heute: Vier Musiker ziehen durch Europa. Als einer stirbt, macht sich ein anderer auf, die Vergangenheit des Freundes zu
- 1 2 2
- suchen. Und er entdeckt - ihr toter Freund hatte ein Doppelleben geführt, hatte seine Homosexualität allen verschwiegen. Ich spielte einen Escortboy. Mein Partner, der den Musiker auf Vergangenheitssuche mimte, war der großartige Franzose Michel Vitold. Mit ihm wartete ich auf meinen Einsatz und unterhielt mich blendend. Dann die Szene. Klappe! Die erste! Michel begann zu husten. Er hustete und hustete. »Bist du okay?«, fragte ich besorgt. Da brüllte Fabio Carpi: »Stopp! Verdammt noch mal, stopp! Urs, du bist ein Stricher - es ist dir völlig egal, ob er hustet oder nicht.« Michel schaute mich an: »Urs. Es geht mir gut. Ich spiele doch nur meine Rolle...« Dann die Wiederholung. Klappe! Die zweite! Michel begann wieder zu husten, als wolle er sich die Lunge aus dem Leib blasen. Da wusste ich, was für ein großartiger Schauspieler er war. Ich dagegen war nur ein Model, das gut aussieht, aber keine Ahnung vom Schauspiel hat! Am Abend rief ich Fernando an: »Ich bin kein Schauspieler! Ich bin nur ein Model.« Fernando antwortete schmunzelnd: »Gut, dass du es ansprichst. Ich habe dich bei einem der besten Schauspiellehrer der Welt an- gemeldet - Dominique De Fazio, der ehemalige Partner von Lee Strasberg und Mitglied vom Actors Studio. Da gehst du hin, zu ei- nem dreimonatigen Intensivkurs!« Zunächst aber war ich wieder Model. Im September in Paris. Bei Kenzo, bei Givenchy. Beim Fitting fragte mich Givenchy, ob ich aus meiner New Yorker Zeit nicht PR-Profis kenne, die ihm helfen könnten, seine US-Shows medial zu vermarkten. Also ließ ich meine alten Kontakte spielen und rief die beste PR-Frau Amerikas an, Michael Gifford. Givenchy wollte mir seinerseits einen Gefallen erweisen: »Kann ich dir vielleicht beim Film helfen?« Nach einer kurzen Pause dop-
- 1 2 3
- pelte er nach: »Du weißt ja, dass ich sehr gut befreundet bin mit Audrey...« Givenchy hatte alle Kleider Audrey Hepburns für den Kultfilm »Breakfast at Tiffanys« entworfen und wollte sich erkenntlich zei- gen. Ich machte jedoch von seinem Angebot nie Gebrauch. Kurze Zeit später war ich in der Türkei, diesmal als Schauspie- ler. Im Film »Das Martyrium des heiligen Sebastian« von P.etr Weigl. Michael Biehn spielte den heiligen Sebastian, Nicholas G a y den bizarren Kaiser Augustus. Ich war Anführer der Bogen- schützen. Nicholas machte mir Mut. So viel Mut, dass ich bis heute davon zehre. Zwischen Verhandlungen bei einem türkischen Teppich- händler meinte er zu mir: »Kannst du von der Schauspielerei so gut leben? Dir solche Teppiche kaufen? Ich nicht! Ich bin verheiratet habe Haus und Kinder.« Da gestand ich ihm: »Ich bin in Wirklich- keit kein Schauspieler. Ich bin nur ein Model.« Ich muss etwas bitter geklungen haben. Nicholas sah mich lange an, nahm mich in den Arm. »Sieh mich an, Urs«, meinte er. »Und jetzt wiederhole: Ich bin ein Schauspieler!« Er flüsterte mir ins Ohr: »Du bist ein Schauspieler, jeder der eine Rolle bekommt, ist Schauspieler. Egal, wie groß die Rolle ist.« Als ich Tage später die Szene als Chef der Bogenschützen per- fekt mimte, nahm Nicholas seine Augustus-Pose an - und reichte mir das Zepter Roms. Eine große Geste - für einen kleinen Schritt in mein neues Leben als Schauspieler.
- 1 2 4
- Südafrika, Iman, Only Black oder Unverstellter Rassismus hat Konjunktur
- Meine Agentur Elite offerierte mir einen Modeljob in Südafrika. Genau das Richtige, um mich abzulenken. Dort wurden gerade die ersten schwarzen Modezeitschriften gegründet. Das Elite-Büro in Johannesburg lud mich und Superstar Iman ein. Ziel der Agentur war es, Vorurteile gegen schwarze Models abzubauen, den neuen Zeitschriften erfahrene schwarze Models zur Verfügung zu stellen. Iman heißt mit vollem Namen Iman Mohamed Abdulmajid und ist heute mit Rockstar David Bowie verheiratet. Sie ist keine Stam- mesangehörige einer Nomadenfamilie im ostafrikanischen Busch, wie immer wieder geschrieben wird. Alles Erfindung! Iman ist Tochter eines sudanesischen Diploma- ten und einer Gynäkologin. Sie studierte an der Universität in Nai- robi, als der Fotograf Peter Beard sie entdeckte. Er brachte Iman zur Agentur Wilhelmina, präsentierte der Welt seine Neuentde- ckung. Kurz später war sie Topmodel, bekam bis zu 100 000 Dol- lar pro Auftrag. Mit Iman also sollte ich das neue Modezeitalter von Südafrika einläuten. Paris liebte ich, New York faszinierte mich, Rom war meine Oase und Lieblingsstadt - und Johannesburg? Schon meine Ankunft in Südafrika verlief, gelinde gesagt, pro- blematisch. Ich trug - »Kleider machen Leute« - einen Designer- anzug. Mein Gepäck steckte in Louis-Vuitton-Koffern.
- 1 2 5
- »Woher kommen Sie?«, fragte mich der blonde Zöllner in Johan- nesburg. »Aus Rom.« »Ihren Pass? Sie sind Schweizer?« »Ja. Sogar geborener Schweizer!« »Weshalb kommen Sie dann von Rom?« »Ich wohne in Rom.« »Ach, Sie wohnen in Rom! Und kommen hier mit einem One- Way-Ticket an!« Kurze Pause. »Mister! Sie können mit dem nächsten Flugzeug dahin zurück- fliegen, wo Sie hergekommen sind. Hier kommen Sie nur mit einem Riickflugticket rein - es sei denn, Sie beweisen, dass Sie genug Geld haben.« Ich zeigte ihm meine Bankkarten von der Credit Suisse. »Kenne ich nicht.« Er ließ mich stehen. Nach einer halben Stunde kam er mit zwei grinsenden Kollegen zurück: »Das ist er. Den schicke ich gleich zu- rück, der kommt bestimmt zum Einwandern.« Ich flippte aus: »Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Ich bin Schweizer! Warum um alles in der Welt sollte ich in dieses ras- sistische Land immigrieren?« »Du fliegst zurück!« Ich erklärte, dass ich Model und auf Einladung von Elite Johan- nesburg gekommen sei, um zwei Monate lang in Südafrika zu arbei- ten, und die Agenturbesitzerin hole mich höchstpersönlich hier am Flughafen ab. »Und? Wie heißt die?« »Penny.« Glücklicherweise hatte Penny eine Kreditkarte bei sich, die der Zöllner kannte. Sie kaufte mir ein Rückflugticket. Ich durfte ein- reisen. Es war Sonntag, die Innenstadt leer. Ich musste auf die Toilette. Endlich fand ich sie in einem kleinen roten Backsteinhaus. Doch
- 1 2 6
- seltsam: Es gab drei Türen. Über der ersten stand: »Only White«. Über der zweiten Tür, übersetzt: »Nur für Farbige und Asiaten«. Über der letzten Tür: »Nur für Schwarze.« Ich entschied mich für - »Only Black«. Und dachte: Was wäre wohl aus mir geworden, wenn ich hier aufgewachsen wäre und nicht in Altdorf? In der Innerschweiz? Penny, der gute Geist von Elite in Johannesburg, hatte mich nicht in einem Hotel untergebracht, auch nicht in einem Model- apartment: Die seien alle total überfüllt! Ich wohnte also bei ihren Eltern. In einem noblen, natürlich wei- ßen Vorort, in dem kein Schwarzer wohnen durfte. Nie vergesse ich, wie ich bei Pennys Eltern empfangen wurde. Angestellte standen Spalier, um mich willkommen zu heißen. Alle schwarz. Die Dame des Hauses musterte mich von oben bis unten, stellte sich und ihren Mann unwirsch vor, gab steif die Anweisung: »Bringen Sie das Gepäck von Mr. Althaus in das Gästehaus!« »Madame! Lanvin steht Ihnen sehr gut«, sagte ich, um das eisige Klima etwas aufzutauen. »Woher wissen Sie, dass ich Lanvin trage?«, fragte sie, freudig überrascht. »Nun«, erwiderte ich bescheiden, »das sieht man doch. Wissen Sie, ich laufe für Lanvin beinahe alle Pariser Shows.« »Hast du gehört?«, schnurrte sie ihren Mann an. »Er erkennt meine Kleider!« Penny lächelte mich verlegen an. »Bitte, Mami...« Als ich tags darauf im Pool meiner Gastgeber planschte, beob- achtete ich eine Gruppe schwarzer Arbeiter, die das Herrenhaus neu strichen. Irgendwie sah das unprofessionell und gefährlich aus. Die Arbeiter erinnerten an Zirkusartisten. Ohne Sicherheitsvor- kehrungen hangelten sie sich an der Fassade empor. Mit einer Hand hielten sie sich fest, mit der anderen strichen sie das Haus. Die Hausherrin brachte mir Eistee an den Poolrand. »Sie haben aber Mut, diesen Menschen ihr Haus anzuvertrauen«, sagte ich iro- nisch und deutete auf die Arbeiter.
- 1 2 7
- »Ja, ich bin froh darüber, dass Sie es so sehen wie wir.« Sie sagte etwas über »wie Tiere im Urwald« und »so gar nicht unsere Zivili- sation«. Dann: »Ich möchte Ihnen zu Ehren heute Abend eine Din- nerparty geben. Sagen wir um 20 Uhr zum Cocktail?« Der Cocktail wurde im frisch gestrichenen Haus serviert. Als ich pünktlich auf die Minute erschien, starrten mich alle Gäste an. Die Damen wohlwollend, die Herren gelangweilt. Ich entschied mich für den ganz großen Auftritt: Handkuss hier, ein Kompliment an die Dame da, fester Händedruck für die Herren. Als der Service für das Fünf-Gang-Menü begann, wurde ich wie- der angeglotzt. Kann der Neger überhaupt mit Messer und Gabel essen? Na, das wollen wir doch mal sehen! Ich hob mein Glas zu einem Toast. Ich bedankte mich für die Einladung und die Gast- freundschaft, machte nach einigen Bissen der Gastgeberin ein Kompliment: »Madame. Fast wie im >Maxim's< in Paris.« Aus einer der eingeladenen Damen platzte es heraus: »Aber... der ist und isst ja so wie wir!« Was wussten sie denn schon hier? In dieser Enklave des Ras- sismus? Also schilderte ich ihnen die Schweiz, Rom, Paris und New York in den schönsten Farben. Ich fühlte ihren Neid. Und legte nach. Berichtete den neuesten Klatsch vom Broadway, von der High Society Amerikas und meinen berühmten Freunden. Schließlich fragte ich: »Wo wohnen eigentlich die reichen Far- bigen? In diesem Quartier bin ich nur Weißen begegnet.« Betretenes Schweigen. Ein Mann meinte knapp: »Die wohnen auf einem Hügel. Hauptsächlich Araber aus dem Olbusiness.« Tags darauf wurde ich - wie jeden Ta^ - pünktlich auf die Mi- nute von einem Chauffeur abgeholt und in der Agentur abgelie- fert. In der Agentur freute ich mich, ein Mädchen zu treffen, mit dem ich vor kurzem in Zürich gearbeitet hatte, Sarah, eine Australierin. »Warum wohnst du nicht bei mir im Modelapartment, Urs?« Ich erklärte, dass ich bei Pennys Eltern wohne. »Da ist es wun- derschön!«
- 128
- So habe ich mich gefunden an diesem Donnerstagmorgen, dem 17. November 1977. Auf der Titelseite des druckfrischen »GQ«. ( I 'oto: John Peden für »GQ«)
- Für meine Mutter war ich Meine Großmutter hielt sich an die Gestalt ihrer Träume, Sehn- das Motto: »Lieber ein Kind auf süchte und Hoffnungen. dem Kissen als auf dem Gewissen.«
- Ich wurde groß, wie es in In meiner Kindheit und Jugend er- vielen Ländern nur sehr lebte ich kaum Rassismus, ich fühlte reichen Kindern möglich ist. mich hundertprozentig integriert. (Foto: Heidi Blatter)
- Meine Mutter hat seit dem Tag meiner Geburt alles für mich getan. Sie arbeitete hart, vor allem für mich.
- Werte wie Anstand, Benimm, Teilen lernte ich von meinen Vorbildern: Mama und Großvater.
- Ich war protestantisch erzogen worden. Am 26. März 1972 wurde ich konfirmiert. Meine Mutter war mächtig stolz auf mich. (Foto: Heidi Moretti)
- Mein Leben wäre anders verlaufen, hätte Mama nicht gesagt: »Urs, du kennst doch unser Modegeschäft Körner in Altdorf, die veranstalten eine Modeschau, mach doch mit.«
- Am 10. Oktober 1978 fand der Open Call von Xtazy statt. Im Broadway- Theater Mark Hellinger in Manhattan. Natürlich war Mama an diesem großen Tag dabei.
- Für Xtazy war nur Kaviar gut genug, sprich: die schönsten Models, beste Art-Director.
- Calvin Klein, der neue Star am US-Designerhimmel, buchte mich für seine erste Männerkollektion. (Foto: Arthur Elgort für Calvin Klein Inc.)
- Dank des Films »L'allenatore nel pallone« heiße ich bis heute von Como bis Reggio di Calabria nicht Urs, sondern »Aristoteles«.
- Im Film »Warbus«, einer Produktion über das Ende des gnadenlosen Dschungelkriegs in Vietnam, spielte ich eine der Hauptrollen.
- Die Stimmung am Set des Filmes »Der Name der Rose« war hervor- ragend. Als mir Sean Connery zum ersten Mal die Hand reichte, war das wie ein Ritterschlag.
- In den ersten Tagen, als ich als Farbiger mich auf dem Cover von »GQ gesehen hatte, glaubte ich: »Urs, du hast es geschafft!« Jahre später wusste ich: Ich hatte mich geirrt. (Foto: Knut Bry)
- Nadja machte mit meinem Modelleben Tabula rasa: Sie riss meine gesamte Foto-Karriere aus meinem Modelbuch. Und ich? Ich ließ meine Haare wachsen. Afro-Trend. Locken.
- Es war Wahnsinn. Gary war erst neunzehn Jahre alt, hatte seine Schule noch nicht abgeschlossen - und sein erster Kunde war Bloomingdale's. Wir gründeten Gary Gatys Ltd. (Foto: Heidi Moretti)
- Mein einziges Patenkind Dimitri (heute Landrat des Kantons Uri) seine Schwester Stephania und deren Windhund Balaika besuchte mich 1985 in Rom. (Foto: Heidi Moretti)
- Da ich in letzter Minute noch für Givenchy... (Foto: Givenchy)
- ... und Lanvin gebucht wurde, war dies eine finanziell erfolgreiche Pariser Modewoche. (Foto: Lanvin)
- Hinter meiner linken Schulter das Hotel Navarro, an der 112 Central Park South zwischen der Avenue of the Americas und der Seventh Avenue. Meine Nachbarn: Nurejew, Pavarotti und Beckenbauer.
- Auf dem Set von »Der Name der Rose« freundete ich mich mit Christian Slater an, der Adson von Melk spielte und damals schon der große Geheimtipp Hollywoods war.
- Junge Männer schinden ihren Körper, um auszusehen wie Marcus Schenkenberg, der für eine Veranstaltung nach Klosters kam. (Foto: Hervé Le Cunff für »Schweizer Illustrierte«)
- In unserem Haus mit Swimmingpool in den Pines auf Fire Island, direkt am Strand, verbrachten Jack und ich unsere freien Tage.
- In einem kleinen Palazzo Roms, an der Via del Corso, fand ich für meinen Hund Xtazy und mich ein Loft.
- Immer wieder zog ich mich in mein Haus nach Klosters zurück. Dort ging es mir gut. Klosters begann, meine zweite Heimat zu werden.
- Zwischen dem Cover von »GQ« und diesem Bild liegt eine Berg-und Tal-Fahrt von 31 Jahren. (Foto: Stephan Schacher)
- »Na, das gönn ich dir«, meinte Sarah. »Ich bin ganz allein in einer großen schönen Wohnung im 15. Stock.« Wie bitte? Ganz allein? Mir wurde doch gesagt: Die Modelapart- ments sind voll bis überfüllt. »Besuche mich! Ich grille was, wir liegen den Nachmittag über faul in der Sonne, im 15. Stock, trinken südafrikanischen Weißwein. Und abends gehen wir auf die Piste!« Am Wochenende ließ ich mich zum Apartmenthaus von Sarah fahren. Der Portier musterte mich erstaunt. Sarah empfing mich im Bikini, wir stiessen auf uns an, lachten, hörten Musik. Sarah stand am Grill. Da entdeckte ich gegenüber neugierige Gesichter in Fenstern und auf Terrassen, die zu uns hinüberschauten. »Sarah? Was ist da los?« »Keine Ahnung! Die gehen eben auch auf den Balkon bei der Hitze.« Dann klingelte es an Sarahs Wohnungstür. Atemlos keuchte der schwarze Portier: »Bitte, Sir! Wenn Sie nicht erschossen werden möchten, dann gehen Sie bitte nicht mehr auf den Balkon.« Mir ging ein Licht auf. In einer Gegend, in der nur Weiße woh- nen, kann kein Schwarzer sich in Badehose auf einem Balkon zei- gen - mit einer Weißen im Bikini. Auch das Abendessen in einem italienischen Restaurant hatte seine Tücken. Als Sarah und ich eintraten, wurde ich von oben bis unten gemustert - und stehen gelassen. Der Kellner wusste offen- bar nicht: Sofort rausschmeißen? Oder am Eingang aushungern lassen? Da stürmte eine illustre Gruppe in das Restaurant. Freudig be- grüßt vom Besitzer. Eine Dame lief strahlend auf mich zu: »Urs! Du hier!« Sie war Modelchefin einer Agentur, hatte mich erkannt, flüsterte mit dem Chef, schon sprach der italienisch mit mir, lud mich und Sarah zum Essen ein. Tags darauf fuhr ich zum Casting für die erste Show von Calvin
- 129
- Klein, organisiert von dessen südafrikanischem Importeur. Sagen- haft, wie viele schöne Menschen da in einer langen Schlange stan- den, um einen Modeljob zu bekommen. Ich genoss mein Privileg, nicht warten zu müssen. Als ich in den Raum trat, traute ich meinen Augen nicht! War ich jetzt in Johannesburg? Oder auf dem Set eines Fellini-Films? Auf einem Thron saßen zwei unsägliche Gestalten: die Matrone hässlich, fett, überschminkt - der Bonze dickbäuchig, abstoßend. Und dazu ein Mops, der die beiden an faltiger Arroganz übertraf. Ein Wink des Wurstfingers: Frauen vor! Die ja, die nein. Ent- scheidung per Daumen. Hoch oder runter. Die schwarzen Models wurden gar nicht erst angeguckt! Warum auch! Sind doch eh Menschen zweiter bis dritter Klasse. Eine un- sägliche Demütigung. Von mir wollte der Mann zumindest mein Modelbook sehen. Einen Kommentar dazu gab er nicht ab. Ich war ja auch nur so ein Kannibale, so ein Schwarzer. Immerhin: Meine Fotos für Calvin Klein schienen ihn doch zu beeindrucken. »Boy«, hauchte er mir sabbernd seinen alkoholgeschwängerten Atem ins Gesicht. »Hast du überhaupt Erfahrung?« Nach einem weiteren Sabberer: »Boy! Woher kommst du?« »Ich arbeite in Paris für Saint Laurent, Givenchy, Lanvin, Kenzo, Cardin. In New York für Calvin Klein. In Italien für Armani, Valentino und andere.« Unerschrockenheit siegt? Nicht bei Rassisten! Ich bekam zur Antwort: »Boy! Ich finde deine Masche mit dem Akzent nicht schlecht. Aber sag mir jetzt ehrlich: Aus welchem Homeland stammst du?« Es kam noch besser. Der Fettsack lachte hämisch, versuchte mich wie einen abgerich- teten H u n d zu ködern: »Boy, hey, ich biete dir die Chance, an Süd- afrikas größter Show und der größten Modetour in unserem Land mitzumachen! Du darfst in den schönen Hotels wohnen! Und das sogar mit uns.«
- 1 3 0
- Nun platzte mir der Kragen. »Wirklich?«, meinte ich arrogant. »Sir, das bin ich gewöhnt. Ich wohne ausschließlich an besten Adressen. In New York wohnte ich mit meinem Hund im Hotel Navarro. Das Sie nicht mal kennen. Oder?« Er lief vor Wut rot an und schrie: »Es ist mir doch egal, wer du bist, was du machst! Ich will dich! Du bist gebucht. Basta!« »Danke, Sir, zu großzügig, aber ich nehme eine Buchung ent- weder an oder lehne sie ab. Ihre lehne ich ab. Für Sie arbeite ich nicht.« Basta. Auch sonst wurde ich mit Geringachtung konfrontiert: »Ent- schuldigen Sie«, schluckte Pennys Vater, ein Anwalt, eines Tages verlegen. »Ich war zufällig im Gästehaus, um Sie auf einen Drink einzuladen. Da habe ich Ihre Musikkassetten gesehen: Jacques Brei und Georges Moustaki. Diese Musik kann ich hier nicht bekom- men. Darf ich mir die Kassetten vielleicht ausleihen?« Seltsam. Die Kassetten hatten nicht offen herumgelegen. Auch die Ehrbezeugungen, die mir hier widerfuhren, waren widerlich. Bei Aufnahmen für eine Modezeitschrift, in Szene ge- setzt von einem weißen Fotografen, nannte mich dessen schwarzer Assistent ständig: »Boss!« Eines Abends erzählte ich Penny offen, was ich dachte: Dass der Himmel über diesem Land wunderschön sei, dass die südafrikani- schen Sonnenuntergänge atemberaubend seien, dass hier in Agen- turen und der Werbung enorm viel Kreativität stecke - aber wie traurig mich meine Erlebnisse in diesem Land stimmten. »Ja, das ist der Grund, weshalb mein Bruder dieses wunder- schöne Land verlassen hat. Und das ist der Grund, weshalb meine Eltern dich eingeladen haben. Aber sie lernen nur schwer. Sie muss- ten zuerst ihre Kinder verlieren, bevor sie es begriffen. Aber ich kann dir versichern, dass es hier viele Weiße gibt, die keine Rassis- ten sind, die alles daransetzen, Gleichstellung zu erreichen. Des- halb habe ich dich auch nach Südafrika eingeladen. Um den Leu- ten zu zeigen, was möglich wäre.« Es wurde ein glücklicher Abend. Zum ersten Mal traf ich auf
- 1 3 1
- schwarze Südafrikaner. Es waren Musiker und Tänzer - ich war von ihrer Lebensfreude, Ausstrahlung und Offenheit beeindruckt. Aber ich fühlte mich auch schuldig und schlecht. Sie hatten es so viel schwerer als ich. Ich teilte zwar ihre Hautfarbe, wurde in dieser Gesellschaft aber wie ein Weißer behandelt. Täglich wurde ich von einem Chauffeur gefahren, alles sehr privilegiert und abgeschirmt. Ich war ein Pro- tege der Weißen. Das war in diesem Land über Jahrhunderte an der Tagesord- nung: dass Weiße Schwarze wie Minderbemittelte behandelten. Oder als Stars. Ich hatte jedenfalls sehr schnell die Schnauze voll. Das wollte ich auch Penny sagen, in der Agentur, doch ich kam nicht dazu. Da das Faxgerät gerade eine Nachricht meiner Pariser Bookerin Eveline ausspuckte. »Urs, dringend Agentur anrufen!«, stand darauf. Eveline erklärte mir: »Du bist schon für acht Pariser Mode- schauen gebucht. Alles ist definitiv bestätigt. Wann kommst du zu- rück?« »Wann sind denn die Shows?« »In zwei Wochen.« »Okay, ich werde da sein.« Eveline zögerte kurz, dann sagte sie: »Chéri, da ist noch ein Pro- blem. Sophie und ich eröffnen unsere eigene Agentur und möch- ten gerne, dass du mit uns kommst.« »Natürlich«, erwiderte ich. »Wenn ihr geht, komme ich selbst- verständlich mit.« So läuft das nun mal. Es ist ein bekanntes Problem der Agentu- ren. Sie brauchen gute Booker, die einen guten Draht zu den Models haben. Wenn die Booker aber zu gut werden, so werden die Agenturinhaber abhängig von ihnen. Ein Model folgt seinem Booker, wohin er geht. »Gut, Chéri, ich sende dir ein Schreiben von unserem Anwalt. Du musst das sofort unterzeichnen und zurückschicken, damit ich deine Buchungen transferieren kann. Ist es okay, wenn ich dir einen
- 1 3 2
- Flug für Dienstag buche?« Ihre Agentur heißt heute Bananas und ist eine der bekanntesten in Paris. Ich legte den Hörer langsam auf die Gabel zurück und sah zu Penny hinüber. »Du verlässt uns wieder?«, fragte sie traurig. Ich nickte. »Bitte sei mir nicht böse, Penny. Paris ist im Moment einfach wichtiger für mich. Ich komme gern ein andermal wieder und helfe weiter. Aber nicht jetzt.« Penny umarmte mich. Ich hätte schreien können vor Erleichte- rung. Schon bald könnte ich der wunderschönen Hölle Südafrika entfliehen.
- Keine Schwarzen bei Dior, Schauspielunterricht, schwuler Indianer oder Begegnung mit Siddha Yoga
- Endlich wieder Paris, die Boulevards, die Cafés, die Gelben, die Schwarzen, der Café au Lait, die Weißen, die Clochards, die Armen, die Reichen. Endlich normal leben statt im Ghetto wie in Südafrika. Nach der Show von Pierre Cardin stürmte die Presseagentin des Modehauses Dior auf mich zu: »Urs, ich finde dich großartig auf dem Laufsteg! Schade, dass Dior keine schwarzen Männer bucht.« Dann vertraulich: »Weshalb kommst du eigentlich immer noch an die Castings für die Dior-Shows?« Ich lachte. »Nur aus Spaß an der Freude: Um mir all die Dior- Leute anzusehen, die mich immer wieder mustern und immer wie- der wegschicken. Eigentlich finden die mich ja toll, buchen dürfen sie mich aber nicht. Warum? Weil ich schwarz bin!« Und dann erzählte ich ihr ein Geheimnis: »Mal bin ich ja für Dior
- 1 3 3
- gelaufen. Für Dior-Pelz. Weil der Designer, ein Gott im Hause Dior, sich einen Dreck um die Rassenfrage kümmerte. Und wer, glaubst du, hat mir gratuliert?« »Karl Lagerfeld?« Ich lachte: »Besser. Viel besser! Prinzessin Caroline von Mo- naco!« Dabei gab es damals wirklich die schönsten und besten schwar- zen Männermodels. Ich erinnere nur an Renauld White, Calvin, Mario Van Peebles, Marion Womble und viele Talente, die ich im- mer wieder bei Castings traf. Weibliche schwarze Models, etwa Inian oder Beverly Johnson, hatten unser »schwarzes Männerproblem« nicht. Komisch, haben weiße Männer so viel Angst vor einem schwar- zen Mann. Sie nehmen sich eine schwarze Freundin oder Spielge- fährtin und werden von ihren Freunden bewundert. Nimmt sich aber eine weiße Frau einen schwarzen Mann, wird sie verachtet! Leichter als Dior gingen Lanvin oder Missoni oder Gucci mit der »Rassenfrage« um. Signor Missoni buchte mich nach einer Pariser Show für die Milano Fashion Week. Für Gucci konnte ich eben- falls zahlreiche Shows für Privatkunden bestreiten, etwa in Bot- schaften oder am Golfturnier in Crans-Montana. Mit Familie Gucci flog ich auch nach Hongkong und nach Tokio. Zuerst aber lief ich bei der spektakulärsten Show des Jahres: einer Modeschau im Flugzeug, um die erste Boutique auf 10000 Meter Höhe für die Fluggesellschaft Alitalia einzuführen. Uber den Wolken führte ich Valentino und Versace vor. In Hongkong besuchte ich Freunde aus alten Tagen: zum Bei- spiel Ursula Huber-Bruesch, die in jener lange zurückliegenden Theateraufführung in Altdorf, bei der ich den Mohrenkönig gespielt hatte, den Erzengel Gabriel gemimt hatte. Ursula wohnte mit ihrem Ehemann in Hongkong. Der war ebenfalls Urner und arbeitete für eine Schweizer Großbank. Ursula erzählte, dass einer unserer alten Schulfreunde, Marco Föhn, ebenfalls in der Stadt sei. Für Hongkong waren das überraschend viele Urner.
- 1 3 4
- Wieder in Rom, begann mein »Schauspiel-Intensivkurs« mit Dominique De Fazio, bei dem mein Filmagent Fernando mich ange- meldet hatte, nachdem ich ernsthaft geglaubt hatte, Michel Vitold ersticke an einem Hustenanfall, während er nur seine Rolle spielte. Zu meinem Erstaunen traf ich dort nicht nur fünfzig Schauspie- ler aus aller Welt, sondern auch Jack Aebischer. Nach Wallstreet, italienischem Bankenskandal, unserem Desaster mit dem Model- Ensemble Xtazy wollte mein Exfreund jetzt offenbar tatsächlich ins ernste Fach: die Schauspielerei. Dominique De Fazio, einst rechte Hand von Lee Strasberg, der in New York am weltberühmten Actors Studio Marilyn Monroe, Marlon Brando, ja selbst James Dean in die hohe Kunst der lebens- nahen Mimik eingeführt hatte, stellte zunächst klar, dass es im Schau- spiel keine »richtige« Richtung gebe. Er respektiere jede Art von Schauspielerei. Den Unterschied zwischen der herkömmlichen Art des Schau- spiels und dem Method-Acting erklärte er an einem Beispiel. Eine Teilnehmerin sollte sich zu einem Stuhl in der Mitte des Raumes begeben. »Stell dir vor, du bist Bergsteigerin und besteigst alleine einen Berg. Du bist nicht gesichert. Dieser Stuhl ist ein Felsvorsprung, auf den du dich mit deinem ganzem Gewicht stellen musst, um weiterzukommen. Du weißt, wenn er nicht hält, dann wird dieser nächste Schritt dein letzter sein - dann stürzt du zu Tode.« Tastend setzte sie ihren Fuß auf den Stuhl, Angst vor der Tiefe in den Augen. »Und? Woran hast du beim Spielen gedacht?«, fragte Dominique. »Wenn ich runterfalle, bin ich tot.« »Seht ihr, das war auf herkömmliche Art perfekt gespielt. Beim Method-Acting aber sagen wir: In solch einer Situation denkt man nicht. In so einer Situation fühlt, fühlt und fühlt man, bis man sicher ist, dass der Felsvorsprung hält. Für diesen Vorgang hat keine Spra- che der Welt ein Wort. Man fühlt einfach den Moment, so lange, bis sich aus der Erinnerung heraus eine Gewissheit bildet, bis man
- 1 3 5
- sich im Herzen ganz sicher ist. Und dann macht man den nächsten Schritt.« Der Unterschied war frappant. Eine andere Kursteilnehmerin warf mich von meinem Stuhl. Was wohl zu ihrem Spiel gehörte. Alles an ihr strahlte Kraft, Leben und tiefe Ruhe aus. In der Pause stellte ich mich ihr vor. Ich hatte noch nie so ein Strahlen in den Augen eines Menschen gesehen, eine derart unverbrauchte Natürlichkeit. Sie war jung, Amerikanerin und hieß Eva. Sie erklärte ihre Ausstrahlung so: »Oh, das ist mein >Innerself<!« Was bitte? »Das ist die Einheit«, meinte sie. »Wenn du mehr darüber wis- sen willst, kannst du nächste Woche mit mir in die Kirche kommen, an einen Kurs von Siddha Yoga. Zwei Swami kommen von Indien nach Rom.« Ich ging hin. Es war ein Einführungskurs, und er fand tatsäch- lich in einer katholischen Kirche statt. Siddha Yoga gehörte zu den sogenannten »new religious movements«. Als Basis für die Bewe- gung wurde der Hinduismus bezeichnet. Wer das Wort »Swami« in einem Lexikon nachschlägt, erfährt, dass es sich um einen hin- duistischen Ehrentitel handelt. Ich, der Protestant aus der katholischen Innerschweiz, fand es verrückt, dass die katholische Kirche in Rom es erlaubte, Menschen unter ihrem Dach in diese neue religiöse Bewegung einzuführen. Eva erklärte mir, dass die Siddhas eine uralte Tradition hätten und dass Swami Muktananda, der deren Wissen in den Westen gebracht hatte, von Rom akzeptiert werde. Als ich die anderen Kursteilnehmer sah, fühlte ich mich fehl am Platz. Mit all diesen esoterisch angehauchten Menschen, die lieber in Indien statt Italien gelebt hätten. Durch deren Adern floss rechts- gedrehtes Urwasser, durch meine Champagner. In Uri hatte eine Gruppe solcher Schöngeister in den Siebziger- jahren mein Lieblingshotel in Seelisberg belegt. Was zur Folge hatte, dass ich dort nicht mehr, wie als Kind, hoch über dem Urnersee
- 1 3 6
- meinen Eisbecher mit Schlagrahm genießen konnte. Bereits das nahm ich diesen Menschen, die mit indischen Klamotten in Uri herumliefen, übel. Nun war ich also mit einer Gruppe solcher Guru-Anhänger in einer römisch-katholischen Kirche gelandet und wartete auf mein »Innerself«. Ich setzte mich auf den Hintern, der nach wenigen Minuten schmerzte. Also streckte ich die Beine aus. Und Langeweile setzte ein. In der Pause stellte Eva mich den beiden Swamis vor. Einer war weiß, der andere schwarz. Abgesehen von ihren orangefarbenen Gewändern waren sie genauso normal wie ich, lachten, waren über- haupt nicht abgehoben. Heute weiß ich: Es war genau der richtige Moment, der mich zu Siddha Yoga geführt hatte. Was hatte ich denn schon? Kein festes Zuhause. Keine intakte Partnerschaft. Keine Familie, keine Kinder, ein Leben zwischen Flughäfen, Hotels, Bars, Filmsets. Nach einer Pause wurde meditiert. Die Swamis sagten: Konzen- triere dich nur auf einen Punkt, den Punkt, wo der Atem, den du einatmest, auf den Atem trifft, den du ausatmest. Die Welt um mich herum versank in Finsternis. Dann Farben. Plötzlich ein blaues Licht, das stärker und stärker wurde. Ein Gong. Meine erste Meditation war vorüber. Die Swamis winkten mich nach diesem ersten Kurs zu sich. »Nun, wie war deine erste Meditation?«, fragte der eine. Und ich erzählte alles. Eva, ungläubig: »Ach Urs, du Angeber, es kann nicht sein, dass du schon bei der ersten Meditation die blaue Perle gesehen hast.« Der schwarze Swami hingegen: »Es passiert sehr selten. Du hast wohl in einem anderen Leben schon Erfahrungen gesammelt.« Mir dämmerte, dass Meditation ein Weg sein könnte, mich in einen neuen Einklang zu bringen, indem ich lernte, Dinge, Vergan- genes, Ängste loszulassen und wieder auf meinen Instinkt zu ver- trauen, der mir auch erlauben würde, ein besserer Schauspieler zu werden.
- 1 3 7
- Kurz darauf rief Agent Fernando an. Er habe eine tolle Rolle für mich, in Giro Ippolitos neuem Film »Arrapaho«. Meine Rolle in dieser absurden Komödie: einen schwulen Indianer mimen. Himmel, nein! Beim Screentest forderte mich der Regisseur auf: »Beweg dich femininer! Sei tuntig!« Schließlich sagte er: »Das bringt nichts. Du bist nicht glaubwür- dig.« Nach einer kurzen Denkpause: »Weißt du was, versuch mal, Arrapaho zu spielen.« »Giro, ich bin ein Schwarzer. Kein Indianer!« »Komm morgen wieder, Urs. Dann drehen wir mit der weib- lichen Hauptdarstellerin, Tini Cansino, einen Screentest.« Am nächsten Tag hatte ich eine Perücke auf dem Kopf. Und alle am Set meinten: »Jetzt sieht der ja wirklich nicht mehr wie ein Afri- kaner aus.« Giro zupfte an meiner künstlichen indianischen Haarpracht und steckte mir eine Feder rein: »Jetzt bist du ein echter Indianer.« Ich bekam die Hauptrolle. In einer der ersten Szenen sollte ich auf einem Pferd auftreten. »Sag mir nicht, dass du nicht reiten kannst! Wir drehen einen Indianerfilm!«, sagte der Assistent, der mich abholte. »Als Kind ritt ich ab und zu auf Ponys ...« »Scheiße. Aber: Dein Pferd ist das ausgebildete Kinopferd Al- varo - das schaffst du schon!« Schon folgte die Anweisung: »Du reitest in vollem Galopp auf die G r u p p e z u . . . ziehst die Zügel. Alvaro stellt sich auf seine Hin- terbeine, du winkst deiner großen Liebe zu - sie kommt und springt zu dir aufs Pferd. Dann galoppiert ihr gemeinsam davon.« Jetzt konnte nur noch Method-Acting helfen, und die Medita- tion. Was hatte ich im Schauspielunterricht gelernt? Genau: In Al- varo sehe ich etwas Altbekanntes, Vertrautes! Also zurück in den Wohnwagen. Meditieren, konzentrieren, hof- fen und beten. Dann kam das unvermeidliche »Klappe! Action!«. Und - ich konnte reiten. Zumindest, bis mich Alvaro abwarf.
- 1 3 8
- Und dann, immer noch in diesem dicht mit Erlebnissen gespick- ten Jahr 1984, flog ich nach Brasilien, um dort in einem italieni- schen Film zu spielen, in dem ich wirklich absolut richtig besetzt war: als Fußballprofi in dem Streifen »L'allenatore nel pallone«. Ja - dank diesem Film heiße ich bis heute von Como bis Reggio di Calabria nicht Urs, sondern »Aristoteles«.
- Genialer Schuss ins Lattenkreuz oder Fußball ist Kino
- Als ich dem Lederball in Altdorf nachlief, ein kleiner Schwarzer mit großem Ballgefühl war, nach Basel ging, um später beim FC Zürich ein Profi zu werden - als ich lernte, wie man Fitnessübungen kor- rekt vortäuscht -, da dachte ich nie und nimmer daran, dass ich ein- mal in einem Fußballfilm mitspielen würde. So schreibe ich dieses Kapitel besonders gerne. Für mich und meinen Traum vom Pelé aus Altdorf. Und ich widme diese Zeilen allen, mit denen ich damals spielte, feierte und verlor. Und rufe allen zu: Kinder, Buben, Mädchen, Männer, Frauen - Fußball ist ein Spiel. Nicht Schach, wie es heute von Clubtrainern gelehrt wird. Nicht Philosophie, wie es heute von TV-Reportern hochgejazzt wird. Nicht Kampf, Krampf, Krieg. Fußball ist ein wunderbares Spiel. Mit so einfachen Regeln: Der Ball muss in das Tor rein. Wer es von den jeweils elf Kickern schafft, ist egal. Das Ziel ist immer das gleiche: Der Ball muss da rein! Wie durch ein Wunder kam ich zu einem Film, in dem es um nichts als Fußball geht.
- 1 3 9
- Der Film »L'allenatore nel pallone« von Sergio Martino ist eine Komödie über den italienischen Fußball. Der absolute Komödien- star Italiens, Lino Banfi, hatte f ü r die Hauptrolle des Fußballtrai- ners zugesagt. Und ich erhielt die Rolle des jungen brasilianischen Fußballtalentes Aristoteles. Diese Rolle war in zweierlei Hinsicht ein Geschenk: Erstens konnte ich während der Dreharbeiten mit meiner Vergangenheit als Fußballer abschließen, mit meinem großen Traum vom Fußball und meinem Scheitern. Zweitens wurde der Film in Italien wirklich Kult. Die Figuren des Fußballtrainers Oronzo Canä und des Spielers Aristoteles sind bis heute Legenden. Fast jeder Italiener kennt diese Geschichte. Sogar Fußballprofis und die italienische Nationalmannschaft schauen sich den Film immer wieder an. Er wird noch heute jedes Jahr zweimal im Fernsehen gezeigt. Gedreht wurde in Brasilien. Drei Wochen in Rio de Janeiro, im Maracanä-Stadion, das 1950 anlässlich der Fußballweltmeister- schaft eröffnet wurde und das mehr als 90 000 Menschen Platz bie- tet. Hier strahlen und singen die Leute, Mädchen in superkurzen Minis tanzen Samba auf den Sitzreihen. Es wird gelacht, geküsst, umarmt, musiziert. Ich durfte nach unten. In die heiligen Hallen, die Umkleideka- bine. Ich dachte an Pelé, den ich als Bub gesehen hatte, als er in Zürich spielte. Laut Drehbuch sollte mich Lino Banfi in einer Favela von Rio entdecken. Also drehten wir in einem Dorf - und die Dorfbevöl- kerung spielte mit. Der Fußballplatz? Eine Sandfläche ohne Tri- büne. Die Stimmung? Eindrücklich wie im Maracanä-Stadion. Brasilien war auch privat eine großartige Erfahrung. Morgens an der Copacabana war ich Brasilianer. Ich wurde angesprochen von Frauen und Männern, die mich einluden, mit ihnen zu schlafen oder nur einen Drink zu nehmen. Darunter waren auch deutsche Damen: »Schau dir diesen schönen knackigen Mann an. Solche Männer gibt es bei uns einfach nicht. Komm, den schnappen wir uns.«
- 1 4 0
- »Vielen Dank für das Kompliment«, sagte ich in meinem Deutsch mit Schweizer Akzent, »kommen Sie doch mal in die Schweiz. Da finden Sie nur Männer wie mich.« Zurück in Italien, bei den Dreharbeiten, spielte meine Film- Mannschaft gegen AS Roma, im Lazio-Stadion. Und da tauchten die Großen auf: Carlo Ancelotti, Francesco Graziani, Roberto Pruzzo, Luciano Spinosi. Schließlich die Szene, in der ich - der Brasilianer - einen Frei- stoß direkt verwandeln sollte. »Traust du dir das zu? Oder soll ich schneiden?«, fragte mich Regisseur Sergio Martino. »Ich verwandle direkt!« Wenn ich das nicht schaffe, lachen mich alle aus, dachte ich. Besonders die daheim in Uri. Der Ball lag da. Anlauf. In der Mauer vier Weltmeister. Ich schoß - übers Tor. Der nächste Versuch. Ancelotti aus der Mauer kam auf mich zu. »Du läufst zu gerade auf den Ball zu. Versuch es von links, fast parallel zum Ball.« Sagenhaft! Mein Ball landete im Dreieck zwischen Balken und Pfosten. Unhaltbar. Als ich später meinen Cousins in der Innerschweiz den Film zeigte, sagte Otti sofort: »Ha, Kino, was? Alles geschnitten!« Ich spulte den Film zurück. Auf Slow Motion. Um zu beweisen: null Schnitt! Genialer Schuss!« 2008 war ich wieder Aristoteles, ein gealterter freilich, als die Fortsetzung, »L'allenatore nel pallone 2« - zu Deutsch: »Ein Trai- ner im Chaos, Teil 2« - gedreht wurde. Regie führte wiederum Sergio Martino, der Komiker Lino Banfi in der Rolle eines naiven Trainers, der sich eigentlich schon aus dem Geschäft zurückgezo- gen hatte, war natürlich eine Idealbesetzung. Diesmal hatte ich das Vergnügen, die aktuellen Helden des italienischen Fußballs ken- nen zu lernen, die sich in dem Film selber spielten: Stars wie der schöne Luca Toni, der römische Herzensbrecher Francesco Totti, der beste Torwart der Welt, Gianluigi Buffon, der filigrane Turiner
- 1 4 1
- Goalgetter Alessandro Del Piero und der harte, aber smarte Alberto Gilardino.
- Eigil, Liebe, Sadomaso oder Der Maskenmörder von Manhattan
- Kurz vor Weihnachten rief mich Eigil in der Schweiz an. Wir hat- ten seit dem Abend, an dem wir uns in New York kennen gelernt hatten, regen Briefkontakt gehalten und auch öfters miteinander telefoniert. »Hey«, meinte er, »ich bin bei meinen Eltern in Norwegen. Es ist langweilig hier. Ich würde dich gern besuchen. Was meinst du? Hättest du Zeit für mich, wenn ich nach Heiligabend vorbeikom- men würde?« Ich überlegte gar nicht erst. Ich fragte einfach: »Kennst du Rom?« »Nein«, meinte Eigil. »Also dann«, erwiderte ich, »lass uns gemeinsam nach Rom fah- ren!« Eigil landete am 25. Dezember 1984 in Zürich. Ich holte ihn ab, und wir fuhren, natürlich mit Xtazy, nach Rom. Unsere gemeinsame Zeit dort war fantastisch. Wir sprachen über unsere Leben, unsere Ziele, unsere Träume. Ich war in meinem bis- herigen Leben nicht vielen Menschen wie ihm begegnet. Wir ver- standen uns, konnten über dieselben kuriosen Beobachtungen lachen, fanden dieselben Dinge absurd, konnten bei denselben Themen ernst bleiben. Eine tiefe Freundschaft bahnte sich an. Eine Freundschaft, bei der Sex übrigens keine Rolle spielte.
- 1 4 2
- Eigil Vesti, wie er mit vollem Namen hieß, war ein durch und durch bodenständiger Typ mit guter Kinderstube, er war ehrgeizig und gradlinig. Er kam aus einer gutbürgerlichen Diplomatenfami- lie Norwegens und wollte es zu etwas bringen im Leben. Neben dem Studium am New Yorker FIT arbeitete er als Fashionstylist. Seine Wohnung teilte er dort mit einem New Yorker Modefotografen. Man musste ihn einfach gernhaben. Und so vertraute ich mich ihm an, was meine Gedanken zu mei- ner Zukunft als Schauspieler betraf. »Ich habe wirklich keine Lust, wieder nach New York zu ziehen. Ehrlich gesagt, fürchte ich mich beinahe ein wenig davor. Wegen Xtazy und allem, was passiert ist.« Eigils Antwort erstaunte mich - er schlug mir vor, mit ihm zu- sammenzuziehen. »Wir könnten uns eine Wohnung und die Kos- ten teilen. Du könntest bestimmt wieder als Model arbeiten, bis deine Aussprache gut genug ist, um dich in Amerika um Theater- oder Filmrollen zu bewerben.« Seine Worte fielen auf fruchtbaren Boden. »Okay, Eigil. Ich hab noch Dreharbeiten beim Film >Warbus<. Da spiele ich bis Februar eine Hauptrolle auf den Philippinen. Danach komme ich nach New York und wage einen Neustart.« Ich freute mich riesig und kündigte meinen Mietvertrag in Rom auf Ende März. Im Januar 1985 flog Eigil zurück nach New York, ich über Rom nach Hongkong und anschließend nach Manila. Als ich wieder in Rom landete, fand ich einen seltsamen Brief vor: Eigil schrieb mir, dass er leide. Sofort versuchte ich, ihn anzurufen. Doch niemand ging ans Telefon. Ich versuchte es immer wieder, doch selbst als ich die Wohnung in Rom aufgegeben hatte und in Altdorf darauf wartete, nach New York umzuziehen: Keine Ant- wort von Eigil. Hatte ich mich in ihm geirrt? Dann, endlich, ging jemand ans Telefon. Es war Eigils Mitbe- wohner, der Modefotograf.
- 143
- »Hallo Urs, schön, dich kennen zu lernen! Habe schon viel von dir gehört. Entschuldige, dass ich dich nicht zurückgerufen habe, aber ich bin auch erst seit zwei Tagen wieder in New York.« Er sagte es verhalten, mit Sorge in der Stimme. »Leider kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Wir vermissen Eigil. Wir wissen einfach nicht, wo er steckt.« Mir schwante nichts Gutes. Ein oder zwei Tage später rief er mich erneut an. »Urs! Bitte, bitte setz dich hin!« Dann atmete er tief durch. Ganz so, als könne er mir das gar nicht sagen, was er mir doch sagen musste. »Urs! Ich habe eine sehr schlechte Nachricht. Sie ... sie haben ihn gefunden.« Da wusste ich, dass Eigil nicht mehr lebte. Spaziergänger hatten Eigils Leichnam gefunden, verstümmelt und halb verkohlt, auf dem Grundstück der Familie LeGeros in Rockland County. Bereits durch den Fundort der Leiche war der damals 2.3-jährige Bernard LeGeros ins Visier der Polizei geraten. Als man die Schusswaffe bei ihm fand, mit der Eigil zweimal in den Hinterkopf geschossen worden war, schien die Sache klar. Der Fall schien gelöst. Einen Monat nach Eigils Tod wurde sein Mörder Bernard LeGeros gefasst und im Herbst desselben Jahres zu 25 Jah- ren Gefängnis verurteilt. LeGeros war zwar geständig, ließ aber auf »nicht schuldig« plädieren: Er sei nicht zurechnungsfähig gewesen und habe total unter Drogen gestanden. Dieses Verbrechen war aufgrund seiner grauenvollen Umstände und der Verstrickungen der High Society für die Presse ein gefun- denes Fressen. Es ging unter dem Schlagwort »Death Mask Mur- der« in die US-Kriminalgeschichte ein. Als man Eigil fand, so schrieb selbst die seriöse »New York Times«, war sein Kopf mehr oder weniger der einzige Körperteil, der noch an einem Stück war. Und dies auch nur, weil er in eine SM-Ledermaske gezwängt worden war, bevor LeGeros den Leich- nam angezündet hatte. LeGeros beteuerte, er habe unter Drogeneinfluss gestanden -
- 1 4 4
- und auf Befehl eines anderen gehandelt: auf Befehl von Andrew Crispo, seinem Boss. Andrew Crispo war ein prominenter und äußerst erfolgreicher New Yorker Kunsthändler, der es mit überdurchschnittlich gutem Aussehen, Redegewandtheit und Charme ganz nach oben geschafft hatte. Bernard LeGeros war in vielerlei Hinsicht sein Angestellter, sein Untertan. LeGeros beteuerte vor Gericht, er sei, im Gegensatz zu Crispo, nicht homosexuell. Doch LeGeros, Crispo und Eigil sol- len, laut Presse, alle in der sadomasochistischen Szene New Yorks verkehrt haben. LeGeros erklärte, sein Boss habe Eigil in dem berühmt-berüch- tigten New Yorker Nachtclub »Hellfire« kennen gelernt. Der Na- me dieses Clubs war Programm und ging auf das Jahr 172.5 zurück; damals hatten irische Aristokraten unter diesem Namen eine Satanskult-Vereinigung gegründet, die schon bald bekannt war für ihre Orgien: Da wurden Prostituierte als Nonnen verkleidet, sata- nische Rituale abgehalten, göttliche Huren gekürt. Crispo soll, laut LeGeros, den norwegischen Modestudenten in sein Apartment mitgenommen haben. LeGeros ging ebenfalls mit. In Crispos Wohnung wurden LeGeros und Eigil mit Drogen zuge- dröhnt. Ob sie die freiwillig nahmen oder nicht - wer kann das mit Sicherheit wissen? Der Einzige, der über die Tat berichtete, war LeGeros, der Mörder selbst. Gemäß seiner Aussage fuhren dann Crispo und LeGeros mei- nen Freund Eigil nach Rockland Countv, wo sie ihn fürchterlich missbrauchten, folterten und beinahe zu Tode quälten. LeGeros tötete Eigil schließlich mit zwei Schüssen in den Kopf. Danach verbrannte er die Leiche. Er tat dies, wie er immer wieder beteuerte, unter dem Einfluss der Drogen, die ihm sein Boss Crispo verabreicht hatte - und auf dessen Befehl hin. Bereits ein Jahr zuvor, 1984, war Andrew Crispo vor Gericht gelandet. Ein Mann hatte erklärt, er sei während einer Sex-und-Dro- gen-Party von ihm gefoltert worden. Crispo wurde freigesprochen.
- 1 4 5
- Wie jetzt wieder. Im Zusammenhang mit Eigils Ermordung lagen gegen Crispo, abgesehen von LeGeros' Beschuldigungen, keinerlei Beweise vor. Crispo seinerseits berief sich natürlich auf sein Recht, wonach ein Angeklagter sich nicht selber belasten muss. Und war aus dem Schneider, was für viele der eigentliche Skandal war. Und für mich ist er bis heute der eigentliche Schuldige. Wegen Steuerhinterziehung landete Crispo kurz darauf dennoch im Gefängnis. Eigil stand nach dem ganzen Verfahren und der Publizität des Falls als einer da, der ständig in SM-Clubs verkehrte, der freiwillig bei solchen Spielchen mitmachte, der regelmäßig Drogen konsu- mierte und den sexuellen Exzess suchte. Ich kannte Eigil. Ich wusste, dass damals viele Menschen in allen möglichen Clubs verkehrten, Clubs, in denen es durchaus eine SM- Szene gab. Das heißt aber nicht, dass all die Besucher dieser Clubs darauf abfuhren. Ich wusste, dass Eigil keine Drogen nahm. Oder besser: Ich hätte es wissen müssen. Diese ganze Berichterstattung ging nämlich nicht spurlos an mir vorbei. Ich begann zu zweifeln. Ich begann, Fragen zu wälzen. Hatte ich mich in Eigil getäuscht, ihn falsch eingeschätzt? Hatte ich mir unsere Nähe nur eingebil- det? War es naiv von mir, zu glauben, dass sich unsere Zukunfts- träume verwirklichen würden? Dass wir uns gegenseitig als Freunde unterstützen und uns in unseren Lieblingsstädten Wohnungen tei- len würden? Hatte er mich angelogen, als er mir in Rom versichert hatte, dass er keine harten Drogen nehme? Hatte er ein Doppel- leben geführt, von dem ich nichts wusste? Wie immer im Leben entdeckt man die Wahrheit spät, meist zu spät. Und die erfuhr ich nach einer der hippsten Shows in New York. Dianne Brill, die »Party-Queen von New York«, veranstaltete sie im angesagten »Palladium«, der neuen Superdisco, die nach dem »Studio 54« der zweite Geniestreich von Steve Rubell war. Kaum aus dem Gefängnis entlassen, hatte er wieder einen Nachtclub ge- schaffen, der die Reichen und Schönen in Scharen anzog.
- 1 4 6
- An der Show teilte ich meinen Kleiderständer mit dem neusten Superstar der Kunstszene: Keith Haring. Keith und ich mochten uns von der ersten Sekunde an. Leider starb der großartige Graf- fiti-Künstler 1990 an Aids. Doch viel wichtiger war eine andere Begegnung. Meine Dresse- rin, eine junge, hübsche Frau, kam mit leuchtenden Augen auf mich zu. »Du musst Urs aus Rom sein!« Sie war eine FIT-Studentin, eine Mitschülerin und Freundin von Eigil. Ich hoffte, von ihr die Antworten zu bekommen, nach denen ich so suchte. Eigils Freundin bestätigte mir, was ich im Herzen längst wusste: Dass ich den wahren Eigil kannte. Dass er ein fleißiger, ehrgeiziger Student gewesen war, weder an Drogen noch an sexuellen Exzes- sen interessiert. Dass er sich nicht in diesen SM-Clubs herumge- trieben hatte. »Er hatte große Pläne, wie wir alle. Ich war täglich mit ihm zu- sammen. Glaub mir, er war an Sex, Drogen und Partys nicht inter- essiert.« Plötzlich fing sie an zu weinen. »Ich mache mir große Vorwürfe.« Sie schniefte. »An dem Abend rief Eigü mich an. Irgendetwas bedrückte ihn, er fühlte sich einsam. Er bat mich, mit ihm auf einen Drink auszugehen, er brauche Abwechslung.« Tränen liefen über ihre Wangen. »Er rief nicht nur mich an, sondern noch mindestens fünf andere Freunde. Niemand von uns ging mit. Wir hatten doch Prüfungen und wollten alle lernen. Eigil wollte nur ein bisschen reden, Musik hören, für kurze Zeit auf andere Gedanken kommen. Er wollte doch nur kurz in den Club gehen. Aber wir sagten alle Nein, wegen der Prüfungen.« Ich nahm ihre Hand, wischte ihre Tränen weg. Innerlich weinte ich auch. »Weißt du, Urs, er hat wirklich intensiv nach einer Wohnung für euch zwei gesucht. Er konnte es gar nicht erwarten, dass du deine Dreharbeiten beendest und endlich nach New York ziehst.« Dann erzählte sie mir nochmals die ganze Geschichte. Den
- 1 4 7
- Tathergang, wie LeGeros ihn vor Gericht geschildert hatte. Wie sie Eigil gezwungen hatten, SM-mässig als H u n d zu dienen. Man nennt es »dog training«. Und wie LeGeros meinen Freund Eigil, immer noch als H u n d an der Leine, erschossen hatte. Eine Frage hatte mich die ganze Zeit nicht losgelassen: Was be- deutet Sadomasochismus wirklich? Natürlich wusste ich, dass sich die Menschen dabei nicht umbringen. Dass die Sache mit Eigil ein Verbrechen war, das jen- seits des in den einschlägigen Clubs Praktizierten lag. Dennoch wollte ich mir die SM-Szene mit eigenen Augen ansehen. So be- suchte ich einige dieser Clubs. Sah Menschen, die sich freiwillig anketten und regelrecht verprügeln ließen. Menschen, die ange- bunden am Andreaskreuz standen, mit verbundenen Augen und Gewichten an Hoden oder Brustwarzen, und sich mit Peitschen schlagen ließen. Menschen in Badewannen, die das erniedrigende Gefühl genossen, wenn jemand auf sie urinierte. Und Menschen, die sich, mit dem Kopf nach unten, aufhängen ließen und dann »fistfucked« wurden, Frauen wie Männer! Ich verurteile diese Menschen nicht. Weshalb auch? Ich bin of- fen und tolerant - und ich habe nichts gegen diese Szene. Solange Menschen freiwillig solchen Praktiken nachgehen und dabei die Grenzen ihrer Sexualpartner respektieren, mögen sie es tun. Wer aber Menschen zum Geschlechtsverkehr zwingt, egal auf welche Art, ist ein Verbrecher. Ich ging in diese Clubs, um mir die- sen Unterschied vor Augen zu führen. Den Unterschied zwischen Sex, der Gewalt aufgrund einer Vorliebe mit einbindet, und der Gewalt, jemanden zum Sex zu zwingen. Und ich stellte mir immer wieder mit Entsetzen vor, was Eigil in seinen letzten Stunden erlitten hatte.
- 1 4 8
- Der Actionfilm und der Vietnam-Veteran oder Das Leben ist kein Film
- All das Grauen, das Mörderische, das Brutale, Schreckliche ereig- nete sich in New York - während ich auf den Philippinen den Film »Warbus« drehte, eine Produktion über das Ende des gnadenlo- sen Dschungelkriegs in Vietnam. Die wenigen Uberlebenden einer Missionsstation retten sich in einem alten Schulbus. Tapferkeit und Mut kennzeichnen ihren Kampf gegen die ständig lauernde Gefahr, einen fast unsichtbaren Feind, der heimtückisch aus dem Hinter- halt zuschlägt. In »Warbus«, unter der Regie von Ferdinando Baldi, spielte ich eine der Hauptrollen, an meiner Seite der schöne Daniel Stephen, der es später zum Star in »Saturday Night Fever« brachte. Und Romano Kristoff, ein gebürtiger Spanier, der meist in Asien in B-Movies mitspielte und den schwarzen Gürtel eines Karatemeis- ters trug. Am ersten Abend in Manila empfing uns der pfiffige Produzent Alfred Nicola;. Zu uns drei Hauptdarstellern sagte er, wir könnten selber entscheiden, ob wir im Hotel oder aber draußen im Dschun- gel wohnen wollten. »Hier ist es angenehm und komfortabler«, meinte er, »aber drau- ßen wohnt die gesamte Crew. Die Schauspieler wohnen in einfa- chen, traditionellen Hütten. Euch Hauptdarstellern steht draußen ein gehobenes Haus zur Verfügung. Jeder hat drei Räume für sich allein.«
- 1 4 9
- Ich entschied mich gegen das Hotel. Schließlich wollte ich nicht jeden Morgen Stunden früher aufstehen, um von einem Chauffeur zum Set gekarrt zu werden. Tatsächlich lag der Schauplatz unserer Arbeit mitten im Niemandsland. Unweit unserer Siedlung gab es nur eine Hütte. Die lag auf einem kleinen Hügel und trug stolz ein Schild mit der Aufschrift »Restaurant«. Schnell lernte ich die anderen Schauspieler kennen. Romano mochte ich auf Anhieb, auch wenn wir zwei grundverschieden waren. Er war aus familiären Gründen bereits früh in die Ferne gezogen und hatte als Söldner in der französischen Fremdenlegion gedient, bevor er zur Schauspielerei kam. Alle Schauspieler - außer Daniel und ich - und alle Hilfskräfte lebten in ärmlichen Hütten, zum Teil hausten sie zu zehnt in einer Bude. Und das, obwohl diese Hütten wesentlich kleiner waren als meine, die ich allein bewohnte. Also bot ich Romano ein Zimmer bei mir an. Er winkte traurig ab. Auch Gwendolyn Cook, einer wunderbaren Schauspielerin, bot ich an, bei mir zu wohnen. »Ach, vielen Dank«, sagte sie lächelnd. »Das ist wirklich lieb von dir. Aber hier gelten halt eigene Regeln. Wenn ich dein Angebot jetzt an- nehme, leide ich dafür, wenn du wieder fort bist. Das Risiko will ich nicht eingehen. Schließlich bin ich auf diese internationalen Produktionen angewiesen.« Ich machte die Erfahrung, dass es auch hier Menschen erster und zweiter Klasse gab. Und dass ich - als aus Europa eingeflogener Hauptdarsteller - zur ersten Klasse gehörte. Ich lernte, was ich in Südafrika nie gelernt hatte: dass es auch bitter sein kann, zur ersten Klasse zu gehören. Auf andere Art, na- türlich. Nicht, dass ich in Asien hätte tauschen wollen. Aber Spaß machte es auf keinen Fall. Und ich muss wohl nicht extra erwäh- nen, dass die nichteuropäischen Kollegen, deren Rollen ebenso groß waren wie unsere, sehr viel weniger verdienten als wir. Mein Haus war wirklich wunderschön, wildromantisch. Von meiner Veranda aus hatte ich eine Aussicht in die Tief en des Urwal- des. In der Nacht verließen mich die romantischen Gefühle ziem-
- 1 5 0
- lieh schnell. Zwei glänzende Augen saßen hoch über mir auf einem Balken an der Decke und starrten auf mich herab. Ich, der ich doch im Film einen unheimlich mutigen US-Marine spielte, lag zitternd im Bett und zog mir das Bettlaken bis über den Kopf. Außerdem hatte ich Angst vor Schlangen. Ich beschloss, die Pro- duktionsleitung am nächsten Tag um ein Moskitonetz zu bitten. Wenn ich ein solches über mein Bett hängen würde, hätten nicht nur Insekten, sondern auch Rieseneidechsen mit glänzenden Au- gen, Schlangen und anderes Getier keine Chance, in mein Bett zu kriechen, während ich schlief. Nach dieser unruhigen Nacht stand ich auf und freute mich auf ein Frühstück, insbesondere auf eine Tasse heißen, starken Kaffee. Aber der mir zugewiesene »Butler«, ein Junge aus der einheimi- schen Crew, tauchte nicht auf. Komisch. Also ging ich auf die Ve- randa, um nachzusehen. Zu meiner Überraschung stand das Früh- stück dort, doch alles lag durcheinander. Es sah aus, als hätte es jemand hastig hingeschmissen und dann das Weite gesucht. Mein erster Gedanke war: »Der nette Junge hat Probleme damit, dass er einen Schwarzen bedienen muss.« Konnte das sein? Noch gestern war der Junge so stolz gewesen und war gemeinsam mit sei- nen Freunden vorbeigekommen, um sie mir vorzustellen. Da muss- te etwas geschehen sein. Ich beschloss, die Crew aufzusuchen und dort zu frühstücken. Als ich dem Produzenten Alfred Nicolaj erzählte, was passiert war, zitierte er den Jungen herbei und beschimpfte ihn. Nach eini- gem Hin und Her erklärte der Dolmetscher, der Junge weigere sich, mir noch einmal das Frühstück zu bringen. Und dann schilderte ei- sernen Morgen, so wie er ihn erlebt hatte: Der Junge hatte frühmor- gens bei mir an die Tür geklopft. Da sich nichts rührte, beschloss er einzutreten, um mich zu wecken. Und während ich auf meinem Bett lag und schlief, saß ein großer schwarzer H u n d auf meinem Fenstersims und starrte mich an. Als der H u n d den Jungen be- merkte, flog er einfach davon. Ich stutzte und wiederholte: »Flog davon?«
- 1 5 1
- Der Produzent lachte und rieb sich die Augen. Ich konnte nicht lachen. Der kleine Junge war verängstigt, absolut überzeugt von dem, was er gesehen hatte. Ich glaubte ihm und überredete ihn, mir die restlichen Mahlzeiten des Tages trotzdem noch vorbeizubrin- gen. Für die Mahlzeit frühmorgens könne er ja einen Freund schicken. Der Junge stimmte begeistert zu. Nach zwei Wochen harter Dreharbeiten verließen wir den Dschungel und zogen an einem anderen Ort in ein schönes Hotel. Alle in dasselbe. In der folgenden Zeit fuhren wir täglich zum Set. Eine Fahrt von drei bis vier Stunden. Wir drehten an der Meeres- bucht, an der Francis Ford Coppola »Apocalypse Now« in Szene gesetzt hatte. Da der Hollywoodstar alle Bauten hatte stehen las- sen, verfügten wir trotz unseres bescheidenen Budgets über eine eindrückliche Kulisse. Don Gordon Bell, ein amerikanischer Schauspieler in einer tra- genden Rolle, beeindruckte mich. Er hatte bereits in Actionfilmen wie »Apocalypse Now«, »Cambodia«, »Hunter's Crossing« oder »Final Mission« mitgespielt. Er war ein starker Charakter, ein wandlungsfähiger Mime, voller Kraft, mit einem gewaltigen Poten- zial. Vor allem war Don ein echter Vietnam-Veteran, der wusste, was Krieg wirklich bedeutete. Don war nach dem Krieg in Asien hängen geblieben. Er wollte nicht in seine Heimat zurück. Er war nicht über seine Erlebnisse hinweggekommen, konnte die Bilder in seinem Kopf nicht vergessen, die Geräusche, die ihn heimsuch- ten, nicht zum Schweigen bringen. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Kriegsveteranen war er bereit, über den Schrecken zu sprechen, den er erlebt hatte und der ihn für immer verändert hatte. Eines Abends kam er zu mir. »Hey, Kumpel. Willst du wirklich erfahren, wie es war in Vietnam? Damals? Was für eine Scheiße wir durchleben mussten, Tag für Tag?« Meine Kehle war trocken. Ich nickte. »Ja, Don. Gerne.« »Gut.« Irgendwie klang es anerkennend. »Ich hole dich um zwei Uhr ab.« Mitten in der Nacht berührte mich sanft eine Hand. Don stand
- 1 5 2
- neben meinem Bett. »Psst«, flüsterte er, »leise, Mann. Und lass das Licht aus. Man weiß nie, wo diese verdammten Schlitzaugen sich verstecken.« Leise zog ich mich an. Bekam von Don einen Holzstab in die Hand gedrückt. »Das ist deine M 16.« Draußen vor meiner Hütte drückte er mich an die Wand. »Bleib da stehen. Wenn ich dich zu mir winke, kommst du. Aber achte darauf, dass du auf die genau glei- chen Stellen trittst wie ich zuvor. Man weiß nie, wo die Minen sind.« Ich seufzte: »Der spinnt«, und drückte mich im Jahr 1985 - also zehn Jahre nach dem blutigen Ende des Vietnam-Krieges - an die Außenwand einer philippinischen Hütte, um mir vorzustellen: »Urs, jetzt bist du in Vietnam! Bist ein Amerikaner, der von seinem Präsidenten hierherbefohlen wurde, um die Südvietnamesen gegen die Kommunisten aus dem Norden zu beschützen. Und den Krieg zu gewinnen.« Das Lachen verging mir schnell, als ich durch den nächtlichen Urwald kroch. Grauenhaft. All die Augen! All die Geräusche! All die Bewegungen, die ich nicht orten konnte! Auch ohne echten, bis an die Zähne bewaffneten Feind war solch ein nächtlicher Ausflug unheimlich. Dabei musste ich ja nicht wirklich um mein Leben fürchten. Eine Viertelstunde später fürchtete ich um mein Leben. Don hatte mich ins Gras gedrückt, hinter einen Strauch. »Warte hier«, raunte er mir ins Ohr. »Ich gehe und erkunde die Gegend.« Er ging und ließ mich in dem dunklen Dschungel allein. Kehrte nicht wieder. Irgendwann begann ich, vor Angst zu schwitzen. Was, wenn mit dem Typ wirklich etwas nicht stimmte? Wenn er ernst- haft verrückt war? Urs, dachte ich wütend, wie konntest du nur so bescheuert sein? Dem sieht man doch an den Augen an, dass etwas nicht stimmt mit ihm. Der glaubt doch immer noch, im echten Krieg zu sein! Ich lag da, meinen Körper gegen ein Fleckchen Erde gepresst, das fremd roch, fremde Geräusche machte, sich fremd anfühlte. Ich war stinksauer. Und befürchtete, dass - falls Don doch kein Psyeho-
- 1 5 3
- path war und mich irgendwann da schon rausholen würde - mir irgendein Urwaldtier den Garaus machen würde. Eine Schlange vielleicht. Oder eine Raubkatze. Plötzlich löste sich eine dunkle Masse aus dem Baum über mir und fiel auf mich herab. Nein, sie fiel nicht, die Masse sprang. Es war... Don. Ich wusste nicht, ob ich mich freuen oder ihm eine feuern sollte. Auf jeden Fall war ich erleichtert. Don nahm mich in die Arme und meinte: »Urs! Du bist echt mutig.« »Don«, stieß ich atemlos hervor. »Spinnst du? Ich habe mir vor Angst beinahe in die Hose gemacht.« »Ja«, meinte Don, »was meinst du, was wir für eine Scheißangst hatten, damals in Vietnam? Damals war das kein Spiel.« Hatte ich schon früher jeden Krieg als die sinnlose Spinnerei von wild gewordenen Diktatoren oder Politikern betrachtet, bin ich seit dieser Nacht erst recht gegen Krieg in jeder Form. Ich hoffte sehr, dass Don eines Tages nach Hause zurückkehren würde. Nicht nur, weil ich überzeugt war, dass er das Zeug hatte, ein großer Hollywoodstar zu werden - auch weil ich mir sicher war, dass die Leute ihn in seiner wirklichen Heimat nicht als kaputten Amerikaner ansehen würden, der etwas Schlechtes getan, in einem schlechten Krieg gekämpft hatte. Ich glaubte, sie würden ihn und die anderen Soldaten, die ihrem Land gedient hatten, respektieren. Und sollte mich täuschen. Am nächsten Tag kam der Tod wirklich, unerbittlich und mit einem lauten Knall. Zunächst sah es nach einem wunderbaren Drehtag aus. Daniel, Romano und ich drehten eine Szene, in der wir einen Konvoi in die Luft sprengen sollten. Die, die unseren Anschlag überlebten, soll- ten wir mit unseren Maschinengewehren niedermähen. Wir Schauspieler warfen Granaten auf die zwei Jeeps, rannten über einen Felsen, brachten uns mit dramatischen Sprüngen in Sicherheit. Es war ein ausgelassenes Toben. Als wir die Szene im Kasten hatten, geschah es. Die lokale Crew drehte die Explosion. Keiner der Schauspieler war daran beteiligt.
- 1.54
- Wir waren ja die Stars. Und denen durfte nichts passieren. Schließ- lich wurden wir bestens bezahlt und mussten bis zum dramatischen Finale unverletzt alles überstehen. Lokale Laiendarsteller mimten die Männer im Konvoi, der gesprengt werden sollte. Irgendwo hatte sich ein Fehler einge- schlichen. Aus Unvorsicht, aus Gleichgültigkeit, aus purem Pech - ich weiß es nicht. Aus sicherem Abstand sahen wir, wie alles vor- bereitet wurde. Dann »Action«. Die Einheimischen warfen sich zu Boden, rannten - ganz wie es ihnen der Ubersetzer der Filmcrew gesagt hatte. Und wie sie es schon zweimal geübt hatten. Plötzlich schoss ein gewaltiger Feuerstrahl gegen den Himmel. Alle verharr- ten für den Bruchteil einer Sekunde fassungslos. Das war so nicht vorgesehen. Dann ein Urknall. Blech, Dreck flog durch die Luft - und einer der lokalen Laiendarsteller lag tödlich verletzt zwischen den Trümmern. Schauspiel und Wirklichkeit verschwammen auf grauenhafte Weise zu einem einzigen, blutroten Bild. Die Realität holt eben doch immer die Fantasie ein. Eine Tatsache, die ich in meinem Le- ben bis heute noch oft erkennen, ja erleben sollte. Aufgewühlt nach den Ereignissen mit dem toten Laiendarstel- ler, sprach ich mit Regisseur Ferdinando Baldi und dem Produzen- ten über meine Nacht im Urwald mit Don. »Warum hast du nicht früher etwas gesagt, Urs?« Ferdinando interessierte die Geschichte. Unter keinen Umständen wollte er nochmals einen Toten bei einem Dreh beklagen. Don erhielt zusätzlich zu seiner Rolle einen Job als Berater. Wovon der Film sehr profitierte. Es waren Kleinigkeiten, winzige Ungereimtheiten, die sich einschlichen, die Don sofort sah. Auch Gefahren, auf die er sofort aufmerksam machte. Weniger Fantasie als Wirklichkeit war etwas, was mir die ganze Zeit bei den Dreharbeiten auf den Philippinen aufgefallen war: Männer starrten ungeniert auf meinen Penis, sobald ich eine öffent- liche Toilette benutzte. Ich fand das unmöglich, begann, mich in den Kabinen zu verschanzen.
- 1 5 5
- Kurz bevor wir nach Hause flogen, lüftete sich das Geheimnis um diese Gelegenheitsspanner. Produzent Alfred Nicolaj hatte uns alle zu einer Party nach Manila geladen. Nach dem Fest saß ich noch mit zwei meiner Schauspielkolleginnen im Garten des Hotels, auf der Schaukel. Da sagte eine: »Du, Urs, darf ich dich etwas fragen?« Sie druckste herum, lief rot an. »Stimmt es, dass alle schwarzen Männer einen großen Penis haben?« Ich war überrumpelt. »Wie kommst du denn darauf?« »Nun, man hört es einfach oft. Und ich weiß es nicht. Es gibt... nun ja... es gibt hier eben nicht viele schwarze Männer.« »Nein, das stimmt nicht, dass alle schwarzen Männer, einfach weil sie schwarz sind, einen großen Penis haben.« Ich musste la- chen. »Darf ich jetzt dich aber auch was fragen?« Ich erzählte ihr von meinen Toilettenbeobachtungen. N u n lachte sie. »Aber nein, die sind nicht schwul. Die sind neu- gierig! Die stellen sich genau dieselbe Frage, die ich dir eben gestellt habe.« Schwul hin, schwnl her. Natürlich gibt es in Asien die wohl schönsten Transvestiten der Welt. Auf den Philippinen genießen diese Boy-Girls sogar einen gewissen Kultstatus, und es gab nam- hafte Politiker, die wegen Beziehungen zu diesen »Herren-Damen« zurücktreten mussten. Und genau auf einen Transvestiten musste einer meiner Filmkollegen reinfallen! Er hatte sie auf einer Late- Night-Party in Manila aufgegabelt. »Also, ich sage dir eines«, raunte ich ihm zu. »Die ist kein Mädchen. Die ist ein Transvestit.« »Urs... was du schon wieder weißt! Bist doch nur eifersüchtig!«, herrschte er mich an. Und nahm die grazile Bekanntschaft mit auf sein Hotelzimmer. Es kam, wie es kommen musste: Der gute Mann war zutiefst in seiner Ehre gekränkt, als sich in seinem Hotelzimmer die Dame als Herr entpuppte. Er schrie, tobte, warf sie aus dem Zimmer wie ein Stück Vieh.
- 156
- Dabei war sie eine der schönsten Transvestitinnen, die ich je gese- hen hatte. Ich kümmerte mich um sie und bettete sie in meiner Suite. Nicht im Bett, nein - auf dem Sofa.
- Leiden, saufen, Afrolook oder Verkatert zum Casting von »Der Name der Rose«
- Nach dem schrecklichen Tod von Eigil Vesti wollte ich es trotzdem alleine in New York versuchen, und Ed und Michael Gifford offe- rierten mir, bei ihnen zu wohnen, bis ich etwas gefunden hätte. Während sie mich mit einem Drink begrüßten, liefen im Fern- sehen die News mit der Berichterstattung über Eigils Tod. Michael war sichtlich erschüttert, als sie meine Traurigkeit bemerkte. »Was? Hast du ihn etwa gekannt?« Michael war perplex. »Die Presse sagt wirklich seltsame Dinge über ihn. Was war er für ein Typ?« Michael meinte, ich solle mit der »New York Post« sprechen. Mit Liz Smith, der Kolumnistin, die ich kannte. Dabei könne ich viel Geld verdienen, wenn ich ein paar Details verrate. Dabei könnte ich auch Eigils Image aufpolieren. Ihr Vorschlag war typisch New York. Knallhart. Ich weigerte mich. Ed Gifford quartierte mich umgehend in einem Hotel ein. Vielleicht hatte er sich im Kopf schon seine Pro- vision ausgerechnet. Jetzt wohnte ich gegenüber dem Townhouse der Giffords an der oberen Park Avenue. »Du kannst weiterhin zum Essen kommen. Um 20 Uhr.« Ich ging nie mehr hin.
- 1.57
- Stattdessen ging ich am selben Abend, um meine Enttäuschung und Trauer nicht in Alkohol zu ertränken, in den Siddha-Yoga-Ash- ram an der 234th West 86th Street. Ich fühlte mich so leer, orien- tierungslos, ohnmächtig. Meinen Neuanfang in New York wollte ich bewusst angehen. Ich wusste, dass ich es mit der Schauspielerei in Amerika versu- chen musste. Aber ich hatte Angst davor und wollte niemanden von früher treffen, meine Zeit als Model und die von Xtazy waren für mich tabu. Schon am nächsten Tag besuchte ich in South Fallsburg, Upstate New York, Gurumayi und Gurudev in ihrem Shree Muktananda Ashram und traf dort meine alte Bekannte Eva, die mich in Rom mit Siddha Yoga bekannt gemacht hatte. Eva schlug mir vor, bei ihr in New York zu wohnen, bis ich eine eigene Bleibe gefunden hätte. Ich war ihr unglaublich dankbar. So lernte ich auch ihre Mutter kennen, eine der erfolgreichsten Schauspieler-Coachs der Welt. Auch sie war mit Gurumayi eng ver- bunden - und mitverantwortlich, dass viele Hollywoodstars den Weg zu Siddha Yoga gefunden hatten. Ich fragte sie, ob ich mich beim Spielen nicht einfach auf mei- nen Instinkt, die innere Ruhe und auf Gott verlassen könne, ledig- lich dem Bauchgefühl bewusst zu folgen brauchte. Ihre Antwort war knapp: »Nein, Urs. Du brauchst die Technik, damit du am Set bei all den Wiederholungen die gleiche präzise Leistung spielen kannst. Nur dann kannst du auch von der Einheit profitieren.« Kurz darauf fand ich zum Wohnen ein kleines Studio gleich neben dem legendären Hotel Chelsea an der 23. Straße. Also: Keine alten Freunde um Hilfe bitten. Nicht rumhängen, keine Clubs besuchen. Stattdessen die Alternative: arbeiten. Schon kümmerte sich Nadja um mich, die mollige Starbookerin von »Click«, die daran war, ihre eigene Men-Agency zu gründen, gema- nagt von ihrer Einzimmerwohnung aus. Dank der ungemein sexy agierenden Agentin Nadja lernte ich in New?- York ein anderes Leben kennen: Rasta-People, Musiker aus Jamaika.
- 1.58
- Eine für mich neue Welt, an der East Side und im angesagten Tribeca. Da wuchs eine ganz neue Generation heran; sogar das Modeln als Beruf wandelte sich. Und Nadja machte mit meinem Modelleben Tabula rasa: Sie riss meine gesamte Foto-Karriere aus meinem Modelbuch. »Alter Schrott! Die Bilder will keiner mehr sehen!« Und dann: »Urs! Du bist genau der Typ, den junge, angesagte Fotografen wollen!« Und ich? Ich ließ meine Haare wachsen. Afro-Trend, Locken. Meine geliebten Designeranzüge ließ ich im Schrank. Streetwear war Trumpf! Die Berichterstattung über den Fall Eigil Vesti nahm kein Ende. Sie wurde immer geschmackloser und reißerischer. Gerade so, als gehe es hier nicht um reale Menschen, sondern um Zombies. Die man ganz schnell von diesem Erdball entfernen müsse. Ich brauchte enorm viel Kraft, um meinen Job als Model über- haupt ausüben zu können. Jeden Morgen stand ich um sechs Uhr auf, trank Kaffee, stülpte meine Kopfhörer über, nahm das blaue Gesangsbuch von Muk- tananda und sang die 182 Verse der »Guru Gita« auf Hindi - oder versuchte es zumindest. Danach eine Stunde Meditation. Dann Castings oder Jobs. Ich versuchte mich als Einheit mit dem Universum zu sehen und alles andere auch, inklusive Eigil und seiner Mörder. Nur: Irgend- wann trank ich meine Sorgen, Ängste und Verdrängungen weg. Verzweifelt versuchte ich zu verstehen, was da berichtet wurde, und begann, die berüchtigten Sadomaso-Clubs New Yorks zu besu- chen. Ich ertränkte den Wahnsinn, der mit Eigil passiert war, in Alkohol. Mein Leben dazu. Mehr Gläser, noch mehr Gläser. Diese Hoffnung, die mit zwei Schüssen in einen geliebten Hinterkopf zerstört worden war. Ein Leben mit Eigil, ein Neuanfang. In Rom, in New York. Ich war leer, orientierungslos, ohnmächtig. Hatte ein Nichts als Leben.
- 1 5 9
- Sturzbetrunken taumelte ich eines Tages nach Hause und öffnete gerade die Tür, als mein Telefon klingelte. Es war fünf Uhr mor- gens. »Hallo Urs, ich bins, Fernando.« »Was ist passiert?«, lallte ich. »Fernando! Es ist fünf Uhr früh hier in New York.« Fernando kicherte nur: »Das ist mir egal! Du musst heute Mit- tag unbedingt in eine Buchhandlung gehen. Kennst du >Der Name der Rose< von Umberto Eco?« »Wen? Wie?« Ich wollte nur ins Bett. »Was?«, schrie Fernando. »Du kennst das Buch nicht? Das ist ein Bestseller, ein moderner Klassiker.« Ich stöhnte. »Fernando, ich kann jetzt kein Buch kaufen gehen. Bin gerade eben von einer Party nach Hause gekommen. Und wie du wohl hören kannst, bin ich betrunken.« Nun wurde Fernandos Tonfall sehr bestimmt. »Dann nimm eine Dusche, trink viel Wasser und geh laufen, denn um 14 Uhr hast du ein Casting im Stork Club. Los, geh und hol dir einen Stift, ich gebe dir die Adresse durch.« Ausgerechnet der Stork Club! Ausgerechnet der berühmte New Yorker Club, in dem einst F. Scott Fitzgerald, Errol Flynn, Rita Hayworth, Ernest Hemingway, Marilyn Monroe und andere Hof hielten und ihre Gäste empfingen. Der Club, in dem der berühm- teste Klatschreporter aller Zeiten, Walter Wincheil, an einem Tisch saß und quasi frisch ab Quelle seine Informationen bekam. Ich stöhnte noch lauter. »Fernando, ich kenne den Stork Club, der ist im Hotel Navarro, wo ich jahrelang gewohnt habe.« »Umso besser. Der Regisseur Jean-Jacques Annaud sitzt gerade im Flugzeug von Los Angeles nach New York, um dich gemeinsam mit dem Produzenten Bernd Eichinger zu treffen. Kauf das Buch und lies es!« Jetzt klang er streng. »Fernando! Du kennst mich doch. Ich und lesen!«, wandte ich ein. Fernando lachte nur. »Keine Sorge, es ist ein ganz dünnes Buch.«
- 1 6 0
- Ich schlief mit dem Telefonhörer in der H a n d ein. Als ich um zehn Uhr aufwachte, wusste ich im ersten Augenblick nicht, was geschehen war. Dann fiel es mir wieder ein, und ich schreckte hoch. Das Buch! Ich sprang auf und rannte beinahe ins Badezimmer. Als ich mich im Spiegel sah, war ich auf einen Schlag nüchtern. Ich sah wirklich - man kann es nicht anders sagen - scheiße aus. Und ich zitterte am ganzen Körper. Na toll, dachte ich mir, das kann ja heiter werden. Ich duschte und machte mich dann auf den Weg in eine Buchhandlung. Natürlich hatten sie das Buch nicht. »Wir können es Ihnen bestellen, wenn Sie möchten.« Ich schüt- telte den Kopf. Dazu blieb nun wirklich keine Zeit. Schon in weni- gen Stunden wäre das Buch für mich völlig nutzlos. »Dann gehen Sie doch zu Rizzoli«, meinte der Verkäufer. »Die haben es vielleicht.« Bei Rizzoli stand es im Verkaufsregal. Und ich bekam einen Schrecken, als ich es sah. Von wegen dünn! Das war ja ein richti- ger Schinken! Zu Hause, als ich das Buch aufschlug, erschrak ich nochmals, und zwar heftig. Dieses dicke Buch war anscheinend für Intellek- tuelle geschrieben worden, nicht für halb betrunkene Schauspie- ler, die viel zu wenig geschlafen hatten. Nach vierzig Seiten gab ich den Kampf auf und beschloss, mich auf meinen Instinkt und Gott zu verlassen. Mit zunehmender Ausnüchterung wuchs nämlich meine Uber- zeugung, dass dies alles kein Zufall sein konnte. Schließlich fand das Casting im »Navarro« statt, wo ich zu meinen besten Model- zeiten gewohnt hatte, wo sich Aufstieg und Niedergang von Xtazy abgespielt hatten. Vielleicht würde das »Navarro« meinem Leben doch noch die ersehnte Wendung bringen? Als ich eintraf, wurde ich von den Kellnern erkannt und begrüßt. Ich bestellte Mineralwasser, obwohl ich lieber ein Bier getrunken hätte. Mein Kopf schmerzte, und ich fühlte mich schlecht. Als ich
- 1 6 1
- mein Wasserglas zum ersten Mal hob, sah ich zu meinem Entset- zen, dass meine H a n d unkontrolliert zitterte. »Was wird Annaud nur von mir denken?«, fuhr es mir durch den Kopf. Schon betra- ten Jean-Jacques Annaud und Bernd Eichinger die Bar, sportlich in Jeans gekleidet. Nachdem wir uns vorgestellt hatten, erklärte mir Annaud, um was es ging. »Wir haben alle wichtigen Rollen fantastisch besetzen können. Aber wir haben bislang Venantius einfach nicht gefunden. Es wur- den uns immer nur weiße Schauspieler vorgeschlagen, aber Ve- nantius ist im Buch ein Schwarzer. Übrigens, hast du das Buch ge- lesen?« »Na ja, ich bin losgegangen und habe es mir gekauft. Aber ich bin nicht über die ersten vierzig Seiten hinausgekommen«, erwi- derte ich ehrlich. Da lachte er herzhaft und meinte: »Nun gut, das kann ich wirklich verstehen.« Jean-Jacques musterte mich noch einmal eindringlich und meinte dann: »Würde es dir etwas ausmachen, mich auf einen Spa- ziergang in den Park zu begleiten? Ich möchte gerne sehen, wie du dich bewegst und wie sich deine Haut im Licht verändert.« Also gingen wir spazieren. Es war eine völlig entspannte Atmo- sphäre, und so fragte ich ihn, wie er denn auf mich gekommen sei. »Ach, weißt du, in Los Angeles haben sie mir einfach nieman- den vorgeschlagen, der meinem Bild des Venantius entsprach.« Er beobachtete mich durch seine H a n d hindurch, die er zu einer Röhre geformt hatte, wie eine Kamera. Und schweifte ab: »Venan- tius ist eine wichtige Rolle. Im Buch ist er tragend, da er indirekt dazu beiträgt, das Geheimnis zu lüften. Und wenn du die Rolle annimmst, verspreche ich dir, alles im Close-up zu drehen. Du hät- test einige schöne Momente. Und auch wenn du nur kurz im Film wärest - es ist dennoch die sechstgrößte Rolle.« Alles lief also gut, und es sah so aus, als hätte ich die Rolle auf sicher. Zurück in der Bar, bat Jean-Jacques den Kellner um ein Blatt Papier und einen Kugelschreiber. Dann reichte er mir beides und
- 1 6 2
- meinte: »Schreib doch bitte noch deinen Namen und deine Adres- sen auf - und was du bisher schon so gemacht hast.« Mist, dachte ich sofort, meine Hände zittern doch. Jetzt bekomme ich die Rolle nicht. Aber ich versuchte, mir meine Sorgen nicht ansehen zu lassen. Nahm den Stift und begann, langsam und konzentriert meinen Namen und meine Adressen aufs Papier zu bringen. Ganz vorsich- tig bewegte ich meine Hand, während ich den Kugelschreiber so fest hielt wie nur möglich. Ich wollte mein Zittern unterdrücken, aber es gelang mir nicht ganz. Und Jean-Jacques schien sich sehr dafür zu interessieren, wie ich schrieb. Er sah nicht weg und wartete darauf, den Zettel ausgehän- digt zu bekommen. Er lief die ganze Zeit wie ein Kameramann um mich herum. Da musste er das Zittern ja entdecken. Also ging ich in die Offensive: »Entschuldige bitte, dass ich so zittere. Aber ich war gestern auf einer Party.« »Das macht doch nichts«, meinte Jean-Jacques achselzuckend, »schreib einfach, so gut es geht.« Ich schrieb also weiter. Man konnte es bei dem Tempo beinahe nicht schreiben nennen. Ich malte Buchstaben. Plötzlich unterbrach mich Jean-Jacques. »Du brauchst nicht mehr weiterzuschreiben, Urs. Ich habe Venantius gefunden.«
- 1 6 3
- Sean Connery, Murray Abraham, Jean-Jacques Annaud oder Ich, der Mönch im Bluthottich
- Nun muss ich natürlich erzählen, um was es bei »Der Name der Rose« von Umberto Eco überhaupt geht. Denn später las ich den Roman doch noch. Die Handlung ist im Mittelalter angesiedelt. 1397 besuchen der Franziskanermönch William von Baskerville (Sean Connery) und sein Adlatus Adson von Melk (Christian Slater) eine Benediktiner- abtei in den einsamen Hängen des Apennin in Norditalien. Sie sind in kirchlicher Mission unterwegs, um zwischen Papsttreuen und Franziskanern die Frage nach der Rolle der Kirche im Spannungs- feld weltlicher Machtansprüche, des Sammeins irdischer Reichtü- mer und des christlichen Armutsgelübdes zu klären. Doch bevor sie mit ihren Vorbereitungen beginnen können, wird die klösterliche Ruhe durch rätselhafte Todesfälle erschüttert. Es wird den beiden Gästen sehr bald klar, dass hinter der gläubigen Fassade der Gemeinschaft mysteriöse, unheilvolle Dinge passieren und einige Mönche eines unnatürlichen Todes gestorben sind. Das Geheimnis scheint in der Bibliothek der Abtei zu liegen. Doch bevor William das Rätsel lösen kann, trifft die Delegation des Paps- tes ein. Zu ihr gehört auch der gefürchtete Inquisitor Bernardo Gui (F. Murray Abraham), der nun die Aufklärung der Morde in die Hände nimmt. Er überführt drei vermeintliche Ketzer, die nach der Folter auch geständig sind und auf dem Scheiterhaufen verbrannt
- 1 6 4
- werden sollen - doch da findet William in der Bibliothek die Lö- sung des Rätsels. Der greise Bibliothekar Jorge steckt hinter den Morden: Er hat ein verschollen geglaubtes Buch von Aristoteles mit Gift präpariert, weil er die darin vertretene Auffassung, Lachen sei gesund, für falsch hält. Jeder, der in dem Buch las, wurde beim Umblättern mit dem angefeuchteten Finger vergiftet. Und an diese ganze Ge- schichte erinnert sich der alt gewordene Adson, der die Geschichte erzählt. Kurz nach der Vertragsunterzeichnung wurde ich auf Kosten der deutschen Produktionsgesellschaft nach Rom geflogen - nur um mir eine Perücke machen zu lassen. Das war Teil des Vertrags, da die Dreharbeiten Monate dauern sollten und ich neben meiner Rolle als Venantius immer noch als Model arbeiten wollte - ohne den Mönchs-Haarschnitt, den ich mir für meine FÜmrolle verpas- sen lassen musste. Der italienische »Wig-Figaro« Rocchetti vollbrachte eine Meis- terleistung. Er fertigte mir eine absolut perfekte Perücke an. Nicht mal meine Mutter sah den Unterschied, als ich sie kurz in Altdorf besuchte. Die Innenaufnahmen sollten im Kloster Ebersbach im deutschen Rheingau stattfinden: Das labyrinthische Innere der Bibliothek wurde in den Cinecittä-Studios in Rom gedreht. Für die Außenauf- nahmen des Klosters wurde auf einem Hügel außerhalb von Rom eines der größten Sets der europäischen Filmgeschichte errichtet. Die Landschaftsaufnahmen entstanden in den Abruzzen nordöst- lich von L'Aquila. Also fand zu Beginn der Dreharbeiten im Kloster Ebersbach die Pressekonferenz statt. Wir saßen um einen hufeisenförmigen Tisch und warteten auf Jean-Jacques Annaud, Sean Connery und Murray Abraham. Als sie schließlich eintraten, wurden sie stür- misch beklatscht - von der Presse! Ich begriff auf einen Schlag den Unterschied zwischen einem Star und einem Weltstar. Sean Connery, den ich hier zum ersten Mal traf, war eine überaus beein-
- 1 6 5
- I Ii III keiule Erscheinung - er überstrahlte alle Anwesenden, sogar < hi ,iiy,ewinner Murray Abraham. Nin Ii der Pressekonferenz kam Sean Connery auf mich zu: I Iiiil du musst Venantius sein«, meinte er - und reichte mir die I l.uiil. »I am Sean...« I ·. war wie ein Ritterschlag. Mich, den kleinen Urs aus dem klei- ii. ii Altdorf, begrüßte kein anderer als der Inbegriff von James Um iil persönlich. Hei der Make-up-Probe wurde erst mal mein Haar geschnitten. Ii Mi in- ziemlich eigenwillige Form. Dann begrüßte mich Regisseur 11m11 Jacques Annaud. »Ich wollte dir noch was zeigen«, meinte er mii einem verschmitzten Lächeln und zog ein Stück Papier aus sei- iin I losentasche. »Na, was meinst du, wer das ist?« Ich sah mir die Zeichnung an. »Das bin ja ich!« ··Siehst du, das habe ich gezeichnet, bevor ich dich kannte. Ich ludle gerade die Filmrechte gekauft und skizziert, wie ich mir Vri im ii ins vorstelle. Deshalb konnte ich es beinahe nicht glauben, ¡ii*; ich dich in New York traf. In Los Angeles wurden mir nur weiße ( .esiehter vorgeschlagen, ich wollte aber einen Mohren! Die waren diltiuils die Intellektuellen. Und es ist ja gerade der Ubersetzer, der indirekt das Rätsel der Morde löst...« I Ii iil dann war es mein Zittern im Stork Club gewesen, fuhr Annaud fort, als er mich gebeten hatte, meine Adressen aufzu- schreiben. Genau so musste ich nach Drehbuch als Mönch Venan- lius, der das Buch entdeckt, zittern, um daraufhin zu sterben. ( i leich zu Beginn der Dreharbeiten stand eine wichtige Szene mit Sc.m Connery und F. Murray Abraham auf dem Programm. Ich wollte die Gunst der Stunde nutzen und bat Jean-Jacques, mich beim I )reh zusehen zu lassen. Ich war gespannt auf die Begegnung der beiden. Damals dachte ii Ii noch: Jetzt tritt James Bond gegen einen richtigen Schau- spieler an. Murray Abraham war gerade für seine Rolle in Milos I ; t H inaus »Amadeus« mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller des I iil li es ausgezeichnet worden. Ein großartiger Schauspieler.
- Ui(i
- Die Szene der beiden war der erste Dreh am Set. Spannung lag in der Luft. Murray Abraham verkörperte Kraft, schauspielerische. Ich hatte Gänsehaut! Himmel! Das war ein Schauspieler. Wie da wohl Sean reagieren würde? Dann war es so weit: Sean Connery musste antworten. Dabei sah er Murray mit einer solchen Intensität an, dass es anscheinend nicht nur mich aus dem Konzept brachte, sondern auch Murray. Der ver- gaß prompt seinen Text für einen Augenblick. »Lasst die Kameras laufen!«, rief Murray, konzentrierte sich kurz und begann von neuem. Welch großartige Profis! Als ich Jean-Jacques auf dieses Erlebnis ansprach, reagierte er lakonisch: »Ja, ja. Sean ist wie das Lenkrad eines Rolls-Royce: Rea- giert sofort!« Bald siedelte das Team nach Italien um, etwa sechzig Kilometer von Rom entfernt. Das Open Set war schlicht gigantisch. Seit »Ben Hur« hatte es kein größeres gegeben, und ich war überwältigt, als mich mein Chauffeur in dieser hügeligen Landschaft der Abruzzen auslud. Da stand eine Karawane von Wohnmobilen. Alles sah aus wie eine riesige Bühne von hinten, ein überdimensionales Bauwerk, das von Gerüsten gestützt wurde. Als ich die Sache jedoch aus dem richtigen Blickwinkel betrach- tete und zum ersten Mal durch das große Eisentor auf das Set schritt, lief es mir eiskalt über den Rücken. Ich fühlte mich in ein anderes Zeitalter versetzt. Ja, genau so hatte ich mir das Kloster vor- gestellt! Der Innenhof war der Buchvorlage getreu nachgebaut worden. Die Kirche, die Kirchentreppe, die Bibliothek, der Turm, der Brunnen - alles stimmte. Als ich das mir zugewiesene Wohnmobil erreichte, saß dort ein dicker Mann, der mich auf Englisch begrüßte - mit starkem öster- reichischem Akzent. »Helmut Qualtinger«, stellte er sich vor. Und freute sich, dass auch ich Deutsch sprach. »Ich hoffe nur«, meinte der grandiose Wiener Kabarettist, Schauspieler, Schriftsteller und Allein Unterhalter mit einer schwer- fälligen Handbewegung zum Kühlschrank hin, »dass du nichts mit-
- 1 6 7
- gebracht hast. Der Kühlschrank ist voll.« Er war tatsächlich voll- gepackt - mit Rotwein. Am Nachmittag drehte ich allein mit Sean. Genauer: Ich lag tot auf einem Untersuchungstisch, während Sean sich über mich beugte, um herauszufinden, woran ich gestorben war. Nur hatte die Produktionsfirma leider vergessen, die Wärmelam- pen aufzustellen. Ich lag also da - und war tot. Zuschauer denken oft, einen Toten zu spielen, sei ganz einfach und auch nicht anstrengend. Nun, da habe ich eine ganz andere Erfahrung: Du musst ganz flach atmen, damit man es nicht sehen kann. Du darfst nicht die winzigste Be- wegung zulassen. Du musst deinen Körper ganz schwer machen, darfst dich nur auf eines konzentrieren: Du empfindest nichts, absolut nichts. Wir drehten, bis Annaud abbrach: »Perfekt gespielt, Sean, genau so will ich es. Aber bitte ohne diesen Hauch Mitleid, ohne diese Besorgnis im Gesicht.« Da explodierte Sean Connery. Er fand es unmöglich, sich keine Sorgen zu machen, während ich bei diesen eisigen Temperaturen nackt auf einem Untersuchungstisch lag. »Ich spüre doch, wie er sein Zittern mit aller Kraft unterdrücken muss!«, schnaubte er wütend. Und schon beschloss er: »Ohne Wärmelampen drehe ich nicht weiter!« So schnell waren in Italien wohl noch nie Wärmelampen an Ort und Stelle. Und ich bekam von Connery eine Lektion: »Kein Film ist es wert, dafür seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen«, belehrte er mich. »Ich beispielsweise habe es in meinem Vertrag, dass bei Außenaufnahmen alle notwendigen Vorkehrungen getroffen wer- den müssen, um eine Erkältung möglichst zu verhindern. Das ist wichtig und bedeutet je nachdem nicht mehr, als mir warme Pan- toffeln für die Drehpausen zur Verfügung zu stellen.« Abends traf ich mich mit Murray Abraham zu Drinks in seiner Suite. »Urs«, fragte er, »kann es sein, dass du auch als Model arbei- test?« Als ich bejahte, klatschte er erfreut in die Hände. »Dann
- 1 6 8
- hatte ich also recht!« Zu meiner Überraschung kannte er viele mei- ner New Yorker Werbekampagnen für Kaufhäuser. Er liebte Mode und wollte alles über das Business wissen. Schließlich kamen wir wieder aufs Kino zu sprechen, und der Name Lina Wertmüller fiel. Da wurde Murray ganz aufgeregt. »Kennst du sie wirklich so gut?« »Ja«, erwiderte ich. »Weshalb?« Er hatte Lina schon immer kennen lernen wollen. Sie war eine seiner Lieblings regisseurinnen. Also rief ich Lina an, und sie kam uns besuchen. Zu einem lustigen Abend zu dritt, an dem ich als Übersetzer fungierte. Die Stimmung am Set mit so vielen erstklassigen Profis war her- vorragend. Fast jeden Abend nach dem Essen saß ich an der Bar, meistens mit Michael Habeck, Helmut Qualtinger und seiner char- manten Frau Vera, einer Wiener Burg-Schauspielerin. Helmut fand es toll, dass ich Schweizer war, und erzählte mir Geschichten über einen anderen Schweizer, seinen guten Freund Friedrich Dürrenmatt. Leider mussten wir Helmut nach solchen Abenden zu zweit aufs Zimmer bringen, stützend. Es war nicht nur der Wein. Helmut war sehr krank; er starb wenige Monate nach den Dreharbeiten zu »Der Name der Rose«. Schnell freundete ich mich auch mit Christian Slater an, der Adson von Melk spielte und schon der große Geheimtipp Holly- woods war. Kein Wunder, wie ich bei einem Drink mit seiner reizen- den Mutter Mary Jo Slater entdeckte: Sie war eine der erfolgreichs- ten Casting-Direktorinnen des amerikanischen Filmgeschäfts. Sie meinte: »Ruf mich doch an, wenn du wieder in New York bist! Ich habe da vielleicht eine tolle neue Rolle für dich, in einer ABC-Fern- sehserie. Irgendwie kann ich mir vorstellen, dass du da ideal rein- passt.« Der Tag, an dem man mich, den Mönch Venantius, tot und kopf- über in einem Bottich voller Schweineblut steckend, fand, war das einzige Mal, dass sich das gesamte Cast am Set versammelte. Ein Massenauflauf. Schließlich sollten alle dahergerannt kommen, um
- 1 6 9
- den loten Venantius zu beweinen. Ich freute mich nicht sehr, mich bei den winterlichen Temperaturen in den Bottich stecken zu las- sen, während alle anderen ihre wärmenden Kutten anbehalten durften. Als ich aufs Set kam, ragten zu meiner Überraschung bereits zwei Heine aus dem Fass, meine Beine. Es war tatsächlich eine Urs- Ali lians-Puppe angefertigt worden, in Lebensgröße. Ich war erleichtert, dass ich diese Szene bei der Kälte nicht sel- IK M ' spielen musste. Und vor allem, dass ich meinen Kopf nicht in dieses Fass stecken musste. Da kam freudestrahlend Jean-Jacques M 1 t 1 mich zu. »Siehst du, wie diese P u p p e im Fass liegt?« Ich nickte und wollte mich gerade bei ihm bedanken: »Genau so sollst du im Fass liegen.« Ich sah ihn ungläubig an. »I )u willst doch auch, dass es so echt wie möglich wirkt? Ich mag diese Puppe nicht. Du machst das viel, viel besser. Komm schon. Ich verspreche dir, dass wir das ganz schnell abdrehen.« I Jnd er hielt Wort, ich steckte wirklich nicht lange in dem Fass. Aber danach lag ich Stunden auf dem kalten Boden: Denn jetzt war ich ja der tote Venantius. Und immer wieder wurde mir kaltes Was- ser ins Gesicht gespritzt, ich wurde mit Make-up überdeckt, damit es aussah, als sei ich über und über blutbeschmiert. Nun, ich hielt durch. Und nachdem das »Rap!« ertönt war, dass der Dreh für heute abgeschlossen sei, kamen die Schauspieler ge- schlossen heran und gaben mir Standing Ovations für meine Ar- beil als Toter.
- I /()
- Gary, eigene Modelinie oder Mein Geliebter hat Aids
- Ich ahnte nicht, dass der Film »Der Name der Rose« später den Bafta-Award, den höchsten britischen Filmpreis, gewinnen würde, außerdem den Deutschen Filmpreis in zwei Kategorien und den französischen César für die beste Regie. Dass dieser Film, der gerade mal 17 Millionen Dollar gekostet hatte, in nur einem Jahr 77 Millionen Dollar einspielen würde. Als einmal die Dreharbeiten für vier Tage unterbrochen wurden, flog ich nach New York. Dort hatte Nadja ihre Ankündigung, eine Men-Agency aufzubauen, längst in die Tat umgesetzt. Sie wurde auf Anhieb ein großer Erfolg. Nadja blieb zwar in ihrer Eineinhalb- zimmerwohnung wohnen - ihr großes Fest zum einjährigen Beste- hen der Men-Agency aber sollte in zwei Tagen, im »Area«, dem jetzt angesagtesten Club des Big Apple, stattfinden. Als Nadja ihre Wohnungstür öffnete, mich da stehen sah und ich die Perücke, an die ich mich schon gewöhnt hatte, auszog, wandelte sich ihr sympathisches Lachen in hysterisches Kichern. Und flugs hatte sie eine Idee für mich: »Urs ! Genau so, mit dieser komischen Mönchsfrisur, gehst zu morgen zum Casting von Comme des Gar- çons - die buchen nur so grässliche Models, da passt du ideal hin. Da kannst du doch gleich etwas Geld verdienen, wenn du schon da bist... « Ich fuhr hin, mit der U-Bahn. Als ich an der East 14th Street ein- stieg, stach mir ein junger Mann ins Auge. Und ich ihm. Er hatte
- 1 7 1
- ein wunderschönes Gesicht und eine blonde lockige Haarpracht. Dazu war er sehr gut gekleidet. Der Termin bei der japanischen Designerin von Comme des Garçons ging schnell über die Bühne: »Sorry, deine Frisur passt wirklich nicht zu uns!« Egal. Abends feierte ich mit der New Yorker Modeszene auf Nadjas Party. Da traf ich viele alte Freunde. Nach einer wilden, durchfeierten Nacht kam ich morgens um zehn mit einem Date nach Hause. Mein Kühlschrank war leer, und wir hatten beide kein Bargeld mehr. Also machte ich mich auf den Weg zur FIT-Schule, die nur drei Blocks von meiner New Yorker Wohnung entfernt lag, um an deren Bankautomaten Bargeld zu beziehen. Kaum hatte ich die Eingangshalle betreten, kam ein junger Mann mit blonden Locken die Treppe herunter: Es war der Bur- sche aus der U-Bahn! Wir unterhielten uns kurz. Schließlich wartete zu Hause jemand auf mich. Er hieß Gary, studierte am FIT. Schon tauschten wir die Telefonnummern aus. Noch am selben Abend rief er an. Wir verabredeten uns auf einen Drink. Ich hoffte, dass er mir etwas über Eigil erzählen würde, wie es schon die andere Schülerin vom FIT getan hatte. Zudem fand ich Gary attraktiv. Sehr attraktiv. Wir trafen uns in Soho - redeten stundenlang. So lange, dass Gary keine Verbindung mehr nach Perth Amboy hatte, wo er mit seinen Eltern lebte. Der letzte Zug nach New Jersey war weg. Also bot ich ihm an, bei mir zu übernachten. Am nächsten Morgen drückte ich Gary, der für sein Modede- sign-Studium am FIT täglich von New Jersey nach New York fuhr, meinen Wohnungsschlüssel in die Hand. Ich musste zu den letzten Dreharbeiten von »Der Name der Rose«. Nach meiner Rückkehr aus Rom war es für mich wegen der Perücke ein Problem, in New York als Model zu arbeiten. Ich fühlte mich gehemmt. Dafür lief es privat sehr gut. Gary und ich kamen uns sehr nahe - es knisterte gewaltig.
- 194
- Schließlich rief ich Mary Jo Slater an. Sie hatte mir bei den Dreh- arbeiten zu »Der Name der Rose«, als sie ihren Sohn Christian besuchte, doch gesagt, sie wolle mich für eine ABC-Fernsehserie casten. Ich hielt alles für besprochen und abgemacht - unser Tref- fen für eine reine Formsache. Doch es kam anders. Behutsam sagte mir Mary Jo: »Du bist der erste Schauspieler, den ich für diese Serie nicht durchbringe. ABC findet es unglaubwürdig, die Rolle mit einem Schwarzen zu beset- zen.« Ich sah ihr an, wie peinlich ihr diese Absage war. Aber sie konnte nichts dafür. Sie hatte versucht, mich im rassistischen Amerika für eine Rolle vorzuschlagen, die nicht für einen Schwarzen vorgese- hen war. Sie bot mir an, mich dem Agenten ihres Sohnes Christian vorzu- stellen. So trafen wir uns am nächsten Tag an der 57th Street, in den Büros einer der größten Agenturen der Staaten: CAA, Crea- tive Artists Agency. Wir wurden sehr freundlich empfangen. Ich war beeindruckt, als ich sah, wen die so alles vertraten; viele der absoluten Superstars fanden sich in der Kartei von CAA. Neben der William Morris Agency ist CAA die mächtigste Film- agentur der Welt. Sie haben nicht nur die gefragtesten Schauspie- ler unter Vertrag, ebenso Drehbuchautoren und Regisseure. Was sehr viel Macht und Einfluss bedeutet, geht es um Besetzungen für große und vor allem teure Filme. Nach unserem Gespräch meinte der Agent: »Also, Mister Alt- haus! Ich lasse mir nochmals alles durch den Kopf gehen.« Dann gab er mir einen neuen Termin. Als ich eine Woche später zum zweiten Mal durch die Eingangs- tür der CAA trat, war ich ziemlich aufgeregt. Eine Aufnahme in diese Agentur? Das wäre wie eine Versicherung für meine Karriere als Schauspieler, wäre ein Durchbruch auf dem US-amerikanischen Markt. Aber die CAA wurde nie meine Agentur. Jedoch nicht aus «.lern Grund, den ich mir vorgestellt hatte. »Gratuliere, Urs!« Der Agent kam lächelnd auf mich zu und
- 195
- schüttelte mir die Hand. »Wir haben die Sache geprüft und uns ent- schieden, dich bei uns aufzunehmen.« Als er mir meinen Vertrag vorlegte, hatte ich das Gefühl, man könne mein Herz im ganzen Raum schlagen hören, so überwältigt war ich. »Lies den Vertrag einfach durch. Wenn du Fragen hast, dann stell sie.« Ich las den Vertrag durch, und meine Vorfreude wurde immer größer. Ich stellte mir vor, was die Unterschrift, die ich in wenigen Augenblicken unter dieses Papier setzen würde, für meine beruf- liche Zukunft bedeutete, als ich schließlich, ziemlich am Ende des ellenlangen Vertrages, auf eine Klausel stieß, die mich mit einem Schlag unsanft in die Gegenwart zurückholte: »Weltweit exklusiv«. Mein Blick blieb an diesen zwei Worten hängen: »Weltweit exklusiv«. »Stimmt etwas nicht?« Der Agent hatte meinen Blick bemerkt. »Nun«, ich räusperte mich, »es ist ein Problem für mich, mich weltweit exklusiv vertreten zu lassen. Wäre es nicht möglich, Ita- lien auszuschließen?« Er sah mich ungläubig an. »Warum denn Italien? Du brauchst das Land gar nicht mehr, wenn du erst mal bei uns unter Vertrag bist.« Ich versuchte ihm verständlich zu machen, dass ich es unmög- lich übers Herz bringe, Fernando Piazza den Rücken zu kehren. Er hatte mir alle meine bisherigen Rollen ermöglicht. Er hatte an mich geglaubt, mich unterstützt. Ich hatte ihm so viel zu verdanken, gerade jetzt, wo er mir die Rolle in »Der Name der Rose« vermittelt hatte. Nein. Ich konnte nicht illoyal zu Fernando sein! »Aber - es gibt doch sicherlich eine Ausnahme«, bohrte ich nach. »Nein! Du musst dich jetzt entscheiden. Weltweit exklusiv - oder gar nicht.« Ich unterschrieb nicht. Außer meiner Mutter verstand niemand,
- 196
- weshalb ich dieses außergewöhnliche Angebot ablehnte - um bei Fernando zu bleiben. Lieber kleine Brötchen backen, aber ehrenhaft. Nun schor ich meinen Kopf gleich mal ganz kahl, ließ die Haare gleichmäßig nachwachsen, ging in intensive Sprechlektionen bei Sam Chwat und flog zu den Pariser Shows. Wieder in New York, wurde ich schnell »Botschafter«. Nicht im wahren Leben, sondern für die NBC-Fernsehserie »Another World«. Sagenhaft, was Schauspieler in diesen Serien leisten müs- sen. An einem einzigen Tag werden zig Einstellungen gedreht, eine ganze Episode! Ich hatte bis zu zehn Seiten Text pro Tag - und war nicht mal Hauptdarsteller. Glücklicherweise kam am zweiten Tag einer der Hauptdarsteller auf mich zu. »Darf ich dir einen Tipp geben?«, fragte er freundlich. »Aber gerne«, erwiderte ich. Er grinste. »Du arbeitest wohl viel fürs Kino, das sieht man. Aber hier musst du auf andere Dinge achten. Wenn du sprichst, darfst du dich nur auf dein Gesicht konzentrieren. Nur das wird in Groß- aufnahme gefilmt. Wenn du das nicht machst und beispielsweise auf deine Hände siehst, mit Gesten oder Körpersprache arbeitest, dann bist du augenblicklich »off camera.« Das heißt? »Bei Soaps schneidet man bei jeder Extrabewegung sofort zum anderen. Du verlierst wertvolle Zeit! Was die anderen sehr freut. Es wird auch nur mit drei fixen Kameras gearbeitet. Beim großen Kino hingegen wird mit unterschiedlichsten Kamera- positionen gefilmt. Die Kameras gehen viel mehr auf die Arbeit des Schauspielers ein.« Interessant. Achten Sie mal darauf! Wenn ein Schauspieler sich auch nur ansatzweise mimisch in Szene setzen will - schon ist ein anderer im Bild. Kurz darauf rief mich meine Agentur an. Janet Jackson, deren Brüder samt Michael ich einst im »Studio 54« kennen gelernt hatte, wollte mich für einen Clip buchen. Allerdings: Janet wollte nur den gewerkschaftlichen Mindestansatz bezahlen.
- 197
- Ich sagte ab. Gary war entsetzt. Okay! Das war vielleicht ein Fehler von mir. Aber ich kann eben nicht über meinen Schatten springen! Dass ausgerechnet ein schwarzer Superstar einem schwarzen Model nicht mal clie übliche Gage zahlt - das werde ich nie verstehen! Und dann sprach Gary energisch mit mir: »Urs, du hilfst so vie- len Menschen. Kaum ruft jemand an, schon springst du los. Aber für mich machst du nichts.« »Wie bitte?« »Na, du könntest dir mal meine Entwürfe ansehen.« »Ja, aber die kenne ich doch alle. Ich sehe mir ja alle deine Zeich- nungen fürs FIT an.« »Die meine ich nicht. Ich meine die anderen Zeichnungen. Mei- nen Kollektionsentwurf.« Als ich die Zeichnungen sah, fiel ich last vom Stuhl. Gary hatte eine elegante Sportkollektion gezeichnet, in einem transparenten Jeansstoff. In den blauen Grundstoff war raffiniert Gold einge- woben. Der Stil erinnerte an Thierry Mugler, den neuen Stern am Pariser Modehimmel. »Hast du schon Musterstücke angefertigt?«, fragte ich ihn. »Klar, hab ich.« Er ging und kam mit zehn Musterstücken zu- rück. Ich griff zum Telefonhörer und rief »Women's Wear Daily« an - die Modebibel. Ich sprach nicht mit irgendeiner Redakteurin, son- dern mit Mister Fairchild persönlich, der mir aus meiner Zeit in Klosters bekannt war. Ich hatte ihn und seine Frau getroffen, als ich am 1. Januar 1981 mit meiner Mutter spazieren ging. Fairchild gab mir für den nächsten Tag einen Termin. Ich nahm die Entwürfe und drei der Musterkostüme mit. »Außergewöhnlich«, urteilte Fairchild. Und rief die verantwort- liche Redakteurin ins Büro: Die Kollektion wurde sofort fotogra- fiert. Das Unglaubliche geschah. »Women's Wear Daily« brachte eine ganze Seite über Garys Kollektion. Am Tag, als der Artikel erschien,
- 1 7 6
- rief die Einkäuferin von Bloomingdale's an. Sie wollte sich die Kol- lektion in unserem Showroom anschauen kommen. Peinlich be- rührt, erklärte ich ihr, dass ein Showroom nicht existiere. Noch am gleichen Tag fuhren Gary und ich mit dem Taxi zu Bloo- mingdale's, um die Dame zu treffen. Und sie bestellte. Es war Wahn- sinn. Gary war erst neunzehn Jahre alt, hatte seine Schule noch nicht abgeschlossen - und sein erster Kunde war Bloomingdale's. Nun, so schön das war - ich steckte in einem Riesendilemma. Der Film »Der Name der Rose« würde in Kürze in die Kinos kommen. Ich hatte eigentlich geplant, nach Los Angeles zu ziehen, um meine Karriere als Schauspieler richtig voranzutreiben. Aber was tat ich? Ich entschied mich für Gary und seine Kollektion. Wir hatten nicht das Geld, um die Kollektion zu finanzieren, aber seine Eltern halfen uns, nachdem ich ihnen versprochen hatte, auf meine eigene Karriere zu verzichten und dazubleiben, um mich um alles zu kümmern. Wir gründeten Gary Gatys Ltd. und trafen alle Vorkehrungen für den eventuellen Ausstieg einer der Parteien. Ich hatte ja mit Xtazy meine Erfahrungen gemacht und wollte diesmal alles sauber abklären, im Voraus. Ich hatte keine Lust auf einen zweiten Scher- benhaufen. Während Gary die Schulbank drückte, kümmerte ich mich um unser Geschäft. Ich fuhr zu einem Restposten-Grossisten an die Eastside, um genügend Stoff zu kaufen für die Bloomingdale's- Bestellung. Gary hatte diese Kollektion gemacht, um zu üben, nicht um sie zu verkaufen. Also hatte er seine Stoffe bei diesem Grossis- ten gekauft. Der Grossist verriet, dass es sich bei dem von Gary verwende- ten Stoff um einen von Burlington handelte. Also fuhr ich zu Bur- lington. »Sorry, wird nicht mehr verkauft.« Als ich ihnen die Geschichte von Gary erzählte, den Artikel von »Women's Wear Daily« zeigte und erwähnte, dass wir mit Bloo- mingdale's und Saks schon zwei Kunden hätten, bekamen wir die Stoffe.
- 199
- Ich lernte, wie man eine Damenkollektion produziert. So fand ich den besten Schnittmusterhersteller in New York. »Der macht auch die Muster von Ralph Lauren«, meinte ein Freund. Schnitt- muster sind das Fundament jeder Kollektion. Die Zeichnungen werden auf Karton so zugeschnitten, dass der Schneider Vorlagen für sämtliche Kleidergrößen hat. Bald daraufhatten wir zwei weitere Kunden an der Angel. Beides trendige Soho-Boutiquen. Gary, der sexy Blonde mit dem Engelsge- sicht, avancierte zu einem heißen Namen in der New Yorker Presse. Irgendwann gaben wir meine Wohnung auf und mieteten uns für dasselbe Geld in einem Showroom bei der 38th Street an der be- rühmten 7th Avenue ein. Es war ein Loft, das wir uns mit Jungde- signern wie Todd Oldham und Stüssy teilten. Wohnung hatten wir keine mehr. Also zogen wir zu Garys Ekern nach Perth Amboy. Sie unterstützten uns großartig. Als es so weit war und wir unsere erste Kollektion mit UPS ausliefern konnten, kam Garys Mutter Anna täglich an die 7th Avenue in New York, um mir zu helfen, die großen Lieferungen in Kartons zu packen. Uber Weihnachten arbeiteten wir Tag und Nacht. Garys Vater, ein Highschool-Lehrer, stellte uns seinen Bastelraum zur Verfü- gung - Gary nutzte ihn als Designstudio. Ich fuhr jeden Tag nach New York, überwachte die Herstellung unserer Friihjahrskollek- tion, bereitete unsere erste Modeschau in New York City vor. Elite unterstützte uns, stellte uns kostenlos Models zur Verfü- gung. Den Laufsteg bastelten wir selber. Alle Bewohner des Hau- ses, in dem wir unseren Showroom hatten, halfen mit. Umsonst. Beim Casting für die Modeschau kam es zum ersten Streit zwi- schen Gary und mir. Er rümpfte bei jedem weißen Mädchen von Elite die Nase: »Danke, wir melden uns.« Als das Casting vorbei war, wollte Gary zwei Weiße und ansons- ten nur Schwarze von Elite buchen. »Das sind ja gute Fotomodels«, meinte er, »aber die bewegen sich nicht so, wie ich mir das vorstelle. Meine Kollektion, die geht mit Musik und Beat - da nehme ich lie- ber meine Freundinnen, die haben den Rhythmus.«
- 200
- Ich seufzte. »Gary, hör zu. Deine Freundinnen sind entweder schwarz oder ziemlich dunkel geratene Latinos. Du musst mindes- tens zur Hälfte weiße Mädchen nehmen.« Da flippte Gary aus und warf mir an den Kopf: »Du bist ein Ras- sist, Urs!« Demonstrativ zündete er sich einen Joint an und machte einen dramatischen Abgang. Die Quittung bekam er nach der Show. Eine Redakteurin von Women's Wear Daily fragte: »Macht Gary eigentlich nur Mode für Schwarze?« Ich erzählte, wie das Casting gelaufen war. »Nun«, meinte sie, »ich kann Gary nicht verstehen. Ein derartiges Risiko auf sich zu nehmen!« Beim Weggehen rief sie mir noch zu: »Du weißt, dass ich keine Rassistin bin, Urs. Aber das hier ist Amerika. Und du hättest das wissen müssen! Und so etwas Gary nie und nim- mer erlauben dürfen!« Und sie behielt recht. Das Echo am nächsten Tag fiel sehr ver- halten aus. Allerdings verkaufte sich die Kollektion. Wir hatten dreißig Geschäfte, verstreut im ganzen Land, die unsere Kollektion führ- ten. Und machten genügend Geld, um Stoff für die Herbstkollek- tion einkaufen zu können. Dann brach Gary zusammen. Er bildete sich ein: »Ich habe Aids!« Er ließ sich testen. Das Ergebnis war negativ. Er ließ sich immer wieder testen. Als wolle er ein positives Test- ergebnis. Er arbeitete mittlerweile von New Jersey aus und kam nur noch für die wichtigsten Meetings in die Stadt. Ich war mit unserer neuen Firma beschäftigt, nahm keine Modeljobs mehr an, lehnte sogar das Angebot der legendären Schauspielagentur William Morris Agency in Hollywood ab. Sie wollten mich in Los Angeles. Doch ich be- schloss, in Perth Amboy zu bleiben. Ich war überzeugt, dass Gary und ich es schaffen würden. Alles. Die Firma, uns, einfach alles. Die Schauspielerei würde mir ja nicht weglaufen.
- 201
- Dann rief mich die große Mrs. Salzman von Saks an, die bereits Ralph Lauren und Calvin Klein lanciert hatte. »Wir sind interes- siert, Ihre Kollektion zu kaufen. Allerdings unter der Bedingung, dass Sie mehr in Werbung investieren.« Also organisierte ich ein Treffen mit den Leuten von der »Vogue«. Die knallhart waren: »Natürlich, Mister Althaus, wir schreiben gerne über Sie. Aber dann müssten Sie auch eine Werbeseite bei uns kaufen. Zum Spezialpreis von - lassen Sie mich mal sehen - von 18 000 Dollar.« Dann kam ein Anruf von Bergdorf Goodman. Also schob ich die voll behängten Kleiderstangen allein die zwanzig Blocks hoch zur Kreuzung 57th Street und Fifth Avenue. Viele Jahre vor mir hatte Calvin Klein dasselbe getan. Das machte mir Hoffnung. Die Einkäuferin von Bergdorf Goodman war kompetent, bild- hübsch und von unserer Kollektion begeistert. Wenige Tage später erklärte sie jedoch: »Keine Kollektion. Budgetprobleme.« Zu allem Überfluss verlor die Einkäuferin von Bloomingdale's ihren Job - Umsatzziele nicht erreicht. Immerhin: Saks konnte ich gewinnen, und plötzlich war auch Bloomingdale's wieder an unse- rer Kollektion interessiert. Kollektion? Presse und Kunden woll- ten sechs Kollektionen jährlich! Frühling 1, Frühling 2, Sommer, Herbst 1, Herbst 2 und Cruise-Kollektion. Und allein der Anblick unserer Kollektion in diesen Warenhäu- sern, Seite an Seite mit den großen Namen der Branche, machte Gary und mir Mut. Auch, dass Stars wie Cyndi Lauper unsere Mode kauften. Es halfen mir viele. Zum Beispiel Iman, der ich nur den Preis für normale Katalogaufnahmen zahlen musste, als eine unserer Soho- Boutiquen mit ihr einen Katalog machen wollte. Natürlich buchte ich meinen Freund Francis Murphy als Fotografen. Dann arrangierte die große »New York Times« ein Shooting im Actors Studio. Eigentlich wollte die Redaktion ausschließlich jun- ge »upcoming business people« buchen. Dann nahmen sie jedoch mich dazu. Da ich eine gewisse Bekanntheit garantierte.
- 202
- Auf der Bühne, auf der Schauspielgrößen mit illustren Namen wie Brando, Monroe oder Newman gelernt hatten, standen aber kei- ne Wallstreet-Typen, sondern die jungen Schauspieler vom Actors Studio. Das war der Geruch, den ich liebte. Es roch sozusagen aus je- der Ecke des Actors Studios. Und ich bereute, dass ich für Gary Gatys Ltd. all meine Pläne für eine Karriere als Schauspieler über den Haufen geworfen hatte. Es wurde mir klar, dass ich die Schau- spielerei nie hätte aufgeben dürfen. Nicht zu diesem Zeitpunkt. Auch dämmerte mir, dass Perth Amboy vielleicht doch nicht auf Dauer mein Lebensmittelpunkt sein konnte. Statt Central Park South, schicken Hotels oder meinen Wohnungen in Paris und Rom ein Dinner an der dreckigen Bay: Auch wenn Gary wirklich sexy war - war er das wirklich alles wert? Tatsächlich ging es Gary nicht gut. Er wurde immer schwächer, war anfällig auf alle möglichen Krankheiten. Erneut ließ er sich auf HIV testen. Erneut war der Test negativ. Ich wusste nicht, wie lange ich die Kraft aufbringen würde, alles zusammenzuhalten. Denn Gary zog sich privat mehr und mehr zurück. Und leider hatte er auch mehr und mehr Abenteuer außer- halb unserer Beziehung, die ja nicht nur geschäftlich war. Irgendwie ergriffen mich wieder Existenzängste. Was hatte ich schon? Keine Wohnung. Ich wohnte bei den Eltern meines Lebens- partners. Kein Geld, denn ich hatte alles in Gary Gatys Ltd. ge- steckt. Keine eigene Karriere, denn ich war nur Teilhaber einer Firma, die auf die Kreativität von Gary angewiesen war. Und Gary rannte ständig zum Arzt. Bis er das Ergebnis bekam, das ihm geschwant hatte: Er war HIV-positiv.
- 203
- Sex, Drogen, Wahnsinn oder
- Mein steiniger Weg aus der Sucht
- Aids!
- Gary blieb völlig gelassen. Seine einzige Reaktion war »Verdammt!«, das Wort, das er für alles benutzte, ob eine Cola zu warm war oder ob wir im Verkehrs- stau standen. Gary bot mir an, ihn zu verlassen - was nicht in Frage kam. Wir gehörten zusammen, das hier war unsere Prüfung. Garys Eltern reagierten wunderbar, trotz aller Sorgen, die sie sich um ihren Sohn machten. Noch am Tag des positiven Testergebnisses rief ich meine Agen- tur an. Sagte, ich hätte soeben für die »New York Times« gearbei- tet und wolle wieder modeln. Tage später wurde ich für den Titel von »DNR« fotografiert. Ich hatte das Gefühl, als ginge es nun wieder aufwärts mit mir. In Wahrheit sollte es rasanter abwärtsgehen, als ich es mir jemals hätte träumen lassen. Gary bestritt gerade ein Interview, das ich ihm vermittelt hatte. Charmant wickelte er die Journalistin um den Finger, obwohl er offensichtlich ziemlich verladen war. Nach dem Interview nahm er demonstrativ einen Joint aus seiner Tasche, zündete ihn genüsslich an und verabschiedete sich. Ging einfach. Ich stand perplex da. Dann folgte ich ihm durch die Stadt wie ein schlechter Privatdetektiv. Gary verschwand in einem Sexclub. 1 8 2
- Ich hatte genug. Besser: Ich war wie von Sinnen! Jetzt wollte auch ich Spaß und Vergessen - also Sex und Drogen. Ich fragte, wo ich Crack kaufen könne. Eine Prostituierte, die gehört hatte, wonach ich fragte, warnte mich: »Baby, mach nicht, was du vorhast.« Sie hätte mein Schutzengel werden können. Aber ich hörte nicht auf sie. Ich kaufte mir die Droge. An diesem Tag begann ein drei- monatiger Wahnsinn gegen das Leben. Mein Leben. Ich interes- sierte mich nur noch für Sex und Drogen, war nur noch auf der Suche nach Glücksgefühlen. Ich arbeitete, so gut ich eben konnte. Dabei war mir alles scheiß- egal: das Geschäft, Gary und ich mir selbst auch. Und ich arbeitete nicht gut. Anrufe meiner Agentur nahm ich nicht mal mehr an. Wenn ich zurückrief, dann Tage später. Ich stromerte durch die Stadt. Ich kam mir vor wie ein Lonely Cowboy, ohne Ziel, ohne Halt. Ein Getriebener, ein von sich selbst Gejagter. In einem Tunnel, den ich mir Tag für Tag immer heller vorstellte, der jedoch immer dunkler wurde. Nach einem Vierteljahr, das aus Drogen und Sex bestand, suchte Gary endlich das Gespräch mit mir. »Urs, was ist mit uns? Was ist mit dem Geschäft? Siehst du nicht, dass du alles kaputt machst?« LJnsere Verbindung war immer noch stark. Seine Worte bewirk- ten, dass ich die Notbremse zog. Also rief ich Francis Murphy an. Den Mann, dessen Frau Alison ich einst so schnöde an meiner Tür im legendären »Navarro« abgewiesen hatte. Und die beide später zu wahren Freunden geworden waren. In den Zeiten, als ich zusam- men mit Jack dachte, die Welt gehöre uns. »Francis, ich brauche deine Hilfe. Ich bin total auf Drogen.« Allein der Satz war hart. Er hatte mich enorme Uberwindung ge- kostet. Zu meinen Erstaunen sagte Francis mit sanfter Stimme: »Ja Baby, ich weiß. Du kannst jederzeit bei mir einziehen, wenn du willst.« Ich seufzte. »Nein, Francis! Was ich brauche, ist eine Therapie. Ich muss in die Betty-Ford-Klinik. Aber...«, stotterte ich, »... ich habe das Geld nicht.«
- 1 8 3
- »Ach, wenn du willst, bezahle ich dir die Klinik. Aber weißt du, meine Exfrau war ja auch einmal dort.« »Ja, ich weiß. Und?« »Außer Spesen nichts gewesen.« »Aber Francis! Was soll ich denn machen?« »Ruf bei NA an, bei Narcotics Anonymous. Das ist zwar nicht so glamourös wie die Ford-Klinik, aber es ist das Beste, was es in so einer Situation gibt.« Ich sagte nichts. »Überleg es dir. Und wenn du so weit bist, ruf mich zurück. Ich finde in der Zwischenzeit heraus, wo und wann das nächste Mee- ting in deiner Nähe stattfindet. Wo wohnst du eigentlich?« »Im Elternhaus von Gary, in Perth Amboy.« »Mensch, Urs, pack um Himmels willen deine Sachen! Zieh dort aus. Sofort! Komm zu mir!« Danke, Francis. Aber ein atemberaubendes Loft in Soho plus die dazugehörende Glamourwelt? Nicht das, was ich derzeit wirklich brauchte! Ich nahm den Hörer wieder auf und rief eine Nummer an, die mir in dieser Sekunde spontan einfiel: die des Ashram von Siddha Yoga in South Fallsburg. Ich hoffte auf ein Wunder! Hoffte, dass irgendjemand dem Schrecken ein Ende setzte. Ich bekam einen Swami ans Telefon, den ich von Rom her kannte. Und er lud mich nach South Fallsburg ein, ihn und den weiblichen Guru Gurumayi zu besuchen. Doch ich fuhr nicht. Ich hatte kein Geld, hinzufahren. »Urs«, meinte der Swami, bevor wir unser Telefongespräch be- endeten, »halte an deinen Meditationen fest.« Himmel, ja! Als ich mich Hals über Kopf in meine Beziehung mit Gary gestürzt hatte, hatte ich mich selbst irgendwie aufgege- ben. Hatte mit den täglichen Meditationen, die mir nach dem Tod Eigils Trost geschenkt hatten, aufgehört. In einem nüchternen Moment setzte ich mich hin, schrieb Guru- mayi einen Brief, triefend vor Selbstmitleid.
- 1 S 4
- Gurumayi antwortete mir kurz auf einer Karte: »Je mehr Gold man ins Feuer gießt, desto purer wird es.« Und daneben: »Medi- tiere. Dein inneres Selbst wird sich als dein wahres Ich offenbaren.« Also beschloss ich, in Perth Amboy zu bleiben, bei Gary und sei- ner Familie. Inzwischen hatte mir Francis die Adresse von einem NA-Meeting in einem Nachbardorf gegeben. Gestylt, wie ein Model eben, kam ich zu meiner ersten NA- Sitzung und sah die anderen: diese kaputten Gesichter! Aber ich blieb. Zuerst gab es Kaffee und Kuchen. Dann setzten wir uns, formten mit unseren Stühlen ein Viereck. Reihum began- nen die Leute, sich vorzustellen. »Ich bin John und bin ein Süchtiger.« »Ich bin Maria und bin eine Süchtige.« »Ich bin Urs.« Langes Schweigen. »Und ich habe ein Problem mit Drogen.« Riesenapplaus. Alle erzählten ihre Geschichten, alle breiteten ihr Leben aus. Und es geschah Unglaubliches: Ich erkannte in jedem und jeder mich selbst, meine eigene Schwäche. Bei einer nächsten Zusammenkunft sprach ich einen schwarzen Mann an und bat ihn, mein »Sponsor«, meine persönliche Bezugs- person, zu werden: John. »Lass uns einen Kaffee trinken«, meinte er. Ich gab vor, keine Zeit zu haben. Er schluckte meine Lüge nicht. Also gab ich zu, dass ich einfach kein Geld hatte. John reichte mir die Speisekarte. Hochmütig konterte ich: »Nur dass du es weißt! Ich habe nur heute kein Geld bei mir. Und leide mit Sicherheit nicht Hunger. Weißt du eigentlich, wer ich bin?« »Klar weiß ich das. Du bist ein Süchtiger, wie wir. Natürlich kenne ich dich! Von Fotos und so.« Mein Hochmut war weg. »Und was machst du?« »Schulhauswart.« Und dann sagte er etwas Erstaunliches: »Weißt du, was dumm ist?« Wieder kroch Hochmut hoch. Was konnte mir schon ein Llaus-
- 1 8 5
- wart sagen, mir, dem großen Urs Althaus, dem Supermodel? »Na? Das wirst du mir ja jetzt sagen!« »Dumm ist...«, und er sah mir lange in die Augen, »dumm ist, wenn man denselben Fehler immer wieder m a c h t . . . « »Genau!«, unterbrach ich ihn. »Das ist nur die halbe Wahrheit. Dumm ist, immer wieder den- selben Fehler zu machen - und jedes Mal ein anderes Resultat zu erwarten.« Von da an holte mich John jeden Tag mit dem Auto ab und brachte mich zu den Meetings. Wir waren grundverschieden. Aber wir hatten ein Ziel: keinen Alkohol mehr, keine Drogen. Der erste Schritt zum Erfolg: »Heute nehme ich keine Drogen.« Wenn es ganz schlimm wird, wiederholt man diesen Satz immer und immer wieder. Oder man ruft seinen Sponsor an, erzählt ihm: »Ich bin drauf und dran, rauszulaufen und mir Drogen zu kaufen.« Lieber sperrt man sich ein. Schwitzt, tobt, kreischt, hämmert gegen sein Hirn, jede Wand. Und sagt sich immer und immer wie- der: »Heute nehme ich keine Drogen.« Der Weg aus der Sucht ist lang. Du musst beharrlich sein. Hart zu dir, hart zu deiner Umwelt. Seltsamerweise hatte mein Aussehen nicht unter meinen Eska- paden gelitten. Es ist mir nicht gelungen, mich zu zerstören. Irgendwann rief mich meine Agentur an. »Du musst heute um fünf in der Stadt sein. Es geht um die Peter-Stuyvesant-Zigaretten.« Warum auch nicht? Das passte doch gut zu mir, dem Süchtigen. Woher Geld nehmen, um nach New York zu fahren? Garys Tante wohnte gleich um die Ecke. Sie gab mir 25 Dollar. Und? Ich bekam den Job. Bereits zwei Wochen später war ich in der Karibik und in Miami für Shootings. Mein Honorar: 50 000 Dollar. Wichtiger war jedoch: Ich war jetzt seit sechzig Tagen clean! Ich beschloss, zu Reto Badrutt zu ziehen, einem Schweizer, der aus der berühmten St. Moritzer Hoteliersfamilie stammte und mir bei mei- nen ersten Schritten in New York geholfen hatte.
- 1 8 6
- Reto nahm mich in seinem Haus in den Brooklyn Heights wie einen Sohn auf. Und er schloss jede Flasche Alkohol in seinem Haushalt weg. Selbst hier, in diesem noblen Viertel, waren die Meetings von NA brechend voll. Ich lernte: Alkohol und Drogen sind keine Rassisten - sie nehmen jeden mit offenen Armen auf. Ohne Frage nach der Hautfarbe, dem Kontostand. Und ich musste zur Kenntnis nehmen, dass die Versuchungen nicht viel Zeit verlieren! Als ich für meinen Zigaretten-Modelauf - trag im pittoresken Curtain Bluff Hotel auf Antigua über den Klip- pen logierte, hatte ich eine unglaubliche Aussicht: auf die Bar! Alkohol ist in jedem Fünfsternepalast geradezu inklusiv. Ein Drink - und die Hölle hätte mich wieder. Ein Topmodel mir gegenüber trank nur Mineralwasser. »Kann es sein, dass wir dasselbe Problem haben?« »Ich? Ich?«, stotterte ich. »Ich habe kein Problem.« »Schade. Ich dachte, dass du auch NA-Mitglied bist. Wegen des Fruchtsafts und so.« Ich nickte. Und wir wurden ein Team, passten auf, dass keiner Alkohol trank, Drogen anrührte. Während die anderen sich vor dem Abendessen an der Bar zum hochprozentigen Apero trafen, fuhr ich mit ihr an einen der Strände, um den Sonnenuntergang zu genießen. Zurück in New York, gleiste ich mein Leben neu auf. Ich verließ Reto Badrutts Haus mit dem unglaublichen Blick auf die Freiheits- statue, das damals noch nicht zerstörte World Trade Center und die Brooklyn Bridge und nahm mir eine Zweizimmerwohnung in einem neu erbauten Luxuswohnkomplex an der schmuddeligen Bay in Perth Amboy. New York City? Nein danke! Da war ich abgestürzt. In New Jer- sey hatte ich noch nie Drogen gekauft oder genommen. Ich wollte mindestens ein Jahr lang clean bleiben! Auch unser Geschäft wollte ich wieder auf Vordermann bringen. Wieder besuchte ich Kunden, ging statt in Bars ins Fitnessstudio.
- 1 8 7
- Trotz allem, was zwischen Gary und mir passiert war: Wir konnten nicht voneinander lassen. Die Chemie zwischen uns stimmte. Wir konnten uns gegenseitig nicht widerstehen. Unsere Beziehung war intensiv, explosiv - und wunderbar. Ich hatte für diese Beziehung, ohne mit der Wimper zu zucken, die zwei Dinge über Bord geworfen, die mir persönlich am wich- tigsten waren: die Schauspielerei und meine Meditationen. Gary zog wieder bei mir ein. Einzige Auflage: kein Alkohol, kein Joint. Die neue Kollektion war auf bestem Weg. Wir erhielten einen Preis als Jungdesigner, der darin bestand, dass wir der weltberühm- ten St. Galler Stofffirma Jakob Schlaepfer vorgestellt wurden. Gary kaufte dort einen wunderschönen und entsprechend sau- teuren Stoff. Der Meter für 115 Dollar. Um all das notwendige Kapital zusammenzukratzen, flog ich weiterhin regelmäßig nach Paris, um an den Schauen Geld zu verdienen. Nach zwei Jahren harter Arbeit, vielen Hochs und Tiefs sah es gar nicht schlecht aus für uns. Wir hatten wieder gute Presse. Wir hatten wieder zueinandergefunden. Und ich lud Gary für Weih- nachten nach Altdorf ein. Ihm fielen beinah die Augen aus dem Kopf, als er in der Schöl- lenenschlucht das Nebelmeer sah; und in Andermatt hatte er zum ersten Mal in seinem Leben Skis an den Füßen. Das folgende Jahr endete ganz anders. Während der Pariser Show von Kenzo, die ich eröffnete, überfiel mich plötzlich der Ver- dacht, in meiner Wohnung in New Jersey spielten sich während meiner Abwesenheit entgegen meinen Abmachungen mit Gary Partys mit Drogen und Sex ab. Ich beendete die Showsaison und blieb noch zwei Wochen in Paris. Wieder in New Jersey, fand ich meinen Verdacht bestätigt und trennte mich von Gary: privat wie geschäftlich. Weihnachten 1989 kehrte ich nach Altdorf zurück. Ich musste loslassen, endlich neu beginnen, mir selbst zuliebe. Ich wusste, ich musste mich für das Leben entscheiden und nicht für das Sterben.
- 1 8 8
- Freiheit, Zürich, fester Job oder Ich bringe Dynamik ins Schweizer Modelbusiness
- Ja. Es waren harte, aber auch wunderschöne Jahre. Mal mehr Him- mel, mal mehr Hölle. Eines Abends im Jahr 1990 rief mich Suzy Mella an. Vierzehn Jahre war es her, dass wir uns im Zug auf dem "Weg von Paris in die Schweiz kennen gelernt hatten, nach meiner allerersten Show in Paris. Seit Jahren war Suzy meine Schweizer Agentin - sie war Besit- zerin der ältesten Modelagentur der Schweiz: Fotogen. Diese war 1967 von vierzehn Mode- und Werbefotografen gegründet worden - als Genossenschaft zwecks Vermittlung und Aufbau von Foto- modellen. Suzy Mella hatte einen guten Riecher. Was hatte sie schon alles hinter sich! Beim renommierten Kaufhaus Jelmoli hatte sie Parfüm- verkäuferin gelernt, stieg dort schnell zur Chefin der Parfumerie auf, Dadurch hatte sie blendende Kontakte zu Modejournalistin- nen - und wurde innert Kürze gleich selbst Redakteurin, beim damals besten Schweizer Modemagazin, »Annabelle«. Als Fotogen-Chefin entdeckte sie in der Schweiz einen neuen Markt: Modeschauen. 1979 konnte sie dank guter Geldgeber die Firma kaufen, die eine Genossenschaft gewesen war, und diese in eine Aktiengesellschaft umwandeln - die Fotogen AG. Suzy wusste genau, wie es in ihrem, meinem, unserem Beruf zugeht. Oder wie sie einmal sagte: »Der Beruf Fotomodell ist hart.
- 1 8 9
- Es ist auch ein gemeiner Beruf: Das Model muss einerseits sensi- bel, feinfühlig sein, andererseits gehts zu wie auf dem Viehmarkt: Wer mimosenhaft ist, hat kein Brot. Kommt hinzu, dass die Kamera brutal ist: ein kleiner negativer Zug im Gesicht - und weg ist man.« Suzy formulierte genau das, was ich in meinen letzten Jahren erlebt hatte: Es kommt nicht allein auf die Schönheit an. Fotogen sein und schön aussehen fürs Auge - das ist nicht dasselbe. Und - du musst als Mädchen mindestens 1,75 Meter groß und darfst zu Beginn nicht älter als siebzehn oder achtzehn sein. Wenn eine 22-Jährige in das Geschäft mit der Mode, der Schönheit, dem Modeln einsteigen will, muss man klar sagen: »Sorry! Der Zug ist abgefahren!« Und das Geld? Viele stellten sich damals vor, es regne nur so Geldscheine vom Himmel. Eine Anfängerin verdiente kaum je die großen Scheine. Da war kein Geld für die Pensionskasse dabei, kein Feriengeld, kein 13. Monatsgehalt. Nichts. An jenem Abend wollte Suzy mich nicht buchen: »Ich habe ja deinen Weg lange verfolgt. Du bist jahrelang durch die Welt geflo- gen. Und ich finde, du bist jetzt alt genug...« »... für was, Suzy?« »... um endlich zur Ruhe zu kommen.« Suzy bot mir einen Job in ihrer Agentur an! Sie traf den Nagel auf den Kopf. Ihr Angebot war meine Chance für einen neuen Lebensabschnitt, für Ruhe und Sicherheit. Ich war nur allzu bereit, mit der Vergangenheit abzuschließen und mich in jeder Hinsicht neu zu orientieren. Auch wenn ich meine Karriere- pläne nicht begraben hatte. Aber ich wusste: Ich musste innerlich zur Ruhe kommen, bevor ich mich wieder der Schauspielerei zuwenden konnte. »Suzy? Ich bitte um eine Woche Bedenkzeit!« Nach acht Tagen nahm ich Suzys Angebot an. Ohne zu fragen, wie viel ich verdienen würde. »3500 Franken im Monat - brutto. Mehr kann ich im Moment einfach nicht zahlen.«
- 1 9 0
- Hingegen war meine Aufgabe glasklar: Suzy wusste, dass in den letzten Jahren die Designer und Modehäuser den Mann entdeckt hatten. Dass Männern in diesem Beruf eine blendende Zukunft bevorstand. Also sollte ich die bis dato nur halbherzig betriebene Männer- abteilung auf Vordermann bringen. »Dann bekommst du auch eine Beteiligung von siebeneinhalb Prozent am Mehrumsatz.« Die hatte ich mir ebenso ausbedungen wie die Möglichkeit, neben meiner neuen Tätigkeit als Booker weiterhin die Pariser Shows zu laufen - sowie andere große Modeschauen. War der Job riskant? Die Männerabteilung von Fotogen erzielte einen Umsatz von lediglich 300 000 Franken. Ich dachte mir: Na, da kannst du nicht viel falsch machen! Suzy hielt Wort: Sie ließ mir mit der Männerabteilung freie Hand. So trennten wir die Frauen- und die Männerabteilung. Nicht nur räumlich. Wir führten auch die Bücher separat, wie ich es bei den internationalen Agenturen beobachtet hatte. Mein neues Büro war ein Prachtstück. Im eleganten Zürcher Kreis 6 gelegen, konnte es locker mit entsprechenden Büros in New York, London oder Paris mithalten. Auch wenn hier alles kleiner war. Eine elegante Schiebetür aus Glas und Holz trennte meinen Bereich ab, erlaubte mir dennoch den Blick hinüber ins Booking der Frauen. Ich hatte ein Büro mit prächtigen Pflanzen und Fern- seher, einen direkten Zugang zu einem eigenen Sitzungszimmer, ebenfalls edel eingerichtet. Ich fühlte mich in meinem Königreich pudelwohl - und ich räumte auf! Als Erstes entließ ich von 150 Männern, die Fotogen betreute, 140! Ein Kahlschlag, der sein musste, wollte Fotogen nicht zu einer Agentur verkommen, die im Männerbusiness nur die dritte Geige spielte. Kündigungen auszusprechen, ist wahrlich kein Spaß, hier aber hielt ich es für überlebensnotwendig. Dann begann ich, neue Models zu holen. Dabei ist ein gutes
- 1 9 1
- Beziehungsnetzwerk - wie in anderen Branchen auch - unbezahl- bar. Das habe ich von den Großen der Branche gelernt. Zum Bei- spiel von John Casablancas oder meinen Topbookern. Nur die Besten der Besten hatten den Schlüssel zum Erfolg in der Hand. Beziehungen zur Presse, zu den Kunden, zu den Models ist das eine - enge Kontakte zu den Topagenturen das andere. Und erstklassige Beziehungen hatte ich. Zum Beispiel nach Ita- lien. Die italienischen Agenturen gaben mir, wenn immer irgend möglich, jedes Model, das ich mir wünschte. In Paris war ich eines der gefragtesten und bekanntesten Models gewesen. Die Chefs der größten Pariser Agenturen waren einst meine Booker gewesen. Wenn ich jetzt ein Model wollte, bekam ich es. Elite ging dabei sehr weit: Sie erlaubten mir, jedes ihrer Models zu buchen - auch wenn es offiziell bei Option, unserer Konkurrenz in Zürich, vertreten war. Und New York war sowieso meine Stadt, mein Revier. Die dor- tigen Agenturen gaben mir jedes Model, einige erklärten gar, sie wollten in der Schweiz nur noch mit mir zusammenarbeiten. In nur drei Monaten hatte ich eine einzigartige Männerabteilung: Von den hundert besten Männermodels der Welt wurden neunzig durch Fotogen vertreten. Klar, dass wir den Schweizer Markt be- herrschten. Dazu kam, dass ich als Model immer noch für Kenzo, Cardin, Givenchy, Lanvin und andere Marken lief - und dort die Besten gleich selbst unter Vertrag nahm. Wie Edoardo Cicorini. Heute bekannt als Edoardo Costa - und als Schauspieler in Streifen wie »Stirb langsam« zu sehen. Oder der indischstämmige Moose Ali Khan, bis heute eine Legende, ein Pio- nier der »Ethnomodels«. Als ich mit diesem neuen Liebling der Modeszene die Balmain-Show eröffnen durfte, wurde mir klar: Es ist Zeit für mich, mit dem Modeln aufzuhören. Da lief eine neue Generation über den Laufsteg! Und wie die lief! Nach meinen ersten vier Monaten bei Fotogen kam Suzy auf mich zu: »Komm, lass uns eine Flasche Wein trinken.« Ich war ner-
- 1 9 2
- vös. »Du hast in den letzten vier Monaten gleich viel Umsatz bei den Männern gemacht wie wir im gesamten vergangenen Jahr ! « Sie hob das Glas. »Gratuliere!« Und ich? War eben doch ein typisches Model: Ich bat um einen Vorschuss auf meine Provision. Ich wollte mir ein Auto kaufen. Es wurde ein knallroter Audi Coupé. Ende Jahr erhielt ich nicht nur eine Provision, auch eine groß- zügige Lohnerhöhung: 4500 Franken. Viel lernte ich von Suzy. Bei vielen guten Flaschen Wein. Sie nahm mich zu allen Anlässen mit, stellte mich als ihren neuen Star- booker vor, als den Mann, der hoffentlich eines Tages die Agentur von ihr übernehmen würde. Suzy war ein Urgestein. Eine herzhafte Frau, die ihre Freunde liebte - mich beinahe wie einen Sohn. Wir waren ein Gewinner- team. Ich hatte meinen Platz gefunden. Oder sollte auch dieser Traum wieder platzen?
- Wein, Erfolg und Neid oder Plötzlich stehst du auf der Straße
- Bald stellte sich heraus, dass Suzy, die Booker der Frauenabteilung und ich in einem ständigen Wettstreit standen. Sie war verantwort- lich für die Frauen, ich für die Männer. Sie war Besitzerin der Agen- tur, ich der Starbooker. Ich war der Ansprechpartner für Kunden und Models. Wird ein Model gebucht oder vermittelt, so organisiert der Booker alles. Von der Buchungsbestätigung bis zu Zug- oder Flugticket, Unterkunft
- 193
- im Hotel. Er stellt das Book des Models immer wieder um, nimmt die neuesten Aufnahmen hinein, sortiert andere aus. Booker bauen neue Models einer Agentur auf, organisieren Testaufnahmen, sind sehr mächtig. Was Agenturbesitzer in die Zwickmühle bringt. Einerseits brau- chen sie gute Booker, andererseits sind sie gut beraten, deren Macht in Grenzen zu halten. So oder so springen Booker gerne ab, um eine eigene Agentur zu gründen. Ich wusste um die Problematik: Schließlich war ich Sophie und Eveline zu Passion gefolgt, ich war mit Nadja gegangen, als sie ihre Men-Agency eröffnete. Ich wusste, wie der Hase läuft. Und Suzy wusste es auch. Dennoch belastete diese Ausgangslage unsere Beziehung nicht sonderlich. Suzy betrachtete mich nicht als Angestellten, sondern als ihren Nachfolger. Sie hatte keine eigenen Kinder. Und sie hatte betont, dass ich ideal sei, um ihre Agentur eines Tages von ihr zu übernehmen. Fotogen wurde auch ein bisschen mein Kind. Bei einem Glas Weißwein schüttete sie mir eines Tages ihr Herz aus: »Weißt du. Ich habe so vielen geholfen. Jungen Fotografen, die es dank mir zu Weltruhm brachten. Und die mich fallen ließen, nur noch in Paris oder New York buchen.« Sie nahm einen weiteren Schluck: »Und jetzt? Jetzt buchen sie bei dir!« »Suzy«, auch ich musste mich jetzt mit Wein beruhigen. »Nimm es nicht persönlich, aber die Frauenabteilung ist stehen geblieben. Seit Jahren dieselben Models. Das ist der wahre Grund, weshalb dir Fotografen abspringen.« »Ach, U r s . . . « »... ja, so ist es! Fotografen, die nach oben wollen, buchen die Neuen, die Besten, die Stars der Saison. Die muss man im Sorti- ment haben.« Ich wollte die Frauenabteilung ausmisten. Sie neu aufbauen wie die der Männer. Suzy war einverstanden, dass ich im Frauenboo-
- 194
- king mithalf, doch ich wollte mehr. Ich wollte freie Hand. Von den 150 Frauen, die war vertraten, fand ich nur zehn gut; diese baute ich in die Männerabteilung ein, um Suzy zu zeigen, was möglich wäre. Unsere Beziehung erlitt erste Risse. Und es kam zu harschen Worten, etwa: »Ich bin hier die Chefin, Urs! Ich entscheide, welchem Fotografen wir eins unserer Models für Tests geben. Und wem nicht!« Ich hatte dem jungen Fotogra- fen Claude Stahel für Tests zwei Topmodels zur Verfügung gestellt. Ich hatte in New York gelernt, dass die Rechnung am Ende stimmt, wenn man jungen Fotografen hilft. Zum Beispiel bei Testino, Steven Klein und anderen. So bedankte sich Stahel, indem er sei- nen ersten großen Job über mich buchte. Als ich einmal in Paris zum Gasten war, suchte mich an einem regnerischen Abend Babu auf, Schweizer und Mischling wie ich. Sein Gesicht, von Rastalocken umrahmt, prangte auf zahlreichen Benetton-Werbeplakaten. Babu war einer der Stars von Option, der 1987 in Zürich gegründeten Konkurrenzagentur. Angeblich ganz neu, ganz trendy. Babu klagte jedoch, es sehe mit seiner Arbeit nicht rosig aus, seit ich bei Fotogen arbeite. »Ich möchte zu dir wechseln«, erklärte er. Ich sagte sofort zu. Bei mir gab es keine Sprüche wie: »Sorry, aber wir haben bereits einen Schwarzen.« Fotogen war die einzige Schweizer Agentur, die schwarze Männer wirklich vertrat. Die anderen hatten nur »Quo- ten-Schwarze«. So war es mir einmal gelungen, drei schwarze Männermodels in die Sendung des charmanten Schweizer Fernsehmoderators Kurt Aeschbacher zu vermitteln. Siehe da - es war ein Erfolg. Trotzdem verheimlichte ich Babu nicht: »Schwarze Männer wer- den in der Schweiz selten gebucht. Ich kann dir also nicht Jobs in Hülle und Fülle versprechen.« Er nickte. »Damit kann ich leben. Aber da wäre noch etwas...« Bitte keinen Vorschuss verlangen! Doch nein: »Ich... also ich
- 1 9 5
- habe da eine sehr gute Freundin ... die ebenfalls wechseln will: Natalie.« »Etwa Natalie Bachmann?« Er nickte. Ich war aus dem Häuschen. Natalie wurde in der Schweiz eben- falls von Option vertreten. Doch wichtiger war: Sie war der abso- lute Star von Elite. Jeder kannte die Thurgauerin Natalie Bachmann und ihre Mar- kenzeichen: lange blonde Haarmähne, sinnlicher Schmollmund. Ein Topmodel der Weltelite. Sie gehörte zu den Lieblingsmodels von Claude Montana, Azzedine Alai'a und Thierry Mugler. »Wenn du Zeit hast, können wir Natalie gleich besuchen. Sie wohnt um die Ecke. Und sie möchte dich gerne kennen lernen.« Natürlich hatte ich Zeit. Natalie entpuppte sich als zerbrechlich wirkende, groß gewachsene Frau mit ausgeprägter Nase. Und - sie war außerordentlich nett. Ich verstand sie besser als andere Boo- ker. Weil ich selbst Model war. Darum meinte Natalie am Ende des Abends: »Ich wechsle zu Fotogen. Unter der Bedingung, dass du mein Booker wirst.« Was daheim in Zürich meine Chefin Suzy Mella so kommen- tierte: »Jetzt kannst du zeigen, was du wirklich draufhast. Frauen sind um einiges schwieriger zu verkaufen als Männer.« Gleichzeitig bot sie mir an: »Du kannst auch noch andere Frauen buchen - wen willst du denn?« Ich wollte Claude. Claude Heidemeier, eine Entdeckung von Suzy, eines der absoluten Topmodels von Elite, die Muse von Thierry Mugler. Das Wichtigste, was mir meine Chefin in dieser Zeit beibrachte, war ihr Konzept der gemischten Rechnung, das heißt, Aulträge in ihrer Gesamtheit an Land zu ziehen. Sie kombinierte Topmodels mit günstigen Models, verkaufte sie als Gesamtpaket. Dadurch konnte sie dem Kunden eine Qualität bieten, die er sich sonst nicht hätte leisten können. Brutal gesagt: Es war eine Art Mengenrabatt. Der erste Fotograf, der bei mir Models im Gesamtpaket für eine
- 1 9 6
- Katalogarbeit buchte, war Erwin Windmüller, bekannt durch seine »GQ«-Covers, Dior-Kampagnen und dafür, dass er schnell arbei- tete. Für die Models hieß das: Morgens früh aufstehen, schnell die Shootings absolvieren - und den Rest des Tages surfen, baden, an der Sonne liegen. Logisch, dass ich dieses Konzept auch Topmo- dels schmackhaft machen konnte. Die Models verdienten bei diesen Jobs gleich viel, wie wenn sie über eine Agentur in Paris, Mailand oder sonst wo gebucht wor- den wären. Sie hatten ihren fixen Buchungstarif, der in verschie- dene Währungen umgerechnet wurde. In Paris kostete damals ein gutes Model 10 000 französische Francs pro Tag, umgerechnet etwa 3000 Schweizer Franken. So mancher Schweizer Kunde hätte sich dieses Model nicht leis- ten können. Hätte! Ich aber wusste: Die Abzüge vom Bruttolohn der Models in Frankreich sind gewaltig! 64 Prozent, inklusive Steu- ern und Agenturprovisionen. Das Model verdiente also netto etwa 3600 französische Francs - rund 1250 Schweizer Franken. In der Schweiz waren die Abgaben tiefer. Einige Sozialabgaben und die Quellensteuer fielen weg, sofern im Ausland fotografiert wurde. So ergab sich nach Adam Riese: Ein Schweizer Kunde muss- te einem Model bei weitem nicht 3000 Franken Bruttohonorar zu- sichern, damit ich den Models dasselbe Nettohonorar wie in Paris oder Mailand ausbezahlen konnte. Der Konkurrenz war das ent- gangen. So bestätigte und bezahlte ich den Models die Nettopreise in ihrer entsprechenden Fremdwährung, oder wir rechneten den Nettolohn in Schweizer Franken um. Die Models interessierte nur, was unter dem Strich für sie übrig blieb. In meiner Zeit bei Fotogen lernte ich auch einige echt Schräge und Schrille kennen. Wie den Kunstmaler und Fotografen Johann Ulrich, der Suzy Mella respektlos als »die Alte« titulierte. Ein Riese von Mann, mit Vollbart und in einem weißen Overall stürmte er in die Agentur. Er zeigte mir ein Werbekonzept für die renommierte Schweizer Lingerie-Firma Calida: Models, die durch
- 1 9 7
- die Luft flogen, in Pyjamas oder Unterwäsche. Frauen mit wehen- den Haaren. »Was für ein Sternzeichen bist du?«, fragte er. »Fisch.« »Das passt. Ich habe für die Präsentation nur 3000 Franken pro Model. Was bietest du mir dafür?« Ich grinste. »Du kannst dir jedes Model dort an der Wand aus- suchen.« Er starrte mich ungläubig an. »Willst du mich verarschen? Die meisten von denen kosten mehr! Und ich mache Unterwäsche!« Dann erzählte ich ihm von meiner Strategie der gemischten Rechnungen. Und er buchte: unsere Stars Natalie und Claude und den Anfänger Rick Giles, den ich in London entdeckt hatte. Auf Dauer mit Johann zu arbeiten, war jedoch hart: Er wollte immer die Geburtsdaten aller Models wissen, um die Frauen und Männer ihrem Sternzeichen entsprechend zu mischen. Solche »Probleme« hatte ich mit der argentinischen Polomann- schaft nicht, mit der ich es dank Trudie Götz zu tun bekam: Sie, die »Boutiquenkönigin der Schweiz«, kannte ich gut. Sie hat es wirk- lich von ganz unten nach ganz oben geschafft. Heute gehören der am Zürichsee lebenden Selfmade-Woman exklusive Modegeschäfte in Basel, Zürich, St. Moritz und Gstaad, die unter der von ihr gegründeten und geführten Firma »Trois Pommes« Topmarken führen, von Jil Sander bis Prada, von Dolce & Gabbana, Gucci und Marc Jacobs bis Balenciaga. Ich war einige Male für Trudie Götz gelaufen. Einmal hatte sie mich aus Paris extra einfliegen lassen, als sie Jil Sander und ihre Mode in die Schweiz holte. Nun überraschte Trudie mal wieder mit einer Idee: Unsere Models sollten in St. Moritz bei einem Poloturnier eine Show in den Pferdezelten zeigen. Mitten im Heu. Das Ergebnis? Noch nie wurde ich von so vielen polospielenden Knackärschen umgarnt. Alle wollten mit mir Freundschaft schlie- ßen. Sie sahen in mir ihr Ticket zu den Models.
- 1 9 8
- Als ich einmal nach New York fliegen wollte, um Models zu casten, belehrte mich Suzy eines Besseren: »Weshalb New York? In vier Stunden bist du gemütlich mit dem Zug in Mailand. Da gibt es hundert Agenturen, die alle Models der Welt vertreten. Dort kriegt du alles, was du willst!« Recht hatte sie, die alte Füchsin. Mailänder und Pariser schick- ten ihre Scouts rund um den Erdball, um die besten Models für ihre Länder unter Vertrag zu nehmen. Ich fuhr gemütlich mit dem Zug nach Mailand, um dort von Agentur zu Agentur zu schlendern und die besten Models für die Schweiz und Schweizer Kunden zu ver- pflichten, welche ich dann auch »verkaufte«. Das sprach sich schnell herum. Als ich im privaten Castingbüro der noblen Mailänder Agentur Fashion ankam, warteten dort an die siebzig Models, vom Star bis zum unbekannten Newcomer, die alle auf den Schweizer Markt wollten. Ich nahm mir Zeit für jedes Model. Ich war schließlich lange genug im Geschäft, um den Unterschied zu kennen, ob man sich als Filet oder als Stück Fett vorkommt. »Du, ich war gerade mit Barbara von Glieder Les Boutiques zum Lunch«, sagte Suzy eines Tages. »Die ehren Kenzo und machen eine Riesenshow in Zürich. Schade, sie buchen alle in Paris. Auch unsere Stars.« Was tun? Ich rief Ruth bei Kenzo in Paris an, die rechte und linke H a n d des Meisters, für den ich erst vor kurzem alle Pariser Shows gelaufen war. Ich erzählte ihr, dass ich jetzt in Zürich und dort Top- booker sei. »Aber du weißt, wen wir alles buchen?« »Das ist es ja gerade. Die werden beinahe alle von mir in Zürich vertreten.« Eine Stunde später rief sie zurück. »Ich habe mit Kenzo geredet. Ganz liebe Grüße. Du kannst die Show buchen.« Die Pariser Agenturen sahen es zwar nicht gerne, dass ich ihre Imagekunden direkt von Zürich aus buchte, doch ich versprach, es nie wieder zu tun. Sie bedankten sich, indem sie mich noch mehr
- 1 9 9
- unterstützten. Die Show war ein absoluter Erfolg. Da saß ich, mit meinen ehemaligen Modelkollegen, in Zürich an einem T i s c h - u n d Suzy war dabei. Fotogen hatte es wieder einmal geschafft, die Top- models dieser Welt nach Zürich zu holen. Wenig später erschien ein eleganter Herr bei uns auf der Agen- tur. Er überreichte mir einen Umschlag: »Monsieur Althaus, es ehrt mich, Sie im Namen von Kenzo an seine Jubiläumsfeier nach Paris einladen zu dürfen.« Das ist selten genug in der Branche: Designer mit vollendeten Formen. Kenzo ist einer. Doch je länger, je stärker war in meinem Verhältnis zu Suzy Mella der Wurm drin, wir... Aber was solls, ich mache es kurz: Plötzlich ging es Schlag auf Schlag. Suzy holte zwei neue Booker an Bord und schlug mir vor, ihr die Agentur Fotogen abzukaufen. Ich war sprachlos. Ich hatte Fotogen vom sinkenden Schiff zum prächtigsten Dampfer der Schweiz gemacht. Nun sollte ich ledig- lich mit meinen 4500 Franken Lohn pro Monat eine Agentur kau- fen, deren Wert ich durch meine Arbeit und meine Beziehungen in die Höhe getrieben hatte? Ich schrieb meine Kündigung.
- 2 0 0
- Schweizer Modelkrieg, Option, Miss Wonderbra oder Wie ich den Elite-Model-Wettbewerb zurückgewann
- Ich hatte Fotogen verlassen und stand ohne Plan B da. Ich hatte schlicht nicht damit gerechnet, dass meine Zeit bei der Agentur meines Herzens ein derart abruptes Ende finden würde. Ich hing im luftleeren Raum. In meiner kleinen Wohnung, in Rufnähe von Fotogen. Wenigstens war ich privat seit einiger Zeit in festen Händen. Mit meinem Freund, dem gut aussehenden Model Ivo - der allerdings bei Konkurrentin Option unter Vertrag stand -, verbrachte ich Traumferien auf Mauritius, an der Sonne. Anschließend in Klos- ters, im Schnee und in der »Casa Antica«. Mit Zizi und John Henry, mit Mitternachtsspaghetti bei meiner Freundin Regula in deren wunderbarem Chalet. Zwischen Schnee, Sonne und Dolce Vita fragte mich Ivo: »Hey, Urs, bei Fotogen bist du weg! Warum fängst du nicht bei Option an?« »Ich? Bei der Konkurrenz?« »Na. Die hätten es dringend nötig, jemanden wie dich zu haben. Ursula hat mir gegenüber mehrfach erwähnt, dass sie einen un- glaublichen Buchungsrückgang hatte - wegen dir.« »Das kann ich verstehen«, sagte ich stolz. »Ursula sagt: Ihre zwei Topmodels Natalie und Babu sind zu dir übergelaufen...« Die Idee war nicht schlecht. Ich selbst wäre zu stolz gewesen, bei Option anzufragen.
- 2 0 1
- »Per Zufall« traf ich wenig später Ursula Knecht und ihren Mann Hanspeter, die Besitzer von Option. Sie boten mir eine volle Part- nerschaft an, fünfzig Prozent Beteiligung an der Agentur. Der Ha- ken: Option ging es nicht rosig! So forderte ich neben der Beteiligung eine einmalige Zahlung von 100 000 Schweizer Franken, die Hälfte sofort, den Rest später. Ursula Knecht wusste aufgrund meiner Umsatzzahlen bei Fotogen, dass ich die Summe wert war. Die Agentur bestand aus einer engen, kleinen Dreieinhalbzim- merwohnung. Das Angebot war klein, hatte - abgesehen von den weiblichen Models ihrer Partneragentur Elite - nicht gerade das Sortiment einer Topagentur. Also: das Männerboard aufstocken, die erstklassigen Mädchen behalten und die anderen verabschieden. Für Option wollte ich nur die Besten der Besten. Besonders von Elites größtem Konkurrenten, der altehrwürdigen Modelagentur Fashion in Mailand und deren Zweigagentur Next in Paris und New York. Letztere stellte mir ihre Models für meine Schweizer Agentur zur Verfügung, nachdem ich ihrem Chef, einem ehemali- gen Modelkollegen, mit dem ich oft in New York gearbeitet hatte, hoch und heilig versprochen hatte, dass Option eben nicht Elite gehöre, sondern Ursula Knecht und mir. Selbst die Topstars der trendigsten Frauenagentur, Women, durfte ich vermitteln. Deren Chef Paul Rowland war einer der jungen Wilden, die ich in der Eineinhalb-Zimmer-Agentur von Nadjas Men-Agency kennen gelernt hatte. Um selbst in New York weitere Frauen und Männer zu casten, flog ich nach New York - zusammen mit Ivo, der mittlerweile erfolgreicher Booker bei Option war. Bei diesem Aufenthalt traf ich Gary. Es war das letzte Mal, dass ich ihn lebend sah. Einige Zeit später rief er mich in Zürich an. »Urs, ich möchte, dass du weißt: Ich habe nur dich geliebt. Bitte verzeih mir.« »Das habe ich doch längst. Was ist los?«
- 2 0 2
- »Ich möchte mich verabschieden. Ich sterbe. Sehr bald.« »Gary«, sagte ich. »Auch ich habe dich sehr geliebt...« Das waren die letzten Worte, die ich ihm sagte. Seine letzten Worte an mich: »Wenn du Zeit hast, später, wenn es zu Ende ist mit mir - denk an meine Eltern. Besuch sie bitte.« Garys Eltern freuten sich, als ich sie in Perth Amboy besuchte. Als ich weinend an Garys Grab stand, nahmen mich seine Eltern in den Arm. »Danke, dass du gekommen bist. Weißt du, für uns warst du der einzige Freund, den unser Gary je hatte.« In Zürich wollte ich endlich meinen großen Traum verwirk- lichen: im deutschen Markt Fuß fassen! Ursulas Mann und seine Familie, durch ihr eigenes Geschäft in der Bekleidungsbranche erfolg- und einflussreich, halfen Ursula und mir dabei. Sie vermittelten uns Termine bei deutschen Kun- den. Und unser Angebot kam an: Anstatt bei fünf verschiedenen Agenturen anzurufen und zu buchen, konnte der Kunde bei uns mit einem einzigen Griff zum Hörer genau dieselben Models buchen. Und: Wir gewährten einen »Mengenrabatt«, im Verhält- nis zum Umsatz. Der erste deutsche Art-Director, der mir vertraute, war weiblich und ein Star: Tanja Valerien, Tochter des legendären Sportrepor- ters Harry Valerien. Tanja war von meinem Service so beeindruckt, dass sie ganze Produktionen über mich buchte - in Miami, Barce- lona, Paris oder New York. Ich war für Tanja rund um die Uhr erreichbar - sieben Tage die Woche. Im Gegenzug verhalf sie mir zum Durchbruch auf dem deutschen Markt. Plötzlich platzierte ich in Deutschland nicht nur meine Männer, sondern buchte auch mit meinen Frauen Weltkampagnen für Audi, Mercedes oder Heineken, für Katalogkunden wie Karstadt, Kauf- hof und andere Große. Eine meiner ersten großen Frauenbuchungen ist mir unvergess- lich. Es war die schöne Adriana Sklenarikova für eine weltweite Woolford-Kampagne. Männer mochten sie als »Wonderbra-Super- model«. Ich liebte sie, weil sie bodenständig und unkompliziert
- 2 0 3
- lustig war, ganz ohne Weltstarallüren. Sie heiratete später einen Mann, der ebenfalls ein Weltstar war: den einstigen Fußballwelt- meister Christian Karembeu. All diese großen Kunden und Topmodels wollten allerdings nur mit mir verhandeln - was ein Ungleichgewicht zwischen Ursula und mir schuf. Als Ivo und ich einmal mit meinem brandneuen Audi Cabriolet eine Woche Ferien in Portofino machten, rief Ursula schon an. Sie brauche Hilfe. Also war ich nach drei Tagen wieder in der Schweiz. Ursula ärgerte es sehr, dass die Austragung des »Elite Model Look«-Wettbewerbs in der Schweiz nicht mehr ihrer Option, son- dern der Konkurrenzagentur Time zugesprochen worden war. Ein- mal mehr halfen jedoch meine Beziehungen. Diesmal zu Elite-Boss John Casablancas. Umgehend rief ich in New York an und verlangte ihn. Die Tele- fonistin kannte mich aus meiner Modelzeit. Schon war John am Apparat: »Hey, Urs, du bist jetzt im Agenturbusiness? Toll. Ich suche einen starken Partner in der Schweiz.« Da war John bei mir genau an der richtigen Adresse. Ursula und ich trafen ihn in Genf, und kurz daraufbekamen wir den Zuschlag, nachdem ich ihm versprochen hatte, mich persönlich um den Event zu kümmern. Wir durften den »Elite Model Look« für die Schweiz austragen: endlich die Möglichkeit, unsere eigene Talentschmiede aufzubauen. John hatte sein Versprechen aus dem Jahr 1977 gehal- ten, ich hatte einen Wunsch offen, nachdem ich 1977 Zoli verlas- sen und zu Elite gewechselt hatte. Damit wäre ja wieder mal alles bestens gewesen. Doch bei ge- meinsamen Ferien auf Sardinien platzte es aus Ivo heraus: Er glaube, Ursula sei zu selten in der Agentur und fahre selbst zu wenige Buchungen ein. Ivos charmante Mutter Marlies, die in den Ferien dabei war, schlug umgehend vor: »Warum eröffnet ihr beide nicht einfach eine neue, eigene Agentur? Ich würde euch die Finanzierung sicherstel- len. Und in meinem Haus wäre doch die Agentur bestens aufgeho-
- 2 0 4
- ben.« Und Ivo meinte gar: »Urs! Du bist viel zu loyal! Besonders zu Ursula und Option!« Was aber tat ich? Ich wollte nach zwei gescheiterten Firmen mit Freunden wie Jack und Gary nicht ein drittes Familienunterneh- men gründen. So endete die Geschichte damit, dass es eines Tages in der Agen- tur zum Eklat kam: Ich feuerte Ivo, meinen eigenen Freund. Dem »Elite Model Look«-Wettbewerb in der Schweiz ein Gesicht zu geben, war schwierig. Weltweit rissen sich Modejour- nale, TV-Sender und Radiostationen um den jeweiligen Wettbe- werb - in der Schweiz fand sich nur schwerlich ein Medienpartner. Zwei Jahre nach unserem Start mit dem Wettbewerb schafften wir die Hürde: Wir gewannen das schwedische Modehaus H & M für zwei Jahre als Sponsor. Entscheidend dabei war die Schweizer Journalistin Suzanne Speich, die gerade mit ihrem eigenen TV-Sen- der Viva Swizz Erfolg hatte. Sie strahlte mehrmals täglich Trailer aus, mit dem Ergebnis: Die Agentur Option und der »Elite Model Look« wurden bei den Jungen ein Gesprächsthema. Und dann gewann 1995 zum ersten Mal eine Schweizerin den renommiertesten Modelwettbewerb der Welt: Sandra Wagner. Plötzlich spielten die Medien verrückt. Ich gab Interviews. Ständig war mein Bild in Zeitungen. Nun interessierte sich auch die gröibte Sonntagszeitung der Schweiz, der »SonntagsBlick«, für diesen Wettbewerb.
- 2 0 5
- Indien, Tibet, der Dalai Lama oder Weihnachten mit Richard Gere
- »Was denkst du eigentlich über den Dalai Lama?«, fragte mich Ursula eines Tages im Jahr 1996 aus heiterem Himmel. Eine etwas seltsame Frage. »Nun, ich bewundere ihn«, erwiderte ich. »Aber ich persönlich stehe Gurumayi von Siddha Yoga näher. Richtung Hindu.« Ursula war erstaunt. »Ich wusste gar nicht, dass du dich mit so was beschäftigst.« »Na ja«, meinte ich, »du weißt einiges nicht. Es gab eine Zeit, da ich jeden Morgen um sechs Uhr aufstand und die >Guru Gita< sang, mit Kopfhörer und entsprechendem Tape, danach eine Stunde meditierte. Warum fragst du?« Ursula holte tief Luft: »Ein Freund von mir hat vorgeschlagen, mit dem >Elite Model Look< ein Zeichen für ein freies Tibet zu set- zen, was meinst du dazu?« Ich bat um Bedenkzeit und wandte mich an die Stylistin Dawn Cleis, die dann die Idee hatte, unsere aufstre- benden Models anlässlich der Tibet-Gala in Zürich in bodenlanger Tibet-Seide laufen zu lassen. »Das bringt«, sagte sie, »Publicity und macht die Schweiz auf das unsägliche Leid der Tibeter aufmerk- sam.« Ich war sofort Feuer und Flamme: »Dawn! Eine geniale Idee, das machen wir.« Die große Tibet-Gala sollte im Casino Zürichhorn in Zürich stattfinden. Und kein Geringerer als der Hollywoodstar und Dalai-
- 2 0 6
- Lama-Vertraute Richard Gere sollte persönlich erscheinen, als Köder für die Tickets, die immerhin 350 Franken kosteten. Alle Gelder gingen natürlich an die Stiftung des Dalai Lama. Und so halfen wir, diesen Event in Absprache mit der offiziellen Vertreterin des Dalai Lama in Genf zu organisieren. Tschundak war zu jener Zeit die politische Repräsentantin des geistigen Ober- haupts der Tibeter, eine kleine, energische Frau. Ich mochte sie sofort. Bei der Show am Zürichhorn waren sämtliche tibetischen Orga- nisationen der Schweiz anwesend, um den Gästen ihr Land und ihre Kultur näherzubringen und um Spenden für den tibetischen Freiheitskampf zu sammeln. Die Model-Modeschau diente ihnen sozusagen als das Megafon, das nötig war, damit die Presse ihre Stimme hörte. Ursulas Bekannter, der die Sache ins Rollen gebracht hatte, war Schweizer Statthalter der Richard-Gere-Stiftung, ein talentierter Mann mit großartigen Ideen, doch er tendierte dazu, sich von eben- jenen Ideen derart mitreißen zu lassen, dass er sie bereits verwirk- licht glaubte, lange bevor dies denn tatsächlich der Fall war. Und so hatte er ganz Zürich bereits lange vor dem Event mitgeteilt, dass Richard Gere persönlich anwesend sein würde. Ich hatte meine Wohnung in Zürich einem Freund von Richard Gere zur Verfügung gestellt, der als Übersetzter für den Dalai Lama arbeitete. Dieser Ubersetzer sagte: »Also, ich bin nicht sicher, ob Gere wirklich nach Zürich kommt! Er dreht gerade einen Film.« Tatsächlich wusste Gere nichts von seinem Termin in Zürich. Aber Ursulas Freund brachte es immerhin fertig, dass Richard Gere nach einem mehrgängigen tibetischen Essen, tibetischen Gesängen und Volkstänzen und unserer Modeschau auf einer Leinwand er- schien und uns aus der Ferne eine Botschaft zukommen ließ. Auch eine gute Leistung: Richard Gere wurde von den Gästen frenetisch beklatscht. Tage nach diesem Fest zu Ehren von Tibet erhielten Ursula und ich zum Dank eine Einladung aus Genf, um in Indien dem Kala-
- 2 0 7
- chakra-Ritus des Friedensnobelpreisträgers Dalai Lama höchstper- sönlich beizuwohnen. Es war Madame Tschundak, die uns die Ein- ladung übermittelte. Das Kalachakra-Ritual ist eine feierliche Beschwörung, soll ein würdiger und erhebender Beitrag zum Weltfrieden sein, es soll das Mitgefühl mit allen lebenden Wesen, den interreligiösen Dialog, die Toleranz zwischen Völkern und Rassen, das ökologische Bewusst- sein, die Gleichberechtigung der Geschlechter, den Frieden der Herzen, die Entwicklung des Geistes und die Glückseligkeit für das dritte Jahrtausend fördern. Kalachakra ist der Name eines bud- dhistischen Weisen, der während der Zeremonien in einem Wand- bild über dem Thron des Dalai Lama gezeigt wird, vereinigt mit der Zeitgöttin Vishvamata. Und so flogen Ursula und ich nach Indien. Mit der Warnung von Ursula: »Urs, du warst noch nie in Indien. Da gibt es keinen Luxus. Ich sage dir das jetzt. Denn ich habe keine Lust, mir hinterher Vor- würfe anzuhören.« Mein erstes Hotelzimmer in Neu-Delhi war so schmutzig, dass ich im Trainingsanzug schlief. Ursulas Zimmer war noch schmut- ziger und das unserer Reisebegleiterin Laura, einer italienischen Principessa, auch - so lag ich mit zwei Frauen in meinem Bett. Notabene: Sie zogen sich zum Schlafen auch nicht aus. Nach unserer Nacht zu dritt ein weiterer Flug, eine lange Auto- fahrt. Laura hatte uns Zimmer in einem Luxushotel reserviert, wel- ches allerdings eine Stunde Autofahrt von dem Ort weg lag, wo die täglichen Meditationen stattfinden sollten. Doch auch Richard Gere würde hier logieren. Ursula war begeistert von der Aussicht, in der Nähe dieses grau melierten Hollywoodstars zu nächtigen. Ich zog allerdings die zweite Möglichkeit vor, die Laura uns anbot: eine einfache Herberge direkt am Ort des Rituals; die Meditatio- nen würden um sechs Uhr morgens beginnen, und ich hatte keine Lust, noch früher als nötig aufzustehen. Ursula gab klein bei, und wir kamen in unserem kleinen, einfachen - und sehr sauberen - Hotel an.
- 2 0 8
- Wir saßen in der bescheidenen Hotellobby, als Laura aufsprang, nervös auf einen Mann am Empfang zutänzelte: Richard Gere. Nun war es auch um Ursula geschehen. Natürlich war Gere, der sich 1980 in »American Gigolo« verkauft hatte, sich zehn Jahre spä- ter in »Pretty Woman« in eine Prostituierte verknallte, ein toller, charismatischer Mann. Und anscheinend auch einer, der morgens nicht früher als nötig aufstehen wollte. Laura stellte uns vor. Ich hatte den Eindruck, dass das Gere auf die Nerven fiel. Aber er war sehr freundlich, schüttelte uns höflich die Hand. »Laura«, sagte er, »ich bin ganz allein hier. Kann ich dich zum Abendessen einladen?« Laura strahlte. »Aber gerne! Allerdings nur mit meiner Schwei- zer Familie hier.« Richard grinste. »Also gut. 19 Uhr in der Lobby?« Das Abendessen war lustig, wir lachten gemeinsam. Als Richard realisierte, dass wir die Leute aus Zürich waren, die den »Elite Model Look« in den Dienst von »Free Tibet« gestellt hatten und ich der Typ war, der seinem Freund die Wohnung zur Verfügung gestellt hatte, entspannte er sich. Da wusste er, dass wir nichts von ihm wollten. Und wir behandelten ihn wie jeden anderen auch - und sabberten nicht bei seinem Anblick. Das gefiel ihm. Am nächsten Morgen standen wir sehr früh auf, um an der ersten Kalachakra-Meditation teilzunehmen. Wir waren privilegiert, durf- ten in der VIP-Sektion sitzen - was im Grunde völlig schnuppe war. Wenn Seine Heiligkeit der Dalai Lama zur Meditation aufruft, ist es egal, wo man sitzt, vor allem angesichts der Tatsache, dass viele der 250000 Teilnehmenden, vor allem Tibeter, auf Pferd und Esel gekommen waren und beträchtliche Strapazen hinter sich hatten. Unsere Freizeit verbrachten wir drei mit Richard Gere. Er stand übrigens jeden Morgen eine Stunde früher auf als alle anderen und meditierte mit dem Dalai Lama und den Priestern, bis alle anderen eintrafen. Gere wurde ständig beobachtet, verfolgt. Als die indischen Fans
- 2 0 9
- Richard einmal zu sehr bedrängten, spielte ich mich als sein Body- guard auf. Ich stand auf, schaute die Schaulustigen streng an und sagte leise, aber drohend: »Lasst Mister Gere in Ruhe!« Es funktionierte! Sie gingen. Richard meinte: »Dich könnte ich glatt engagieren.« Am ersten Weihnachtsabend lud uns Richard ein. Seine dama- lige Freundin und jetzige Ehefrau Carey war inzwischen angekom- men. Und er stellte uns als seine »Swiss family« vor. Am letzten Tag des Kalachakras dinierten wir wieder alle zusam- men. Dann sollten sich unsere Wege trennen. Dachten wir. Unser Indienerlebnis endete mit einer wunderbaren mehrtägi- gen Reise zu verschiedenen buddhistischen Klöstern, und in einem Gästehaus inmitten der weltberühmten Darjeeling-Teeplantagen, das ehemals einem britischen Kolonialherren gehört hatte, trafen wir zufällig noch einmal auf Richard und Carey. Richard fragte mich, wie ich den Dalai Lama im Vergleich zu Gurumayi empfunden hätte. Ich erklärte kurz, dass ich mich hin- und hergezogen fühlte. Ich war vom Dalai Lama überaus beein- druckt, hatte jedoch zu Gurumayi einen persönlichen Kontakt gehabt, den ich als sehr bindend empfand. Und außerdem war ich ja protestantisch erzogen worden, mit Jesus Christus als Vorbild. »Ja«, meinte Gere, »Carey schwärmt ebenfalls von Gurumayi. Ich möchte sie auch gerne kennen lernen.« Er schwieg einen Moment, dann sagte er: »Weißt du, Gott hat viele Facetten. Wenn du meditierst, schließ einfach Jesus, Guru- mayi und Seine Heiligkeit den Dalai Lama ein. Irgendwann wirst du wissen, welcher Weg der richtige für dich ist.«
- 2 1 0
- Models, Sex, Skandal oder Eine konstruierte Enthiillungsgeschichte mit Folgen
- Ich muss leider zugeben, dass das Verhältnis zwischen mir und Ursula immer schwieriger wurde. Und dann erschien 1999 die BBC- Dokumentation des Enthüllungsjournalisten Donald Maclntyre, die die Modewelt durcheinanderwirbelte. Maclntyres Reportage zeigte Nachwuchsmodels im Sold von Elite, von Lohdon bis Kiew und von Moskau bis Neu-Delhi, über Monate hinweg gefilmt, mehrheitlich mit versteckter Kamera. Die Aussagen dieser Mädchen, von Maclntyre geschickt montiert, berichteten von gewissen Praktiken bei Elite, die sexuellen Miss- brauch Minderjähriger und Drogenkonsum suggerierten. Elite-Gründer John Casablancas, seine Partner, der Schweizer Alain Kittler und Gérald Marie, waren erschüttert, hofften, die Aufregung lege sich schnell. Eine Illusion. Nicht einmal einem Heer von Anwälten gelang es, diese angeblichen »Enthüllungen« aus der Welt zu schaffen. Vor allem Gérald Marie, den C E O von Elite Europa und Expart- ner von Linda Evangelista, dem der Ruf eines unverbesserlichen Frauenhelden vorauseilte, brachte die Sendung wegen seiner Bezie- hungen zu zahlreichen Models in Bedrängnis. Maclntyre hatte das Vertrauen meines Freundes Gérald Marie ausgenützt. Nur: Die Redlichkeit des ach so brillanten Reporters Maclntyre stellte sich bald als sehr brüchig heraus. Es war die BBC selbst, die dies in einer Gegenrecherche enthüllte. Von Elite gefordert, leitete
- 2 1 1
- die BBC eine Untersuchung ein. Es wurden 170 Videokassetten mit Maclntyres Recherchen analysiert, alle Drehorte besucht, mit allen zitierten Zeugen gesprochen und die Spesenabrechnung zer- pflückt. Mit dem bizarren Ergebnis: Der Dokumentarfilm war über weite Strecken erfunden. Schlimmer noch: Die BBC sprach von »ver- suchter Anstiftung zu Falschaussagen«, rufschädigenden Appellen an die Presse und von Druck, der auf die jungen Frauen ausgeübt worden sei. Der Imageschaden für die Modeindustrie und Elite war jedoch längst angerichtet. Viele Kunden reagierten aufgeschreckt. US- Gigant Gillette beschloss, Elite zu boykottieren. Auchan, De Well, L'Oreal sowie Procter & Gamble drohten Elite mit dem Abzug von Werbemillionen und der Nichtbeschäftigung von weltweit fast 750 Starmodels, darunter 600 weiblichen. Natürlich mussten auch wir in Zürich kämpfen, um unseren guten Ruf nicht zu verlieren. Ich fand es so grauenvoll, was über Gerald erzählt wurde, dass ich eine Mail an alle Elite-Agenturen und die über sechzig »Elite Model Look«-Organisatoren weltweit sandte. Ich forderte sie auf: Jetzt müssen wir loyal zu Gerald Marie und zu Xavier Moreau, dem Präsidenten des »Elite Model Look«, stehen. Zumal John Casablancas sich von Marie distanziert hatte. In der Schweiz war der Teufel los. Unser neuer »Elite Model Look«-Sponsor, ein Modehaus, kehrte uns den Rücken. Begrün- dung: Man könne es sich nicht leisten, einen Modelwettbewerb zu unterstützen, dessen Verantwortliche nun das Image hatten, sie würden anzügliche Bemerkungen über Minderjährige machen oder die Mädchen sogar missbrauchen. Ich stellte mich der Presse und verteidigte die Agentur Elite. Besorgte mir per UPS aus London eine Kopie des Filmes und lud - bereits am Tag nach der Erstausstrahlung auf BBC - die wichtigs- ten Presseleute ein, den Film bei mir zu Hause anzusehen. In der Sendung »Talk täglich« beantwortete ich, zusammen mit Lisa Giger, Chefin der Agentur Time, kritische Fragen von Roger
- 2 1 2
- Schawinski. Wir nahmen das Model Sarina Arnold mit, damit sie der Öffentlichkeit von ihren eigenen Erfahrungen im Modebusi- ness und insbesondere mit Elite erzählen konnte. Aber zurück zu Ursula und mir. Je länger wir zusammenarbeite- ten, desto schwieriger wurde es. Außerhalb Zürichs verstanden wir uns bestens. Vor allem auf Geschäftsreisen lachten wir viel und ge- nossen die Tage weit weg von der Agentur. Aber es sind ja immer die kleinen Stiche, die mürbe und müde ma- chen. Ich versuchte, den Frust im Geschäft zu verdrängen, indem ich wieder zu trinken begann. Immerhin, ohne dem Geschäft zu scha- den. Nie ließ ich Kunden sitzen oder warten. Ich blieb zuverlässig. Irgendwann war es dann zu viel! So geriet ich nach einem Fest sternhagelvoll in eine Polizeikontrolle. In meinen Adern floss Alko- hol beinahe pur, und ich landete vor Gericht. Ich war unzufrieden und unglücklich - klammerte mich aber an Option. Schließlich florierte das Geschäft, ich war erfolgreich. Und feierte prompt mehr, als mir guttat. Was Kunden nicht störte, störte Ursula und ihren Mann, der mich eines Tages zur Rede stellte. Nicht, wie ich vermutet hatte, wegen meiner Trinkerei, nein, es ging um Geld. Er wollte mich mit einer privaten Bürgschaft ans Geschäft binden. Daraufhin zog ich mich nach Klosters zurück. Dort ging es mir gut. Klosters begann, meine zweite Heimat zu werden. Den Kunden war das egal. Schließlich war ich rund um die Uhr zu erreichen - egal, ob ich den Telefonhörer in Zürich oder in Klos- ters in die Hand nahm. Ich war gerne der »Außenminister« von Option. Auch als wir für die Schweizer Boutiquen-Königin Trudie Götz in St. Moritz den Polo-Ball organisieren durften. Sie, ehemalige Fotogen-Kundin, buchte nun bei Option. Der Polo-Ball fand im »Badrutt's Palace« statt, im Hotel der Familie des Freundes, der mich in New York zweimal so bereitwil- lig bei sich hatte wohnen lassen. Das eine Mal mit weggeschlosse- nem Alkohol.
- 2 1 3
- In diesem Jahr war die Designerin Donna Karan der Stargast, Trudie Götz wrollte ihre Kollektion einführen. Ich engagierte die Supermodeis Pat Cleveland, Mark Vanderloo, Marcus Schenken- berg, Gabriel Hill, der mit seiner damaligen Freundin Kate Moss erschien. Kate wäre mir zuliebe sogar aufgetreten, doch sie hatte einen Exklusiwertrag mit Calvin Klein. Es wurde richtig gut in St. Moritz. Im Verlauf der Show trat ein netter, blonder Mann auf mich zu: »Sie sind doch der Chef dieser Models?« Ich bejahte. »Ich würde Sie gerne zum Essen einladen.« Ich grinste frech. »Wollen Sie mich einladen? Oder die Models?« Er errötete: »Beides.« So brachte ich den deutschen Fußballstar und späteren Na- tionaltrainer Jürgen Klinsmann und Debbie Chin, ehemalige Welt- siegerin des Elite-Model-Wettbewerbs, zusammen. Zwei Jahre spä- ter heirateten die beiden.
- Aga Khan, Streit, Schlussstrich oder Ich kaufe mir ein Haus in Klosters
- Einer meiner ältesten Freunde ist This Brunner, der in Zürich seit 35 Jahren Kino-Geschichte schreibt, mit seinen Kinos der Art- house-Gruppe oder als Präsident der Douglas Sirk Foundation. 1997 hatte er mich zur Premiere des Filmes »Sieben Jahre in Tibet« eingeladen; der Regisseur dieses Filmes mit Brad Pitt in der Haupt- rolle war einst auch mein Regisseur gewesen: Jean-Jacques Annaud.
- 2 1 4
- »Auch der Aga Khan kommt«, erzählte This. Ich humpelte an Krücken, da ich vor kurzem zusammengeschlagen worden war. Und da kam tatsächlich der Aga Khan, einer der reichsten Männer der Welt, auf mich zu, ein mitfühlendes Lächeln im Gesicht: »Ach, Sie müssen der Gentleman sein, der von Rassisten angegriffen wor- den ist. Mein Freund This hat mir davon erzählt.« Dass ich von Aga Khan später wieder hören sollte - auch das ist irgendwie ein Wink meines doch recht eigenartigen Schicksals. Eines Tages sagte mir This: »Ich habe gerade einen Anruf erhalten, vom Aga Kahn. Er bittet mich, mich um Richard Gere zu kümmern, der hier in der Schweiz bei ihm war und nun nach Zürich kommt. Nun, und jetzt kommt es: Richard möchte dich sehen. Du hast mir gar nie erzählt, dass du ihn so gut kennst.« Ich erklärte, dass ich ihn auf einer Indien-Reise durch eine gemeinsame Freundin kennen gelernt hatte. »Ach Urs, und bring doch bitte noch ein junges schönes Model mit.« »This«, meinte ich abwehrend, »ich glaube nicht, dass das im Sinne von Richard wäre. Kann ich nicht einfach Ursula Knecht mit- nehmen? Meine Partnerin. Er mag sie, glaub mir. Er hat uns in Indien sogar zu sich nach New York eingeladen.« This: »Okay. Bring trotzdem ein Model mit.« Also rief ich Ursula bei ihrem wöchentlichen Hundetraining an. Als Model hätte ich gerne Sarina Arnold mitgenommen, um sie Richard vorzustellen, sie war aber verhindert. Also lud ich Sandra Wagner ein. Es wurde ein schöner Abend. Doch es war auch der Abend, an welchem ich merkte, so geht es nicht weiter. Zwischen Ursula und mir wurde es schwieriger und schwieriger. So schwierig, dass ich davon gar nicht erzählen will. Ich mag keine schmutzige Wäsche waschen. Deshalb wird dieses Kapitel, das ein langes und schmerzliches in meinem Leben war, in diesem Buch das absolut kürzeste. Nur das noch: Ich hatte mir 1998 einen großen Traum verwirk- licht und ein eigenes Haus gekauft. Genauer gesagt, einen uralten
- 21.5
- Stall, den ich umbauen ließ. In Klosters, das mir definitiv zur Oase wurde. Und dort, in Klosters, haben Ursula, Hanspeter und ich im Büro meines Anwaltes unsere »Scheidung« unterschrieben. Sie schmerzte. Finanziell ebenso wie emotional. Schwamm drüber. Irgendwie war dies auch der Schlussstrich unter ein Leben zwi- schen Glanz, Glamour, Eitelkeit, Neid und viel, viel Show. Ich zog mich dorthin zurück, wo ich im Grunde am glücklichs- ten war und bin. In die Bündner Berge, an die frische Luft - zurück zu meinem Traum, endlich Schauspieler zu werden.
- Liebe und Verrat, Shakespeare auf dem Hafenkran oder Das Lehen ist schön
- Mein Haus in Klosters war noch nicht fertig umgebaut, aber ich konnte darin wohnen. Mein eigenes Nest. Eines, das ich, nach vie- len Jahren der Wanderschaft allein, nur für mich geschaffen hatte. Auf keinen Fall wollte ich wieder abstürzen wie nach dem Tod von Eigil. Ich verbrachte nun fast meine ganze Zeit in Klosters. Noch zu Option-Zeiten hatte ich einen wunderbaren November in Klosters erlebt. Die großen Hotels waren geschlossen, »Indian summer« im Bündnerland. Perfekt, um mich vom Stress bei Option und mei- nen nächtlichen Barausflügen in Zürich zu erholen. Hier oben wusste ich: Das Leben ist schön. Das Wetter kann wunderbar sein. Und wenn Schnee liegt - na, dann kenne ich keine Grenzen. Zumal, wenn ich wie in diesem Jahr mit meiner Mutter Weihnachten feiern konnte.
- 2 1 6
- Auch das Skifahren sollte nicht zu kurz kommen. Gemeinsam mit Zizi Thynne unternahm ich damals wöchentlich bis zu vier Ski- touren. Morgens gegen sieben Uhr mit der ersten Gondel hoch auf die Madrisa, Ovomaltine auf 1887 Meter über Meer. Dann auf das 2394 Meter hohe Schaffürgli. Lawinensuchgerät einschalten, run- ter zum Madrisa-Lift, hoch auf das 2600 Meter hohe Ratschajoch. Mit schnellen, weiten Schwüngen zur Schafcalanda. Traversieren Richtung Schlappinerjoch, Felle an die Skis schnallen, für den wirk- lichen Aufstieg. Oben, am Grenzstein zu Osterreich, eine spektakuläre Aussicht. »Urs«, meinte Zizi, die reiche und schöne und wunderbare Bri- tin, »möchtest du, mein schöner Schwarzer, wirklich die Abfahrt nach Osterreich wagen?« »Klar! Warum nicht? Herrliches Wetter!« »Na, das ist doch jetzt FPO-Land«, meinte sie, darauf anspie- lend, dass der rechte Jörg Haider das Land in eine seltsame dumm- politische Ecke geführt hatte. So ein Schmarren! Schnee ist weiß. Ich bin schwarz. Also runter ins Tal! Nach einem sensationellen Wurstsalat ging es per Taxi - anders war es nicht möglich - zurück in die Schweiz. Nach Klosters. In einem Zürcher Restaurant hatte ich - ebenfalls noch vor dem definitiven Aus bei Option - Geretta Geretta getroffen, eine schwarze Filmemacherin aus Los Angeles, mit der ich vor vielen Jahren einen Film in Rom gedreht hatte. Sie bot mir spontan eine Hauptrolle in ihrem neuen Filmprojekt »Sweetiecakes« an. Ich nahm das Angebot, in diesem Low-Budget-Film mitzuspielen, an. Gerettas Vorschlag war meine Rettung. Zumal mein Freund This Brunner von ihr und dem Drehbuch so begeistert war, dass er Co-Produzent wurde und über die Commercio Movie AG mithalf, den Film zu produzieren. Als es mit Option zu Ende ging, rief ich, nach vierzehn Jahren Funkstille, meinen alten Schauspielagenten Fernando in Rom an. Wir hatten seit dem Abschluss des Filmes »Der Name der Rose« nichts mehr voneinander gehört. Das einzige Lebenszeichen, das
- 2 1 7
- ich in dieser Zeit von mir gegeben hatte, war eine Paketsendung gewesen, mittels deren ich Fernandos Frau Helen Kleider der Gary-Gatys-Kollektion zugeschickt hatte, als Dankeschön. »Bitte Fernando, nimm mich wieder auf. Nimm mich zurück als Schauspieler. Ich muss weg von Zürich, sonst sterbe ich.« »Was ist denn aus deinem erfolgreichen Geschäft geworden?« »Glaub mir, meine Zeit bei Option ist beendet. Bitte, gib mir noch eine Chance.« Fernando hüstelte. »Urs, die Filmbranche hier in Rom ist aber nicht mehr so, wie sie mal war. Bist du dir wirklich ganz, ganz sicher?« Ein Monat später: »Urs, kannst du nächsten Donnerstag nach Rom fliegen? Ein Regisseur will dich sehen. Für eine Gasthaupt- rolle in einem Fernsehkrimi mit Massimo Dapporto.« Na, und ob ich konnte! Obwohl: Ich sah alt aus, oder sagen wir: älter. Was würden Regisseur Alessandro Capone und die zwei Lom- bardos der Produktionsfirma Titanus von mir denken, mit denen ich verabredet war? Die Titanus ist eine der bekanntesten italienischen Filmproduk- tionsgesellschaften. Von Gustavo Lombardo gegründet, wurde die Firma schließlich von seinem Sohn und dann von seinem Enkel weitergeführt. Mit diesen beiden Lombardos der zweiten und der dritten Generation sollte ich mich nun treffen. Das Glück war mir hold. Ich bekam die Rolle. Fleißig lernte ich meinen Text für die bevorstehenden Drehar- beiten an Massimo Dapportos Seite. Ich sollte in dem Film einen Nigerianer spielen! Ich hatte mich mein Leben lang auf die eine oder andere Weise nach einem erwachsenen Mann aus Nigeria gesehnt. Meinem Vater. Mal mehr, mal weniger. Mal so wenig, dass es mir überhaupt nicht bewusst war. Mal so sehr, dass ich aktiv nach ihm suchte. Meine Sehnsucht, meine Neugier nach meinem Vater kam in Wel- len. In meinem Verhältnis zu diesem fehlenden Mann in meinem
- 2 1 8
- Leben war ich immer ein Kind geblieben. Was mich und meinen Vater betraf, so war ich nie erwachsen geworden. Ich hatte nicht, wie andere Kinder, erlebt, dass man neben seinem Vater älter wird. Und jetzt, da ich mich auf diese Rolle im Film »II commissario« vorbereitete, in der ich einen nigerianischen Vater verkörpern sollte, traf mich die Erkenntnis wie ein Schlag: Ich war längst sel- ber alt genug, um ein Vater zu sein. Der Mann, den ich mir in mei- nen Kindheitstagen als meinen Vater vorgestellt hatte, war ich nun selber. Ich war erwachsen geworden, ohne ihn. Ich lief durch Klosters, lernte meine Rolle und nutzte die Zeit, in mich zu horchen. Ich sollte in dem Film einen ehemaligen nige- rianischen Drogenfahnder spielen. Einen Mann, der in Afrika unter widrigsten Umständen gelebt hatte, bis er sich schließlich auf dem Seeweg, in einem Container versteckt, über die Grenze nach Italien schmuggeln ließ. Der Arbeitstitel der Produktion war »Liebe und Verrat« - ein Titel, der für mich sehr viel beinhaltete. Als ich zu den Dreharbeiten nach Pisa fuhr, hörte ich von irgend- woher immer Menschen, die mir »Ari! Aristoteles« zuriefen. Ich war angespannt, aber auch voller Zuversicht - obwohl ich, abgese- hen von Geretta Gerettas Film, in den letzten vierzehn Jahren über- haupt nichts mehr gedreht hatte. Beim gemeinsamen Abendessen klärten mich meine Schauspiel- kollegen über die »Ari«-Rufe auf. Sie schwärmten davon, wie popu- lär mein Füm »L'allenatore nel pallone«, den ich 1984 gedreht hatte, mittlerweile geworden war. Meine Nervosität verflog. Ich war in Italien so etwas wie ein Star! Ich hätte kaum geglaubt, dass sich nach vierzehn Jahren fümfreier Zeit noch irgendjemand an mich erinnerte. Es tat mir gut, all die- sen Goodwill zu spüren, die Sympathie, die mir von allen Seiten entgegengebracht wurde. Nach dem Essen kam der Star des Filmes, Massimo Dapporto alias Commissario Cruciani, auf mich zu. Freundlich, offen, un- kompliziert. Und fragte, ob ich eventuell Zeit hätte, die Rolle mit ihm zu besprechen.
- 2 1 9
- »Weißt du, mein Englisch ist nicht so gut. Und du sprichst deine Rolle ja auf Englisch. Da dachte ich, wenn du nichts dagegen hast, könnten wir unseren Text jeweils morgens gemeinsam durchgehen, um uns an den Klang der anderen Sprache zu gewöhnen.« Er war mir auf Anhieb sympathisch; keinerlei Starallüren. Un- sere Wohnwagen standen am Hafen, gleich nebeneinander. Wir setzten uns davor hin und gingen die Szenen gemeinsam durch. Er auf Italienisch, ich auf Englisch. Es ging darum, den Rhythmus der anderen Sprache zu hören, zu verinnerlichen, und abzustimmen, wann der eine mit dem Reden aufhörte und der andere anfing. So saßen wir da und lasen laut unsere Texte. Doch bereits nach weni- gen Sätzen brach Massimo in ein dröhnendes Lachen aus. »Mensch«, sagte er vergnügt, »was machen wir hier bloß? Lass uns einfach einander in die Augen schauen. Dann werden wir ja wohl merken, wann der andere mit seinem Text fertig ist, oder?« Wir probten es. Und es funktionierte. Blicke haben universale Gültigkeit. Als wir dann zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera stan- den, ging es gleich um eine sehr dramatische Szene. Ich musste ihn, um unserer alten Freundschaft aus gemeinsamen Tagen in Afrika willen, bitten, nicht auf den Verdächtigen zu schießen, falls sich her- ausstellen sollte, dass es sich bei ihm um meinen verlorenen Sohn handelte. Ich spielte einen verlogenen Charakter, einen Verräter, der aber guten Grund zur Lüge hatte. Während ich in Wirklichkeit den Mörder meines Sohnes suchte, um seinen Tod zu rächen, gab ich vor, auf der Suche nach meinem Sohn zu sein, der angeblich noch am Leben war. Nun, bei dieser ersten Szene ging es schließlich darum, Massimo davon zu überzeugen, mich fünf Minuten mit dem Verhafteten alleine zu lassen. Da es sich bei dem Kerl - so behauptete ich - um meinen Sohn handelte. Wir sahen uns also tief in die Augen, wie wir es geübt hatten. Und fingen beide an zu heulen. »Stopp!«, rief Alessandro. »Mamma mia, was macht ihr da?«
- 2 2 0
- Massimo wankte ab. »Emotionen. Nur kurz. Jetzt sind wir pronto.« Sechs tolle Monate folgten. Sechs Monate, in denen ich mich auf jede einzelne Szene an der Seite dieses großen Schauspielers freute. Ungefähr alle zehn Tage flog ich in die Schweiz zurück. Zumin- dest, wenn ich mindestens drei Tage in Folge nicht am Set sein muss- te. Dann vergewisserte ich mich, dass es mit dem Umbau meines Hauses voranging, traf meine Freunde. Genoss mein neues Zu- hause, in das ich nach den Dreharbeiten zurückkehren würde. Der Schluss des Filmes bestand, nachdem ich den Mörder mei- nes Sohnes erstochen hatte, aus einer wilden Hetzjagd. Schließlich stellte mich Massimo im Hafen von Genua, wo ich mich auf einem Kran verschanzte, hoch über dem Boden. Ich wartete dort oben, bis die Szene beginnen würde. Wie immer bereitete ich mich gut vor, horchte tief in mich hinein. Diese Rolle übte nach wie vor eine ganz besondere Anziehungskraft auf mich aus. Ich fühlte mich, als wäre ich selber der Vater, der erwachsene Mann an meiner Seite, den ich so lange vermisst hatte. Plötzlich war ich mir selbst genug. Da hörte ich: »Take one! Action!« Langsam schritt ich auf die Plattform des Hafenkranes und rich- tete meine Pistole auf Massimo, der mit schmerz- und wutverzerr- tem Gesicht tief unter mir am Boden stand. »Wo bist du, mein alter Freund?«, schrie er mit verzweifelter Stimme. »Du Verräter, du Stück Dreck! Hier bin ich. Töte mich doch auch!« Ich zielte mit der Pistole auf ihn und begann langsam und dra- matisch mit meinem Text: »Denkst du, dort, wo ich herkomme, ist es einfach, ein Held zu sein? Wo ein Leben nichts zählt, und Hun- ger, Miseren und Tod den Alltag prägen?« Der Regisseur Alessandro rief durchs Megafon zu mir herauf. »Stopp!«, rief er. »Mensch, Urs, wir machen hier nicht Shakespeare, sondern einen TV-Krimi! Himmel noch mal!« Seine Worte prallten an mir ab. Ich war tief bewegt. Ich stand dort oben, zig Meter über dem Boden auf einem Baukran und sah
- 2 2 1
- auf den Rest der Filmcrew hinab. Es war ein wichtiger Moment in meinem Leben. Denn ich spürte, dass in mir ein Kapitel abgeschlos- sen war. Dass eine lebenslange Suche für mich zu Ende war. Dass ich irgendwie, durch die intensive Vorbereitung auf diesen Film, mit meiner Hautfarbe, meinem Vater, seinem Land, meinen fehlen- den Wurzeln abgeschlossen hatte. Ich brauchte nichts mehr. Ich hatte mich gefunden. Dann blieb nur noch eine Szene. Ich wurde abgeführt. Laut Drehbuch sollte ich dabei Massimo ein letztes Mal tief in die Augen sehen. Ich ließ mich per Funk mit Alessandro verbinden. »Ist es okay, wenn ich die Szene leicht abändere?«, fragte ich ihn. »Urs, alle Kameraeinstellungen sind vorgenommen, was ist denn?« »Keine Angst, alles bleibt beim Alten. Aber lass einfach die Ka- meras laufen, wenn ich etwas anfüge, okay?« Ich schaute dann Massimo lange in die Augen. Und dann stieß ich plötzlich hervor: »Bitte, bete für meine Seele!« Sehr dramatisch. Und es passte. Es war mir einfach wichtig gewe- sen, für meinen Verrat um Vergebung, um Verständnis zu bitten, obwohl eine solche Äußerung im Drehbuch für meinen Charakter gar nicht vorgesehen war. Ich hatte so viel Persönliches in diese Rolle gelegt, bei der Vor- bereitung so sehr über »Liebe und Verrat« in meinem Leben nach- gedacht. Während ich darüber sinniert hatte, dass meine Figur einen sehr guten G r u n d hatte, ihren besten Freund zu verraten, einen Grund, der allein in der Vergangenheit und völlig außer Kon- trolle lag, war mir ein Licht aufgegangen. Und so fühlte ich mich, nach einem Leben ohne Vater und nach vielen Enttäuschungen, was meine Beziehungen anbelangte, zum ers- ten Mal in meinem Leben von niemandem mehr im Stich gelassen. Erst später, als ich mich ganz in meine Heimat zurückgezogen hatte, nach Altdorf, in die Nähe meiner Mutter, sollte mich meine Hautfarbe wieder einmal einholen.
- 2 2 2
- Neger bleibt Neger, schwarz bleibt schwarz oder Wie ich zusammengeschlagen wurde
- 21. März 2009, vier Uhr morgens, Altdorf: Ich bin unterwegs. Warum nicht? Selbst im biederen Altdorf gibt es Lokale, um »the last for the road« zu zelebrieren. Schließlich wirbt mein geliebtes Altdorf ja mit einer jungen Kampagne für ein Uri »voller Action«. Als Nachtmensch gehe ich selten früh oder sagen wir mal häu- fig spät zu Bett. Das hat mein Leben so mit sich gebracht. Ja, das Nachtleben war Teil meiner Arbeit als Model, als Filmschauspie- ler, als Agenturboss. Doch was geschah in dieser Nacht in Altdorf? Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich kam aus einer Bar, deren Namen ich jetzt hier nicht in Ver- ruf bringen will. Ich wollte nach Hause, suchte ein Taxi, das mich nach Flüelen fahren sollte. Dann krachten Schläge auf mein Gesicht. Fäuste aus der Dunkelheit. Sie hämmerten gegen meine Schläfen, gegen meinen Kopf. Sie donnerten gegen mein Kinn. Meinen Mund. Nicht einmal, mehrmals, immer wieder rein ins schwarze Gesicht. Ganz so, als würde es den Schlägern unheimlich viel Spaß machen, mein Gesicht, ja mein Ich zu zerstören. Als hätten die ge- wartet, bis der »schwarze Teil aus Altdorf« nachts allein ist. Um ihre feigen Fäuste an einem auszutoben, der von körperlicher Gewalt nichts, aber auch gar nichts hält. Aber eben: Für manche Menschen darf ein Schwarzer hier und anderswo keinen Erfolg haben, darf keiner sein, den in Altdorf und Flüelen jeder kennt. Darf hier und
- 223
- in anderen Teilen der Schweiz nicht frei und fröhlich rumlaufen, ohne zu wissen, wer das Sagen hat! Bereits nach wenigen gezielten Schlägen muss ich zu Boden gegangen sein. Was meine Peiniger nicht davon abhielt, weiter auf mich einzudreschen. Das bekam ich aber nicht mehr mit. Ich war längst ohnmächtig! Ich hätte wahrscheinlich lebenslange Schäden davongetragen, hätten mich nicht befreundete Jugendliche gefunden, als ich schein- bar leblos auf dem Boden lag, blutend aus all den Wunden im Gesicht. Die Bilanz des Uberfalls auf mich war fürchterlich: zweifacher Bruch des Kiefers und schwere Gesichtsverletzungen um Augen und Mund! Nebenbei bemerkt: Ich lebe auch von meinem Aussehen. Im Kantonsspital Luzern musste ich operiert werden. Es war eine schwierige Operation, die mir ermöglichen sollte, überhaupt meine Kieferpartien wieder zu nutzen, überhaupt wieder sprechen zu kön- nen. Meine Augen waren nur mehr blutige Schlitze, ich musste an der Zunge zweifach genäht werden. Und am Kinn an beiden Ge- sichtshälften mit vierzehn Stichen. Das schreibt sich leichter, als es zu ertragen war und ist. Ich wurde schon einmal brutal zusammengeschlagen! Das war vor mehr als zehn Jahren. Damals schlugen mich Neonazis in Zürich spitalreif. Als ich nach einem Abend im »Kaufleuten Club« auf dem Heimweg war. Plötzlich wurde ich von vier oder fünf Männern, alle in schwar- zen Stiefeln, angegriffen und verprügelt. Anders als in Altdorf, erinnerte ich mich aber, wie es dazu kam, dass sie aufhörten! Ich - der Neger - lag auf dem Boden und schrie in meinem brei- ten Urner Dialekt: »Scheiße, ihr habt mir den Fuß gebrochen!« Da schrie einer: »Scheiße, hört auf! Das ist der aus den Zeitungen!« Sie liefen weg, und ich verlor das Bewusstsein. Indirekt hatte mir die Presse mein Leben gerettet. Zumindest Schlimmeres verhindert.
- 2 2 4
- Die Polizisten, die damals von Passanten gerufen wurden, waren - nicht zum letzten Mal - unverschämt. Vielleicht mochten sie keine Schwarzen. Jedenfalls verhielten sie sich so unangemessen, dass ich mich weigerte, mich von ihnen in ihrem Wagen in die Universitätsklinik fahren zu lassen. Kaum aus der Bewusstlosigkeit erwacht, arbeitete mein Hirn schnell genug, um meinen Stolz zu aktivieren. So wurde ich von hilfsbereiten Passanten gefahren. Dies ist auf jeden Fall eine Parallele zu Altdorf, wo ich ebenfalls bis zur Bewusstlosigkeit zusammengeschlagen wurde. Und sich ein Ordnungshüter allen Ernstes mit den Worten zitieren ließ: Einen Selbstunfall schließe er nicht aus. Wie heute in Altdorf, war ich damals in Zürich ein Krümelhau- fen. Gebrochene Rippen, gebrochener Fuß, Bänderzerrungen, offene Gesichtswunden. Nur: Es besuchten mich damals andere Herrschaften! Topmodels flogen von London nach Zürich, um mich im Rollstuhl durch den Park des Universitätsspitals zu schieben. Oder Carol, die Tochter der britischen Premierministerin Margaret Thatcher, und ihr Lebenspartner Marco Grass. Wie heute in Uri stellte mir damals die Kantonspolizei Zürich Fragen. Hielt mir stapelweise Bilder von registrierten Schläger- typen hin. Also stellte auch ich Fragen. Diese Menge von Fotos? Ihr wisst also, um wen es sich handeln könnte? Es werden doch täglich Leute wahllos verprügelt. Oder nicht ganz so wahllos. Sind einige der euch bekannten Schlägertrupps spezialisiert auf Schwalle? Auf Ausländer? Menschen, die angetrunken sind - weil es da viel einfacher ist? Die Spitalangestellten bestätigten mir damals, dass solche Ubergriffe fast täglich stattfänden. Nur! Welche Politiker wollen schon lesen, dass schwarze Schwei- zer verprügelt werden? Schwarze Schweizer gehören doch nicht ins Bild der reinen, weißen Tourismuswerbung einer schönen, saube- ren, sicheren Schweiz!
- 2 2 5
- Heute bin ich schwarz genug, um zu sagen: Irgendwann müsst auch ihr lernen, dass ein Schwarzer kein Freiwild ist. Den man aus Lust und Laune entstellt! Das gilt natürlich für alle Menschen. Ich musste damals wie heute operiert werden - und ich konnte es Mama nicht verschweigen. Es war schon vor zehn Jahren schrecklich, ihr zu sagen: »Mama, dein Sohn liegt im Universitätsspital! Er wurde von Rassisten zu Brei geschlagen!« Und heute? Als ich in Mamas Heimat, in Altdorf, wie ein Stück Vieh zusammengeprügelt wurde? Was konnte ich da meiner Mutter sagen? Nicht mehr als damals. Nur: Mama ist zu alt. Sie leidet an Demenz. Sie erfuhr die schreck- liche Nachricht von meinem Patenkind Dimitri Moretti. Daraufhin brach die Krankheit vollends aus. Sodass Mama in ein Pflegeheim umsiedeln musste. Jetzt ist sie mal glasklar, dann wie- der nicht. Was Mama in ihrem Leben geleistet hat, ist fast übermenschlich. Mama hat ihr Leben lang für mich gekämpft, gelebt, auch gelitten - ich will sie jetzt nicht noch mit dem neuen Hass der einen oder anderen Rassisten konfrontieren.
- 2 2 6
- Ein Schweizer Leben oder Statt eines Nachworts
- Wie beendet man ein Buch? Schwer zu sagen. Ich habe ja noch nie eines geschrieben. Dies ist mein erstes. Und jetzt ist es auch schon wieder sechs Uhr morgens. Ich müsste längst im Bett liegen. Allein, zu zweit, egal. Aber nein! Ich sitze vor meinem Computer, dem Bildschirm, den ich immer mit der Spitze eines Messers erst zum Leben erwecken muss. Und sinne vor mich hin. Was hast du vergessen? Was bewusst weggelassen? Nicht viel. Vielleicht die eine oder andere private Episode. Sonst aber habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt, sehr weit. Wenn schon, denn schon: Mein Buch muss ehrlich sein! Wie könnte ich sonst meinen Freunden hier in Altdorf und Fliie- len unter die Augen treten, die mich seit Kindesbeinen kennen, die immer zu mir gehalten haben, in guten wie in schlechten Zeiten? Ich sitze da, in der Kühle des Morgens. Auf meinem kleinen Bal- kon, dreizehn Meter über dem Urnersee, zehn Meter vom Ufer. Die Wellen plätschern hier nicht. Das sind Urner Wellen. Die leben. Führen ein Eigenleben. Wie auch die gigantischen Berge, die sich jetzt vor einem rosig-blauen Himmel abzeichnen. Zu meiner Lin- ken hinter den beiden Kirchen der Bristen, der nicht nur morgens wie das Matterhorn aussieht, die Geißberge, der Krönten, gerade- aus der Gritschen, mein Lieblingsberg. Dann rechts Nieder- und Oberbauen und abschließend der Seelisberg.
- 2 2 7
- Was in dieser morgendlichen Idylle fehlt? Das Dampfschiff »Uri«. Das fährt nicht, das rudert sich geradezu über den See. Majestätisch, ohne Hätz, ohne Eile, ganz so, wie man leben müsste: Eilig haben es immer nur die anderen. Soll ich den Computer jetzt wirklich zuklappen? Hätte doch noch so viel zu erzählen. Wie ich als Kind in Uri im Gras lag und den TEE-Zug mit den elegant gekleideten Passagieren bewunderte, der auf der Gott- hardlinie Richtung Süden fuhr, wie ich die Flugzeuge beobachtete, die hoch über den Bergen ihre weißen Fahnen hinter sich her- zogen, und wie ich mich fragte, ob ich eines Tages auch so reisen würde. Wie ich zum ersten Mal allein durch New York schlenderte, an meinen verstorbenen Großvater dachte. In Schuhen unterwegs war, die für den eisigen Winter zwischen dem East und dem Hud- son River ganz und gar nicht gemacht waren. Ich fror, während ich von einem Ort zum anderen pilgerte, der mir aus Buch, Füm und Traum bekannt war. Der Central Park, Chinatown, Little Italy, The Village, das Empire State Building, die Brooklyn Bridge, der Sea- port, das World Trade Center und die Wallstreet. Als die Wirklichkeit größer war als meine Fantasie. Und auch kleiner: etwa die Freiheitsstatue oder die New Yorker Börse, beide kleiner und schäbiger, als ich sie mir vorgestellt hatte. Oder Rom, das ich täglich mit meinem H u n d Xtazy erkundete. Erst die paar Meter runter zum Lungotevere, begleitet von hupen- den Macchinas. Blick auf die winzige Insel vor dem Ospedale Santo Spirito, einem ehemaligen Kloster. Dann über den Lungotevere dei Tebaldi, zum Circo Massimo, zum Monument Vittorio Emma- nuelle, zum Forum Romanum. Die andere Route: Parioli, durch den Park der Villa Borghese zur Spanischen Treppe, dann die Via dei Condotti hoch Richtung Pan- theon, von dort über die Piazza Navona, am Trevibrunnen vorbei, die Via Veneto hoch, bis wir wieder im Park bei uns um die Ecke ankamen.
- 2 2 8
- »Urs! Wir schreiben kein >Merian<-Heft über New York, Rom, Paris oder Klosters!«, murrte hier mein »Neger« Helmut-Maria Glogger. Warum Neger? Weil - das und mehr habe ich vom ihm gelernt - ein »Neger« in seinem Jargon der ist, der einem anderen hilft, das Buch so in Form zu bringen, dass es eben kein »Merian«-Heft ist. Ich bin müde. Und mein Bett wartet. In einer Wohnung, die ich mir jetzt mit meiner alten Schulfreundin Esther Patocchi teile, einer Wohnung, die mir nicht gehört, die aber zu mir passt, wie meine Mutter: offen, großzügig, mit Weitblick. Die Welt sehen, lieben, wie sie ist. Oder besser: vielleicht sein könnte. Ein bisschen über dem Boden schweben gehört nun mal dazu. So. Jetzt ist noch lange nicht Schluss. Mit Leben, Lust, Leiden- schaft, Abenteuer, Schauspielerei. Gott sei Dank haben mich die Arzte gerettet. Ich freue mich auf die bevorstehenden Filmaufnah- men für einen Fernsehkrimi in Wien. Die Flasche Rotwein zu meinen Füßen ist leer. Und jetzt - bevor mein Computer sich mit einem leisen Surren verabschiedet, nur noch das: Langweilig war mein Leben keine ein- zige Sekunde. Ich hoffe, dass alle, die dieses Buch lesen, mit mir einer Meinung sind: Das wahre, echte Leben schlägt jeden Roman.
- Flüelen, im Juni 2009
- Anhang: Filme mit Urs Althaus
- Jahr Film Rolle Regie Sender 2009 Soko Donau Oskar Wecker Robert Sigl ZDF/ORF 2008 L'allenatore Aristoteles Sergio Martino Kino ncl pallone 2 2003/ Un mcdico George Isabella Leone RAI/TV-Serie 2004 in famiglia 2002/ II bello Mekho Maurizio Ponzi Mediaset/ 2003 delle donne TV-Serie 2003 Chiaroscuro Edwin Ross Tomaso RAI/TV-Serie Sherman 2001 II commissario Fernando Alessandro Mediaset/ M. Gomez Capone Fernsehfilm 2001 Valerio medico Luc- Elvio Porta Mediaset/ legale Fernsehfilm 2001 Sweetiecakes Rupert Geretta Geretta Kino 1986 Der Name Venantius Jean-Jacques Kino der Rose Annaud 1986 Another World Ravi Embassador NBC/TV-Serie 1985 Warbus Ben Ferdinando Baldi Kino 1984 L'allenatore Aristoteles Sergio Martino Kino nel pallone 1984 Arrapaho Arrapaho Ciro Ippolito Kino 1984 II quartetto Basileus Callboy Fabio Carpi Kino 1983 Das Martyrium Anführer der Petr Weigl Fernsehfilm des hl. Sebastian Bogenschützen 1983 Warrior of the Söldner David Worth Kino Lost World 1983 Progetto Terrorist Gianni Serra Fernsehfilm Atlantide 1983 ... e la vita continua Jerry Diño Risi Kino 1982 Oltre la porta Tunesier Liliana Cavani Kino 1981 Progetto di vita Ragazzo Giuseppe Fina Fernsehfilm
- 2 3 1
Add Comment
Please, Sign In to add comment