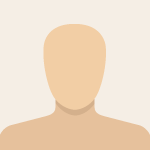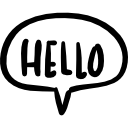Advertisement
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- Part 1/2
- Neil Boorman
- Bonfire of Brands
- Goodbye, Logo
- Wie ich lernte, ohne Marken zu leben
- Aus dem Englischen von Christoph Bausuni
- Econ
- Die Originalausgabe erschien 2007
- unter dem Titel Bonfire of the Brands
- bei Canongate, Edinburgh
- Econ ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH
- ISBN 978-3-430-20015-8
- © Canongate Books Ltd., Edinburgh
- © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2007
- Alle Rechte vorbehalten
- Gesetzt aus der Janson bei LVD GmbH, Berlin
- Druck und Bindung: CPI books Leck
- Printed in Germany
- Inhalt
- 17. September 2006 7
- Teil I: Einige Monate vorher 9
- Teil II: Countdown 45
- Teil III: Der Tag des Feuers 185
- Teil IV: Nach dem Feuer 195
- Epilog 281
- Danksagung 291
- Anmerkungen 295
- Literatur 299
- 17. September 2006
- Welches Poloshirt soll ich nehmen - das von Lacoste oder das von Gucci?
- Normalerweise trage ich tagsüber Lacoste, besonders dann, wenn ich mich jugendlich oder leichtsinnig geben will. Gucci ist eher perfekt für ein informelles Beisammensein oder einen Drink in einem eleganten Pub. Doch im Moment ist dieser Unterschied eigentlich egal. Ich schnappe mir beide vom Sta- pel meiner Polohemden, der sich mir ordentlich gefaltet dar- bietet. Neben den Shirts liegt ein Dutzend Hosen, auch sie präzise aufeinandergelegt, damit ich die Label der Hersteller sehen kann, so wie im Geschäft. Dann kommen Pullover, An- züge, Mäntel - und schließlich Schuhe: reihenweise Turnschuhe, schicke Brogues und Schnürschuhe aus Leder, Stiefel und Flip- flops. Ihr makelloser Zustand zeugt davon, wie viel Liebe und Zuneigung ihnen zuteil wurde, seit ich diese Sammlung vor mehr als zwanzig Jahren begann. Mit den Poloshirts in der Hand stehe ich auf und schaue auf eine Menge von vielleicht dreihundert Schaulustigen, die sich gegen die aufgestellten Absperrgitter drängen. Mit offenen Mündern, geröteten Wangen und weit aufgerissenen Augen schreien sie irgendetwas in meine Richtung. Der Geräuschpe- gel müsste ohrenbetäubend sein, doch unter dem Klopfen mei- nes Herzschlags werden alle anderen Laute zu einem undeut- lichen Hinlergrundrauschen. Ich drehe mich um, entferne mich von der A'Ienschen menge, was ein Blitzlichtgewitter zur Folge hat. Fotografen schubsen sich gegenseitig aus dem Weg, um in eine bessere Position zu kommen. Aus dem Augenwinkel sehe ich einen Mann mit ei- ner großen Fernsehkamera, der mich und meine kleinsten Be- wegungen im Visier hat, gefolgt von einem schick gekleideten sonnenbankgebräunten Reporter, der in ein Mikrofon quasselt. Nichts davon ist wichtig.
- 7
- Der Scheiterhaufen vor mir ist riesig. Er brennt so hell, dass man unmöglich einzelne Flammen unterscheiden kann - ein riesiges orangefarbenes Etwas, das die Augen blendet. Ich habe noch nie eine solche Hitze erlebt, sie versengt die Augen- brauen und die Haare, die mir ins Gesicht fallen, als ich noch näher herangehe. In drei Metern Entfernung ist sie nicht mehr zu ertragen, und ich muss wieder zwei Schritte zurücktreten. Jetzt oder nie. Ich hole aus und werfe die Shirts ins Feuer. Es sieht aus, als würden sie sich sofort in Luft auflösen. Ich gehe zurück zu meinem Kleiderstapel, mein Tunnelblick lässt nach - so, als ob ein riesiger Wollschal von meinem Kopf entfernt worden wäre. Plötzlich nehme ich meine Umgebung klar und deutlich wahr. Ich stehe auf einem öffentlichen Platz mitten in London, und vor mir auf dem Rasen liegt der mate- rielle Inhalt meines Lebens ausgebreitet. Um das Areal herum steht eine Menschenmenge. Sicherheitskräfte hindern die Leute daran, die Barrieren zu überklettern. Pyrotechniker laufen um- her und kümmern sich um das Feuer. Ein Mann in einem blauen Overall steht mit einem Vorschlaghammer bereit, um meinen LCD-Fernseher von Sharp und meinen Technics- Plattenspieler zu zerstören. Doch zuvor muss ich erst den Rest meiner Garderobe den Flammen übergeben. Die Helmut- Lang-Schuhe, die Louis-Vuitton-'Iasche, den Westwood - Anzug ... Doch jetzt, da der Moment gekommen ist, habe ich keine große Lust, diese Dinge wegzuwerfen. Lieber würde ich den ganzen Haufen zusammenklauben und mit nach Hause nehmen, wo er hingehört. Ratlos stehe ich vor diesem ganzen Zirkus und frage mich: Wie bin ich bloß hier hineingeraten?
- 8
- TEILI Einige Monate vorher
- 2. März 2006
- Ich bin ein angebissener Apfel, ein polospielender Reiter, ein schneebedeckter Berg. Auf der Arbeit will ich als kreativer Freigeist wahrgenommen werden, deshalb ist mein Computer ein Mac von Apple, weil den offenbar alle coolen Künstler- typen benutzen. Mein Poloshirt von Ralph Lauren ist bei den Jugendlichen aus den Sozialbau-Wohnsiedlungen sehr beliebt, und ich trage es, um ein bisschen tougher zu wirken. Ich trinke den ganzen Tag lang Wasser von Evian. Nicht weil es beson- ders gut schmeckt, sondern weil das Etikett den Effekt hat, dass ich mich gesund fühle und, nun ja, irgendwie besonders. Ich bin Londoner, weiß, gehöre der unteren Mittelschicht an - das, was die Demografen hier in England als ABC1 klassifizieren. Wenn Sie selbst ein Markenkonsument sind, dann können Sie das alles wahrscheinlich bestätigen, indem Sie mich einfach an- schauen. Wenn wir uns auf einer Party begegneten, dann würden Sie mich wahrscheinlich fragen, was ich arbeite, wo ich lebe und vielleicht noch, welche Schule ich besucht habe - eben die Fra- gen, die Ihnen helfen, sich ein Bild davon zu machen, wer ich bin. Ich würde Sie vielleicht das Gleiche fragen, aber vermut- lich würde ich bei Ihren Antworten nicht zuhören. Es ist wahr- scheinlicher, dass ich nach dem Etikett auf Ihrer Jeans, auf Ihre Schuhe und auf Ihr Mobil telefon schauen würde. Das sind die Dinge, die mir wirklich sagen, wer Sie sind. Unter Tausenden von Bekleidungs- und Handymarken, die es zu kaufen gibt, ha- ben Sie sich speziell diese herausgesucht. Sie haben sich dafür entschieden, weil sie zu dem Menschen passen, der Sie zu sein glauben. Oder vielleicht zu dem Menschen, der Sie gern wä- ren. Wenn ich bedenke, wie viel Zeit und Geld ich aufwende für die Kleidungsstücke, die ich trage, und die Dinge, die ich benutze, dann hoffe ich wirklich sehr, dass Ihnen an mir die gleichen Dinge auffallen. Die Wahrheit ist, dass ich eine sorgfältig abgestimmte Zu- sammenstellung von Marken bin. Diese senden für einen Ein-
- 10
- geweihten klare Signale aus: Signale über mich und meinen Freundeskreis, über das, was wir tun und woher wir kommen. Es ist kein Zufall, dass ich ein BlackBerrv benutze und Adidas- Schuhe trage. Ich habe viel Zeit investiert, um mich an diese Marken zu binden. Ich möchte, dass Sie mein Handy und meine Turnschuhe sehen und verstehen, welche Botschaft sie aussen- den. Und wenn es jemand von Ihnen nicht begreift - nun ja, das ist schon in Ordnung. Wir werden vermutlich ohnehin nie Freunde wrerden. Ich fing schon in einem sehr frühen Alter an, mich so zu ver- halten. Ich erinnere mich an meinen ersten Tag in der Grund- schule, als ich allein auf dem Schulhof stand und mir verzwei- felt wünschte, Freunde zu haben. Ich ging schnurstracks auf die Gruppe von Jungen zu, die einen vielversprechenden Eindruck machten. Sie waren eindeutig am beliebtesten - sie redeten mit Mädchen, tauschten Fußballkärtchen und aßen giftgrüne Sü- ßigkeiten. Sie taten all die Sachen, die ich gern tun wollte. Als ich mich zu der Gruppe gesellte, fragte mich einer der Jungen: »Bist du für Tottenham Hotspur?« Ein anderer: »Hast du 'ne Carrera-Bahn?« Ein dritter: »Stehst du auf Michael Jackson?« Ich antwortete auf alle Fragen mit »ja«, obwohl die ehrliche Antwort ein Nein gewesen wäre. Ich wollte alles machen, um nicht in der langen Nachmittagspause allein auf dem Schulhof zu stehen. Die Sache schien sich gut zu entwickeln, bis einer der Jun- gen einen Blick auf meine Turnschuhe warf. Ich hatte vorher nie besonders viel über diese Dinger nachgedacht. Es waren einfache blaue Sportschuhe, die meine Mutter mir zum Spie- len in unserem Garten gekauft hatte. Sofort brach ein Auf- schrei der Ablehnung los: »Wo hast du denn die her - aus dem Oxfam-Laden?« Ich blickte die anderen Jungen verwirrt an, wobei mir zum ersten Mal auffiel, dass sie im Gegensatz zu mir alle ähnliche Symbole auf ihren Turnschuhen hatten - Haken oder Streifen, wie man sie auch bei berühmten Fußballern im Fernsehen sah. Und es waren nicht nur die Schuhe: Krokodile, Adler und Tiger schmückten die Brust ihrer T-Shirts, und sie schienen alle die gleiche Schultasche zu besitzen, eine blaue
- 11
- Plastikumhängetasche, die auf der Seite einen silbernen Puma im Sprung zeigte. Niedergeschlagen und verwirrt schlich ich von dannen. Es war ein plötzliches und brutales Erwachen, das mir eine Ahnung davon gab, was man brauchte, wenn man von diesen Kids akzeptiert werden wollte. Von diesem Tag an war ich entschlossen, es den anderen gleichzutun, sie wenn möglich gar noch zu übertreffen. Ich fühlte mich, als hätten meine Eltern mich belogen. Na ja, vielleicht nicht direkt belogen, aber doch, als hätten sie mir bestimmte Dinge vorenthalten. Wie es schien, hatte jeder Junge in der Schule die Regeln erklärt bekommen - und war entspre- chend vorbereitet: Um cool zu sein, um in zu sein, um beliebt zu sein und um akzeptiert zu werden, brauchte man die rich- tige Kleidung. Meinen Eltern musste dieses wichtige Gesetz bekannt gewesen sein, warum hatten sie es mir nur verschwie- gen? In meinem kurzen Leben hatten meine Mutter und mein Vater mir den Unterschied zwischen Recht und Unrecht bei- gebracht, und ich hatte ihnen jedes Wort geglaubt. Ich hatte mich völlig darauf verlassen, dass sie mich auf die Welt da drau- ßen vorbereiteten, doch in diesem Fall hatten sie mich entsetz- lich im Stich gelassen. Sie versicherten mir oft, wie sehr sie mich liebten, doch in diesem Moment wurde mir plötzlich klar, dass sie mich nicht genug liebten, um mir solch wichtige An- gelegenheiten zu erklären. So begann eine wachsende Entfrem- dung von meinen Eltern, gleichzeitig ein herkulischer Kampf, um sie davon zu überzeugen, dass ich Namen und Logos - die richtigen Namen und Logos - auf all meinen Sachen haben musste. In den folgenden Jahren focht ich zahlreiche Auseinander- setzungen mit ihnen aus. Der blutigste dieser Kämpfe drehte sich um einen Pringle-Pullover. Pringle war eine der wichtigs- ten Marken bei den Jungen in der Schule, sodass ich einfach ei- nen haben musste. Die Farbe und das Design waren nicht so wichtig. Er musste nur diesen aufgestickten goldenen Löwen auf der Brust haben. Meine Mutter fragte mich, warum sie 50 Pfund für einen Pullover mit einem winzigen Logo ausgeben sollte, wenn es bei Marks & Spencer exakt den gleichen Pull-
- 12
- over für den halben Preis zu kaufen gab - nur eben ohne das Logo? Abgesehen davon, war denn nicht allgemein bekannt, dass Markenhersteller Produkte für Marks & Spencer entwar- fen und sowieso alles aus derselben Fabrik kam? Also bestand eigentlich gar kein Unterschied zwischen den beiden Pullo- vern - abgesehen von Pringles verbrecherischen Preisen. Diese Argumentation ignorierte gleich eine ganze Reihe von wichti- gen Punkten. Wenn wir ins Einkaufszentrum fahren, legte ich regelmäßig spektakuläre Zornesausbrüche hin und sorgte da- für, dass die Mission »Ein Schulpullover für Neil« eine weitere Woche aufgeschoben wurde. Nach zahllosen Trotzanfällen gewann ich schließlich diese Schlacht - ein Sieg unter vielen erkämpften Triumphen, die ich alle meinem Bonuskonto auf der Schulhof-Status-Bank ver- buchte. Ich weiß nicht, ob ich meinen Eltern jemals die genauen Gründe dafür darlegte, warum das Tragen von Adidas, Fila und Lacoste statt Woolworth, Marks & Spencer oder BHS für mich so fundamental wichtig war. Ehrlich gesagt, ich bin gar nicht sicher, dass ich diese selbst vollkommen verstand. Ich er- innere mich lebhaft, dass ich zu Gott betete und ihm ein Ge- schäft anbot: Ich würde brav meine Hausaufgaben machen und lieb zu meiner Schwester sein, wenn ich nur den Puma-Fuß- ball bekäme, den ich im Katalog des Argos-Versandes gesehen hatte. Die Tatsache, dass ich beim Fußballspielen eine Flasche w ar und es nur selten schaffte, in die Schulmannschaft berufen zu werden, spielte dabei keine Rolle. Es war nur wichtig, dass ich die richtigen Sportsachen hatte. Ich wuchs in einer Zeit auf, in der sich die Strukturen der englischen Gesellschaft dramatisch veränderten. Die That- cher-Regierung schuf Mitte der Achtzigerjahre - was mir na- türlich zu jener Zeit in keiner Weise bemisst war - einen neuen Wohlstand für die untere Mittelschicht, zu der auch meine Fa- milie gehörte, und meine Eltern (und damit auch ihre Kinder) kamen nach und nach in den Genuss eines größeren Hauses, eines Zweitwagens und eines jährlichen Pauschalurlaubs in Spanien. In der Schule allerdings wrar die Zugehörigkeit zur Mittelschicht kein Grund, stolz zu sein. Verglichen mit mir wa-
- 13
- ren die ärmeren Kinder besser beim Prügeln, sie durften sich Videos ausleihen, die erst ab achtzehn Jahren freigegeben wa- ren, sie gingen zu Fußballspielen, und ihre Freundinnen tru- gen am meisten Alake-up und Schmuck. Außerdem waren ihre Klamotten, ihre Fahrräder und sogar ihre Frühstücksdosen im- mer von den richtigen Marken. Diese Tatsache fand ich beson- ders verwirrend. Wenn ihre Eltern weniger Geld hatten als meine, woher hatten diese Jungen dann all die teuren Sachen? Nicht, dass meine Eltern grausam oder lieblos gewesen wären, schließlich hatte ich die größte Sammlung von Star ^ ^ - S p i e l - zeug weit und brei t. Sie konnten nur einfach meine stetig wach- sende Leidenschaft für Marken nicht verstehen. Im Alter von vierzehn Jahren war ich fest entschlossen, nach dem Gesetz der Labels zu leben, auch wenn ich mich manch- mal unwohl dabei fühlte, wie mich dieser Vorsatz handeln ließ. Wie die meisten Kinder im frühen Teenageralter schämte ich mich, wenn ich in der Öffentlichkeit zusammen mit meinen Eltern gesehen wurde. In meinem Fall wurde das jedoch irgend- wie noch viel schlimmer durch die Tatsache, dass meine El tern überhaupt kein Interesse dafür an den Tag legten, für sich selbst die richtigen Marken zu kaufen und anzuziehen. Noch schlimmer war es, dass ich anfing, andere Kinder zu verachten, wenn sie die Regeln nicht beachteten. Wichtiger als alles an- dere war für mich die Gelegenheit, mich mit meinen Freunden zu treffen. Diese Zusammenkünfte bestätigten mir, dass ich von den Gleichaltrigen, die ich bewunderte, akzeptiert wurde, und sie gaben mir die Möglichkeit, über andere, die ich nicht be- wunderte, grausam herzuziehen. Es nahte der Termin der Schuldisco heran, die zweimal im Jahr veranstaltet wurde, und ich verlangte von meinen Eltern, dass sie mir zu diesem Anlass neue Turnschuhe kauften. Ver- blüffenderweise willigte meine Mutter ein, allerdings unter der Bedingung, dass ich meine kleine Schwester mitnehmen und den ganzen Abend auf sie aufpassen würde. Ich willigte ein. Was hätte ich auch sonst tun können? Meine Schwester und ich hatten die meiste Zeit fröhlich miteinander gespielt, und wir liebten uns, ohne Frage. Doch als der Termin der Party nä-
- 14
- herrückte, veränderte sich etwas. Ich sah sie auf einmal im glei- chen Licht wie die unbeliebten Kinder in der Schule. Sie hatte weder die richtigen Turnschuhe noch die richtigen Jeans. Sie trug komische Kleider, die Mama ihr kaufte. Sie schien sich gar nicht für die richtigen Klamotten zu interessieren. Eine kalte Panik ergriff mich, als mir klar wurde, dass es mein Ruin sein würde, zusammen mit ihr in der Öffentlichkeit gesehen zu wer- den. Nie w erde ich ihren enttäuschten Blick vergessen, als ich sie in der Disco stehen ließ, um bei meinen Freunden zu sein. Den ganzen Abend hindurch konnte ich ihre Blicke spüren, als ich zusammen mit meinen Freunden die unglücklichen Kinder mit spießigen Klamotten hänselte und drangsalierte. Das Ge- fühl, jemanden im Stich zu lassen, war schrecklich. Aber ich konnte nicht erlauben, dass diese Empfindung meinen hart er- arbeiteten Status als cooler Typ zerstörte. Dieser Kampf um meine persönliche Identität wurde weni- ger anstrengend, als ich anfing, eigenes Geld zu verdienen, in- dem ich in Geschäften und Bars aushalf. Nun, da ich für mein Einkommen weitgehend selbst verantwortlich war, hatten die Debatten über meine Wahl von Bekleidungsartikeln - oder ir- gendwelchen anderen Produkten - ein Ende. Das soll nicht heißen, dass meine Eltern begeistert waren, wenn ich von einem Einkauf mit lauter teuer aussehenden Tragetüten nach Hause kam. Ich wusste, dass sie das missbilligten, doch das trug eher dazu bei, meine aufkeimende Markenbesessenheit noch weiter zu verstärken. Meine Freunde und ich verbrachten unsere gesamte Freizeit im nahe gelegenen Einkaufszentrum. Inzwischen war ich in der sozialen Rangfolge so wreit aufgestiegen, dass ich mit den an- gesagten Typen aus der Schule vor dem McDonald's herum- hing, und wir zogen unermüdlich durch die Boutiquen, um einen Blick auf neue Lieferungen von Turnschuhen oder Trainings- anzügen zu erhaschen, für die wir sparen konnten. Fotos aus dieser Zeit zeigen uns als wandelnde Werbeträger für Sport- artikelhersteller, meist wenig bekannte amerikanische Firmen, die von den gerade angesagten Rap-Stars getragen wurden. Unsere soziale Gruppe scharte sich um die Abzeichen dieser
- 15
- Marken: Man konnte dein Klan nicht angehören, wenn man nicht die gleiche Kleidung trug (unsere war Nike), und wir leg- ten Wert darauf, dass sie sich von der Kleidung anderer Grup- pen in der Stadt unterschied (meistens Reebok). Ich malte Logos auf meine Schulbücher, klaute Werbeplakate von den Bushaltestellen und sammelte alle möglichen Verpackungen und Werbeartikel, die ich in die Finger bekommen konnte. Nichts anderes war mir wichtig, außer vielleicht Mädchen. Ein klassisches Beispiel dafür, wie sich meine Beziehung zu Marken in dieser Zeit veränderte, war Technics, eine Marke, die in den gesamten frühen Neunziger jähren große symboli- sche Bedeutung hatte. Der Technics 1200 gehörte als Platten- spieler zur Standardausrüstung aller DJs, die wir zu jener Zeit bewunderten. Ein Schulbuch, das mit einem begehrten Tech- nics-Aufkleber geschmückt war, stellte eine verschlüsselte Bot- schaft an Gleichgesinnte dar; man war eben kein »Goth« oder »Spießer«, man stand auf schwarze Musik, die coolste Musik aller Zeiten. Es war für mich ein denkwürdiger Moment, als ich alle Poster von Musikern und Filmstars aus meinem Zim- mer entfernte und diese durch welche von berühmten Marken ersetzte. Der beste Platz über meinem Bett war für ein Hoch- glanzplakat des 1200 reserviert. Zwei dieser Geräte zu besitzen und Discjockey zu werden würde mein Ansehen bei allen, auf die es ankam, zweifellos in ganz neue Höhen schnellen lassen, und folgerichtig machte ich mich daran, meine Eltern an den Gedanken zu gewöhnen, mir welche zu kaufen. Der Tag, an dem zwei meiner Freunde und ich es endlich geschafft hatten, unsere Väter davon zu überzeugen, uns zwei dieser Plattenspie- ler zu finanzieren, war in der Tat ein wundervoller Tag. Nie- mand an der Schule konnte so recht glauben, dass wir sie hat- ten. Innerhalb von ein paar Wochen sorgten wir auf den Partys von viel älteren Jugendlichen für die Musik, unsere eigenen Fe- ten zogen jede Menge Leute an, und es bildete sich ein großer Freundeskreis um unsere Kerngruppc herum. Vorher hatten wir mit minderwertigen Plattenspielern und mit wenig Erfolg an unserer DJ-Karriere gebastelt, doch das gehörte nun der Vergangenheit an: Jetzt waren wir der Maßstab für Beliebtheit,
- 16
- und wir konnten entscheiden, wer auf dem Schulhof akzeptiert wurde - und das war letztlich das, was zählte. Als ich Anfang zwanzig war, hatte diese geheimnisvolle Fä- higkeit, selbst akzeptiert zu werden und anderen Akzeptanz zu gewähren, einen großen Teil meines Erwachsenenlebens be- stimmt. Es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass mein Selbst- wertgefühl davon abhing, diese Macht zu behaupten und aus- zuüben. Nur die Tatsache, dass ich von den Menschen, die ich respektierte, respektiert, bewundert und geliebt wurde, gab mir das Selbstvertrauen, ich selbst zu sein. Mit diesem schenkte ich wiederum anderen Respekt, was mich mit einem Gefühl der Wichtigkeit erfüllte. Der Puma-Fußball, den ich mir als Kind so sehr gewünscht hatte, wurde mir schließlich von den Göt- tern geschenkt, mit dem Ergebnis, dass ich in die Mannschaft gewählt wurde. Später durfte ich sogar selbst die Jungen aus- wählen, die in meiner Mannschaft spielen sollten. Im Lauf der Zeit verfeinerten sich die Methoden, mit denen ich diese Macht erlangte, und es änderte sich die Art der Men- schen, um deren Anerkennung ich mich bemühte und denen ich Akzeptanz schenkte. Aber das Ziel blieb das Gleiche. Und das zentrale Element in diesem Prozess ist die Marke. Die Lo- gos, die ich Tag für Tag mit mir herumtrage, senden sorgsam abgestimmte Botschaften aus, die den Menschen um mich he- rum zu verstehen geben, wer ich bin. Die Art, wie sie auf diese Botschaften reagieren, gibt mir im Gegenzug Hinweise darauf, wer sie sind. Den richtigen Leuten die richtigen Botschaften zu übermitteln macht mich glücklich und selbstbewusst, und ich bin davon überzeugt, dass ich umso glücklicher und umso beliebter werde, je klarer und differenzierter diese Botschaften formuliert sind. Es wäre mir unmöglich, allen Leuten, die ich 'lag für 'Tag treffe, zu erklären, wer ich bin und was ich tue. Aber es ist mir wichtig, dass Freunde, Bekannte, Kollegen und Fremde diese Message erhalten. Das ist der Grund, warum ich Marken benutze. Mit den unvermeidlichen sozialen und finanziellen Verände- rungen, die das Erwachsemverden mit sich brachte, veränder- ten sich auch die Labels, die ich favorisierte - neue Ziele erfor-
- 17
- derten auch neue Identitätssignale. Doch einer Marke blieb ich mein ganzes Leben treu: Adidas, ein deutscher Sportartikelher- steller, der seine Wurzeln traditionell vor allem in Leichtathle- tik und Fußball hat - doch daneben ist Adidas seit den frühen Siebziger jähren auch der inoffizielle Sponsor von schwarzer amerikanischer Musik (abgesehen von einer kurzen Phase in den Neunzigern, als Nike den Markt aufrollte). Adidas ist eine inter- nationale Marke, die in unterschiedlichen Regionen der Welt je- weils unterschiedliche Marktpositionen bekleidet und jeweils unterschiedliche Botschaften aussendet. Wie die meisten diffe- renzierten Marken heutzutage, passt Adidas sein Marketing und seine Produkte den jeweiligen regionalen Märkten an. Doch für mich als jungen weißen Angehörigen der englischen Mittel- schicht gab und gibt es ein paar generelle Botschaften und Sig- nale, die für mich untrennbar mit Adidas verbunden sind:
- · Ich bin aufstrebend: Ich habe die gleichen Ziele und Ideale wie die Sportler (britische Olympiamannschaft, jedoch nicht David Beckham), die Musiker (Run DMC) und Modedesig- ner (Stella McCartney), die man mit Adidas verbindet. · Ich gehöre nicht zum Mainstream: Adidas zählt zu den gro- ßen Sportartikelherstellern der Welt, ist aber nicht der größte. Als Individuum will ich dazugehören, aber nicht so sein wie alle anderen. · Ich bin Europäer: Adidas ist nicht amerikanisch. Ich bin kein Nationalist, aber ich bin stolz auf meine Herkunft, und manchmal empfinde ich antiamerikanisch. · Ich bin ethisch korrekt: Einige Konkurrenten von Adidas sind dafür berüchtigt, dass sie in Drittweltländern in Ausbeu- terbetrieben produzieren lassen, was ich ablehne. Obwrohl ich nicht nachprüfen kann, ob Adidas eine bessere oder eine schlechtere Bilanz aufweist, erweckt das Unternehmen auf mich den Eindruck, verantwortungsvoller zu handeln. · Ich bin kein Sklave der Berufskultur: Ich bin bereit, hart zu arbeiten, wenn es nötig ist, aber ich fühle mich nicht den tra- ditionellen Werten der Jobwelt verpflichtet, weshalb ich lie- ber Sportklamotten als einen Anzug trage.
- 18
- Indem ich selbst auf den nebensächlichsten Kleidungsstücken die drei Streifen von Adidas trage, hoffe ich, die Vorstellung zu vermitteln, dass ich ein aufstrebender, freigeistiger und auto- nomer Europäer bin, der einen Sinn fiir moralische Dimensio- nen und eine globale politische Perspektive hat. Wahrschein- lich habe ich noch in keiner einzigen ernsthaften Unterhaltung in meinem Bekanntenkreis diese Werte explizit geäußert oder intensiver darüber nachgedacht, nach diesen angeblichen Stan- dards zu handeln. Doch das sind die Prinzipien, mit denen ich von Bekannten und Fremden in Verbindung gebracht werden möchte, und ich bringe sie optisch zum Ausdruck, indem ich diese eine Marke trage. Ein Fremder, der dem gleichen Marke- ting und der gleichen Brandpositionierung ausgesetzt war, würde, wenn er mir auf der Straße begegnet, hoffentlich einen Blick auf meine Adidas-Turnschuhe werfen, sich an die Werte der Marke erinnern und sie mit mir in Verbindung bringen. Für jemanden, der sich nicht besonders fiir Labels interes- siert, mag sich das alles ziemlich weit hergeholt anhören. Doch ich glaube, dass wir alle - bewusst oder unbewusst - den ein- fachsten Dingen, die wir kaufen, Bedeutung beimessen. Wie gut meine Ideale bei einer solchen sozialen Interaktion über- mittelt wrerden, hängt unter anderem vom Alter des vorbeilau- fenden Fremden ab (eine Person, die etwa das gleiche Alter hat wie ich, wird die Botschaft viel besser verstehen). Doch jede Reaktion des Unbekannten, ob positiv, negativ oder gleichgül- tig, gibt mir wiederum einen Hinweis darauf, wer er ist. An die- ser Stelle muss ich darauf hinweisen, dass die Mitarbeiter von Adidas möglicherweise keinen einzigen der Werte unterstüt- zen würden, die ich hier aufgezählt habe. Doch da ich die ge- samten dreißig Jahre meines Lebens dieser Marke ausgesetzt war, habe ich meine eigene, egoistische Vorstellung der von ihr transportierten Vorstellungen entwickelt - und diese sind fiir mich zu einem Sinnbild für mein Selbstverständnis geworden. Das meinen Freunden gegenüber offen zuzugeben wäre ein beschämendes Eingeständnis von Oberflächlichkeit. Doch je- der von uns weiß, dass wir das Gleiche denken. Am Ende meiner Schulzeit hatte ich nur vage Vorstellungen,
- 19
- welche berufliche Laufbahn ich einschlagen wollte. Wie die Mehrheit der jungen Menschen damals und heute wünschte ich mir einen Job in den Medien, und ich machte einige Prak- tika bei Fernsehproduktionsgesellschaften. Die Arbeit hinter den Kulissen war hart und schlecht bezahlt - aber dafür würde man ja mit berühmten Menschen zusammenkommen. Ich traf tatsächlich einige Stars - Roger Moore, Naomi Campbell, Joan Collins -, allerdings wage ich zu bezweifeln, dass die sich bei einer Nachfrage an mich erinnern würden. Bei dem ganzen Kult, der um die Prominenten veranstaltet wird, überraschte mich dann doch, wie wenig Auswirkungen es hat, jemandem wie Robbie Williams zu begegnen, nachdem der erste »Wow«- Effekt verflogen ist. Als mir klar wurde, dass diese »Lohnnebenleistungen« für mich nicht interessant waren, kehrte ich an die guten alten Plat- tenteller zurück (ich hatte immer noch die beiden Technics, die mein Vater mir gekauft hatte) und fing an, in London regelmä- ßig Partys zu organisieren, wodurch ich mich nach und nach als Veranstalter etablierte. In den späten Neunzigerjahren stand Londons Clubkultur in voller Blüte. Das Phänomen war noch relativ neu, und es zog junge und schöne Menschen an - und außerdem karriereorientierte Discjockeys und opportunis- tische Marketingleute. Letztere waren scharf darauf, ihre Mar- ken mit dem berauschenden Hedonismus praktisch in Verbin- dung zu bringen, den sie gedanklich kreiert hatten. Als Club-Veranstalter bot ich ihnen »Plattformen« für ihre Mar- ken, Sponsoren-Deals, mit deren Hilfe sie mit den jungen Leu- ten in Kontakt treten konnten, wobei die Events oft genug mehr auf die Bedürfnisse der Marken zugeschnitten waren als auf die der zahlenden Besucher. Bei Bereitstellung eines ent- sprechenden Etats sorgte ich dafür, dass die Mädchen auf den Werbeflyern die richtigen Bierflaschen in die Hand hielten, ich gab etablierten Events neue Namen, die den Werbeslogan ei- nes Unternehmens mit einbezogen, und ich brachte jeden Raucher dazu, nur noch eine ganz bestimmte Zigarettenmarke zwischen den Fingern zu halten. Ich betrachtete mich als einen Experten in der Kunst, auf subtile Weise die Namen von Wer-
- 20
- bepartnern in Clubbroschüren unterzubringen - und auf eine eigenartige Weise gab die Tatsache, dass eine große Marke in- volviert war, einer Veranstaltung eine höhere Wertigkeit. Die Events waren von größerer kultureller Relevanz, wenn die Marketingabteilung eines bekannten Unternehmens ihren Se- gen dazu gegeben hatte. Manchmal jammerte ich in Gesprä- chen mit anderen Veranstaltern darüber, dass diese Firmen un- sere neu entstandene Jugendkultur ausbeuteten. Doch in Wahrheit fühlte ich mich von der Macht und dem Einfluss die- ser Marken unwiderstehlich angezogen. Meetings mit Sponso- ren wie Diesel Jeans oder Coca-Cola waren weitaus aufregen- der als meine Begegnungen mit kleineren Stars. Welch eine Chance, eine Marke wirklich zu verstehen, die Macher hinter den Kulissen zu treffen und herauszufinden, welche Pläne sie für die Zukunft hatten. Man kann sich vorstellen, dass der Tag, an dem ich fiir ein Meeting zu Adidas eingeladen wurde, ein Jubeltag für mich war. Inzwischen hatte ich angefangen, Jugendmagazine heraus- zugeben (ein Business, das dem eines Veranstalters nicht un- ähnlich ist - in beiden Fällen ist es das Talent anderer Men- schen, das man managt und an dem man verdient). Ich schrieb endlos über die Trends in der Konsumkultur der Jugend, ar- beitete eng mit Marken firmen zusammen, deren Product Re- leases ich als wichtige Nachrichten betrachtete. Diese Unter- nehmen freuten sich, wenn meine Markenverehrung sich in langen Beiträgen niederschlug, die sich mit der Geschichte und Kultur ihrer Produkte befassten, so wie sich andere Journalis- ten über Schauspieler oder Popstars ausließen. Ich traf mich re- gelmäßig mit Brandmanagern, um zu besprechen, wie ihre Fir- men diese »Nachrichten« verfasst haben wollten. Und so kam schließlich der Tig, an dem ich die Leute von Adidas traf. Im Alter von sechsundzwanzig Jahren erklomm ich die Stu- fen zu ihrem Büro, von Kopf bis Fuß in dreifach gestreifte Kla- mottenteile gekleidet. Meine Hände waren feucht, mein Puls raste - als ob man mich zum Tee ins Königshaus gebeten hätte. Das Büro war eine wahre Schatzhöhle, voller Waren, Werbe- plakate mit Autogrammen von Stars, Glasvitrinen mit »Limi-
- 21
- ted Edition«-Turnschuhen, und überall standen Kleiderstan- gen mit Mustern von Sportsachen herum, die noch nicht im Handel waren. Und an einer Wand saßen, un ter einem riesigen Logo, die Markenmanager von Adidas UK. Auch sie waren prachtvoll gewandet in der Uniform ihres Unternehmens - ich hätte Berge versetzen mögen, um einige Stücke davon für mich selbst zu bekommen. Gleich zu Beginn des Meetings wurde klar, dass der Enthu- siasmus dieser Männer meinen eigenen noch bei weitem über- traf. Zuerst fand ich die Leidenschaft, mit der sie über die Kul- tur von Adidas sprachen, sehr beeindruckend, doch bald fing sie an, mich regelrecht zu beunruhigen. Die einzigen Kultur- bereiche für die sich diese Leute interessierten, waren offenbar jene, die ihr Unternehmen sponserte oder »besaß«. Konkurrenz- firmen, Menschen, die deren Produkte trugen, und die Kultur, die damit einherging, durften in diesem Raum nicht erwähnt werden. Hier zeigte sich die unangenehme Seite einer Marken- besessenheit - exzessiver Tribalisinus. Zum ersten Mal in mei- nem Leben dachte ich, du liebe Zeit, es sind doch nur ein Paar Turnschuhe. Trotz meiner eigenen Obsession für einige Kon- zerne und ihre Marken konnte ich solche Company Mm nie ganz verstehen, Leute, die sich ihrer Tätigkeit so ganz und gar verschreiben, als ob es ihre eigene Firma wäre. Elvis Presley hat einmal gesagt, dass er es nicht mochte, auf Tournee zu ge- hen und seine Fans zu treffen, aus Angst, ihren Erwartungen nicht gerecht zu werden. Im Lauf der Jahre hatte ich die Leute von Adidas in meiner Vorstellung zu Halbgöttern aufgebaut, und ehrlich gesagt, hätte nichts außer wahren Fabelwesen meine Erwartungen an diese Menschen erfüllen können. Doch diese missliche Erfahrung war für mich der Punkt, an dem eine all- mähliche Kehrtwende einsetzte und ich das Maß an Aufmerk- samkeit zu hinterfragen begann, die ich diesen Marken wid- mete. In der ersten Zeit meiner Arbeit als Zeitschriftenherausge- ber erfüllte es mich regelmäßig mit Selbstachtung, dass diese Unternehmen daran interessiert waren, mit mir zu sprechen, mir ihre noch nicht auf dem Markt befindlichen Produkte zu
- 22
- zeigen, mir zu erläutern, welche Trends sie erwarteten - und vor allem, dass sie mir kostenlos Dinge zuschickten. Später gab es dann auch Spannungen in diesen Beziehungen, wenn ich meinen Klienten nicht genug Aufmerksamkeit widmen konnte und sie begannen, sich wie Kinder aufzuführen, die sich ver- nachlässigt fühlen. Manchmal bedurfte es der Geschicklichkeit einer zwanzigfachen Mutter, um jeder der konkurrierenden Marken die gleiche Liebe und Zuwendung zukommen zu las- sen, so als ob es keine andere für mich gäbe. Bei einem Meeting mit Nike Reebok zu tragen, wäre ein schwerer Fauxpas gewe- sen. Einen Wettbewerber auch nur im Gespräch zu erwähnen, konnte schon die Fetzen fliegen lassen. Dabei stand die ganze Zeit die Tatsache im Raum, dass sie als Anzeigenkunden indi- rekt mein Gehalt bezahlten und deshalb verlangten, dass man ihnen den Respekt entgegenbrachte, der ihnen ihrer Meinung nach zustand. All diese Ereignisse haben mich zu dem gemacht, der ich nun bin: ein Mensch, der durch und durch von Marken geprägt ist. Fast jedes einzelne Produkt, das ich kaufe, stellt eine sorgsam erwogene Lifestyle-Entscheidung dar, und mit einer Mischung aus Stolz und Beschämung gebe ich zu, dass ich in Büchern und Zeitschriften erwähnt werde, die sich mit solchen Überlegun- gen beschäftigen. Von dem Tee, den ich zum Frühstück trinke, bis zu den Bettlaken, auf die ich mich abends zur Ruhe lege, be- finde ich mich auf einer nie endenden Mission, bestehend aus unzähligen Konsumoptionen, die immer wieder aufs Neue meine Identität bestätigen sollen. Wichtig dabei ist, dass das Ganze subtil und mit einer gewissen Raffinesse geschieht - man darf es nicht zu angestrengt versuchen, denn das wäre nicht cool. Coolness ist per Definition unangestrengt - man versucht nicht cool zu sein, man ist cool, ohne darüber nachzudenken. all diese Sinnbilder meines Wesens müssen sich scheinbar auf vollkommen natürliche Weise gewissermaßen von selbst um mich herum gruppieren. Ich muss gleichsam wie ein Magnet die Symbole anziehen, die ein positives Licht auf meinen Cha- rakter werfen, und dabei diejenigen abstoßen, die ich für nega-
- 23
- tiv halte. Schon das Vermeiden bestimmter Labels ist eine Kunst für sich. Das Vermeiden einer Markenwahl - also ohne eine bestimmte Marke gesehen zu werden - kann ein noch stärkeres Statement sein als die Entscheidung für eine Marke, besonders zu Zeiten einer Konsumentenepidemie. So habe ich zum Beispiel bewusst der Versuchung widerstanden, mich dem weltumspannenden Klan der iPod-Besitzer anzuschließen. iPods werden von einer Marke produziert, die ich sehr schätze. Sie haben ein wunderbares Design, und sie sind wirklich sehr praktisch. Kurz gesagt, sie sind genau die Art von Produkt, die ich gern in meiner Tasche hätte. Doch sind sie mittlerweile derart allgegenwärtig, dass ich, wenn ich auf der Straße mit den weißen Steckern im Ohr herumliefe oder wenn ich ein solches Ding in einer Bar demonstrativ neben mein Glas legte, damit meine Zugehörigkeit zu einem Stamm bekundete, der so rie- sig, so gewöhnlich und so leicht zu identifizieren ist, dass meine Individualität dadurch in Gefahr geriete. Die Trends des Main- streams zu vermeiden, egal wie unwiderstehlich sie auch wir- ken mögen, ist ein wichtiger Aspekt dieses schmerzhaften, aber lohnenden Prozesses. Es ist besser, einen weniger verbreiteten und möglicherweise schlechteren massenproduzierten MP3- Player in der Tasche zu haben, als der Herde hinterherzuren- nen. Wenn ich in Gedanken die Minuten eines beliebigen Tages durchgehe, dann stelle ich erschreckt fest, wie viele meiner Handlungen und Entscheidungen von Markenwerten diktiert werden. Noch erschreckender ist die Tatsache, dass ich einen großen Teil meines Lebens damit zubringe, darüber nachzu- denken, was diese Optionen als Lifestyle-Entscheidungen be- deuten. Ein ganz normaler Morgen in Boorman-Land läuft ungefähr folgendermaßen ab:
- 7.00 Uhr Der Wecker in meinem BlackBerry weckt mich - das das ist ein Gerat, mit dem man unterwegs E-Mails empfangen und verschicken kann. (Erfolgshungrige Managertypen benutzen so etwas, und ich möchte gern wie ein solcher wirken.)
- 24
- 7.10 Uhr Ich ziehe meinen Adidas-Y3-Trainingsanzug an. (Y3 ist eine Luxusmarke von Adidas, und mir gefällt es, sie herabzusetzen, indem ich damit zu Hause he- rumhänge.) 7.15 Uhr Ich schalte den Kenwood-Wasserkocher an. (Heute haben die modernen Küchen meistens einen Dua- lit-Kocher, aber die sind mittlerweile so häufig, dass ich mich in einem Akt der Rebellion für eine weni- ger angesagte Marke entschieden habe.) 7.20 Uhr Ich gieße kochendes Wasser in eine Bodum-Tee- kanne. (Eine nette unaufdringliche deutsche Marke - oder sind das Schweden?) 7.21 Uhr Ich brühe grünen Tee von Yamamotomata auf. (Keine Ahnung, ob das die beste Marke ist, die es auf dem Markt gibt. Aber sie ist in London schwer zu bekommen, also besteht keine Gefahr, mit ei- nem Klischee im Teeregal erwischt zu werden.) 7.2 5 Uhr Ich schalte mein Roberts-Radio an. (Die klassische britische Marke - gehört zu den wrenigen Dingen, die mich stolz machen, Engländer zu sein, wenn mein Auge darauffallt.) 7.26 Uhr Ich höre die Nachrichtensendung Today auf BBC Radio 4. (Ich vertraue der BBC, und es macht Ein- druck, wenn ich später am Tag aus diesen Nach- richten zitieren kann.) 7.40 Uhr Ich schalte meinen Mac ein. (Das iBook G4 Basis- modell - alles andere wäre ein Overstatement.) 7.45 LThr Ich fahre Word hoch. (Dem zufolge, was die Zei- tungen schreiben, sollte man Microsoft eigentlich nicht mögen, obwohl ich mich nicht erinnern kann, warum eigentlich. Aber da es alle benutzen, muss ich das auch tun.) 8.00 Uhr Schalte den AEG-Herd an. (Mit dieser Marke habe ich nichts am Hut. Er war schon in der Wohnung, als ich sie kaufte. Muss gelegentlich einen anderen besorgen.) 8.05 Uhr Ich öffne den Liebherr-Kühlschrank. (Es ist wich-
- 25
- tig, keinen Srneg zu haben - das ist die Marke der- jenigen, die zu offensichtlich darauf aus sind, eine perfekte Küche zu haben.) 8.10 Uhr Ich mache mir Porridge mit Quaker Oats. (Der alte Bursche im Logo sieht sehr vertrauenswürdig aus, und ich glaube, es kommt aus biologischem An- bau.) 8.15 Uhr Eine Vitamintablette von Solgar. (Ich weiß nicht, ob die wirklich helfen. Aber ich fühle mich hesser, wenn ich sie nehme, weil Solgar-Vitamintabletten so viel mehr kosten als die anderen Marken.) 8.16 Uhr Ich esse mit Teller und Besteck von IKEA an einem IKEA-Tisch. (IKEA macht mich nicht glücklich, aber ich habe noch nicht die nötige Zeit und das nötige Geld investiert, um mir eine bessere Marke zuzulegen.) 8.25 Uhr Ich dusche mit Seife von Simple. (Deren Slogan ist: »Nicht gefärbt, nicht parfümiert, einfach freund- lich.« Es gibt mir ein Gefühl von Reinheit.) 8.25 Uhr Ich dusche mit Aveda-Shampoo. (Bei einem Mann ist ein so teurer Körperpflegeartikel eigentlich zu dick aufgetragen, aber ich benutze gern die Be- stände meiner Freundin.) 8.30 Uhr Ich trockne mich mit einem Handtuch von John Lewis ab. (Auch wenn dieses Unternehmen offen- sichtlich von einem Mann gegründet wurde, hat diese Marke die Ausstrahlung einer vertrauenswür- digen alten Tante, an die man sich kuscheln kann. Außerdem ist ihr Slogan: »Never knowingly under- sold« (»Wir halten jeden Preis«). Auf einen solchen wäre ich jedenfalls stolz, wenn ich ein Geschäft hätte.) 8.32 Uhr Zum Zähneputzen benutze ich Zahnbürste und -pasta von Colgate. (In der Werbung heißt es im- mer, dass die Zahnärzte diese Dinge auch selbst be- nutzen, also muss es eine gute Wahl sein.) 8.35 Uhr Ich trage eine Menge Deo von Simple auf. (Anders
- 26
- als Leute, die Lynx verwenden, will ich lieber nicht zu deutlich über mein Deodorant definiert werden, deshalb eine etwas weniger aufdringliche Wahl.) 8.40 Uhr Ich ziehe Calvin-Klein-Unterwäsche an. (Eigent- lich mag ich Calvin Klein als Marke nicht beson- ders. Hinz und Kunz greifen dazu. Aber ich würde mir etwas vergeben, wenn ich eine No-Name-Marke trüge; auch habe ich noch keine bessere Alternative gefunden.) 8.42 Uhr Ich ziehe Socken von Ralph Lauren an. (Lächerli- cheres als Markensocken gibt es wohl nicht, doch diese übertriebene Aufmerksamkeit für jedes Detail ruft in mir ein gutes Gefühl hervor. Wenn ich heute von einem Auto angefahren und ins Krankenhaus eingeliefert würde, dann wären die Schwestern von meinen Socken beeindruckt.) 8.45 Uhr Ich ziehe Levi's Jeans an. (Jeansmarken kommen und gehen, das Label Levi's bietet modische Be- ständigkeit. Wenn ich mit einem Kleidungsstück ein besonderes Statement abgeben will, dann tue ich das mit etwas weniger Gewöhnlichem als mit einer Jeans.) 8.46 Uhr Ich ziehe ein Poloshirt von Ralph Lauren an. (Meine Beigeisterung für diese Marke ist so groß, dass ich schon daran gedacht habe, eine Fan-Webseite un- ter dem Namen ralphie.com. einzurichten. Ich bin sicher, sie wäre ein Hit bei Börsen-Parketthändlern und ironischen Modestudenten.) 8.47 Uhr: Ich ziehe Adidas-Turnschuhe an. (Wenn es ein Klei- dungsstück gibt, mit dem ich einen Menschen de- finieren würde, dann sind das ohne Frage seine Schuhe. Daher die aus den USA importierten: Li- mited Edition 80'$ Reissues.) 8.48 Uhr Ich ziehe meine Helmut-Lang-Jacke an. (Es gibt hier kein Markenetikett, das man von außen sehen könnte, aber ich weiß, wer der Hersteller ist - und das erfüllt mich mit stiller Zufriedenheit.)
- 27
- 8.55 Uhr Ich stecke mein Moleski ne~Noti ¿buch in meinen North-Facc-Rucksack. (Pablo Picasso und Bruce Chatwin haben offenbar diese Notizbücher benutzt, sie können also nur gut sein. North Face sieht für meinen Geschmack eigentlich ein bisschen zu sehr nach Trekking aus, aber die Firma macht stabile Rucksäcke, und in diesem Fall hat ausnahmsweise einmal der praktische Wert den Ausschlag gege- ben.) 9.00 Uhr Ich besteige mein Trek-Fahrrad, um zur Arbeit zu kommen. (Ich weiß kaum etwas über diese Marke, aber die Fahrradkuriere, denen ich unterwegs be- gegne, scheinen meine Wahl gutzuheißen.) 9.20 Uhr Ich halte an einem Kiosk und kaufe den Guardian und Evian-Wasser. (Ich hasse den Guardian und alle Leute, die ihn lesen; ich würde eine andere Zeitung wählen, wenn es eine bessere gäbe. Bei Evian-Was- ser fühle ich mich schon gesünder, wenn ich es nur sehe.) 9.21 Uhr Ich starre auf di e Marlboro Lights hinter dem Ver- kaufstresen. (Die weiß-goldene Packung erinnert mich an die Zeit, als ich ein sorgenfreier Raucher war.) 9.22 Uhr Ich ziehe den Louis-Vuitton-Geldclip aus der Ta- sche. (Ein hübscher Luxusgegenstand, gibt mir das Gefühl, reich zu sein, auch wenn ich es nicht bin.) 9.2 3 Uhr Ich bezahle mit meiner Visa Card von der Co-Ope- rative Bank. (Mit der Karte dieses ethisch korrek- ten Geldinstituts zeige ich allen Verkäufern, dass ich ein verantwortungsbewusster Konsument bin, auch wenn meine einzige ethisch verantwortungs- bewusste Tat darin bestand, Kunde dieser Bank zu werden.) 9.26 Uhr Ich öffne die Bürotiir mit meinem Schlüsselring von Vivienne Westwood. (Ich bin nicht alt genug, um Punker gewesen zu sein, aber ich denke gern, dass ich in einem anderen Leben einer geworden wäre.)
- 28
- 9.2 8 Uhr Ich setze mich an meinen IKEA-Schreibtisch. (Schon wieder diese Finna, ich muss dringend daran den- ken, gelegentlich eine IKEA-Säuberung in meinem Leben vorzunehmen.)
- Und so weiter, und so weiter ... Und dabei ist das gerade erst mein zweieinhalbstündiges häusliches Morgenritual bis zum Job; eine Gesamttagesliste von markenabhängigen Gedanken und Verhaltensweisen aufzuzählen, das wräre zu ermüdend. Und dabei habe ich nur die Labelentscheidungen aufgeführt, die ich bewusst treffe. Die Marken, mit denen ich im Radio, im Internet, in der Zeitung, auf der Straße oder am Kiosk in Be- rührung komme, sind noch gar nicht berücksichtigt. Ich bin si- cher, wenn es sein müsste, könnte ich auch zu diesen eine Mei- nung, eine Präferenz oder eine Emotion äußern. Ich bin nicht kaufsüchtig, ich bin kein extremer Narzisst. Aber ich stecke in einem Beziehungsgeflecht, das völlig real ist und sich ständig weiterentwickelt-und ohne das ich vollkom- men verloren wäre. Ich stürze mich in eine leidenschaftliche - und ausgesprochen öffentliche - Affare mit einer Marke, bis ich ihrer überdrüssig werde oder bis ich sie bei jemandem ent- decke, mit dem ich nicht in Verbindung gebracht werden will. Dann sage ich mich von ihr los und tue so, als hätten wir uns niemals getroffen. Ich habe sogar schon frühere Freundinnen dadurch gestraft, dass ich umgehend mit ihren Intimfeindin- nen ins Bett ging. Als Kind fühlte ich mich gezwungen, diese Markenbeziehungen zu unterhalten, damit ich akzeptiert wurde. Als Teenager setzte ich sie ein, um mir eine eigene Identität zu schaffen. Auf dem Weg ins Erwachsenendasein waren Labels Werkzeuge, mit denen ich mein Ich bekräftigte und meine Zu- kunftspläne formulierte. Inzwischen brauche ich diese Marken, um jeden Aspekt meines Selbstwertgefühls zu stärken. Dieses Wertesystem trifft natürlich nicht nur auf mich zu, sondern kann auch bei allen anderen Menschen angewendet wrerden. Ich bin stolz auf meine Fähigkeit, auf dieser Basis in Sekundenschnelle ein Charakterprofil erstellen zu können. Auf den ersten Blick kann ich ein differenziertes Urteil über völlig
- 29
- fremde Leute fällen, solange sie nur irgendwelche sichtbaren Marken bei sich tragen. Eine Frau sitzt mir im Bus gegenüber und trinkt etwas aus dem Pappbecher einer bestimmten Kaf- feehauskette. Sie liest eine bestimmte Zeitung, ein bestimmtes Handy klingelt in einer bestimmten Handtasche. Das führt zu bestimmten Annahmen, zu einer bestimmten Meinungsbil- dung und bisweilen auch zu bestimmten Handlungen. Men- schen, die keinerlei Labels zur Schau tragen, sind verwirrend für mich, und es bedarf einer kurzen Unterhaltung (»Eine hüb- sche Tasche haben Sie da. Wo ist die denn her?«), wenn ihre Identität entschlüsselt werden soll. Doch man trifft nur sehr selten jemanden ohne jeglichen Markenartikel. In der heutigen Welt ist das praktisch unmöglich. Doch auch eine Person völ- lig ohne Etiketten würde mir eine bestimmte Botschaft über- mitteln (Nonkonformist, Hippie, Alien aus dem Weltall), selbst wenn er keine Sprache hat, mir dies mitzuteilen. Eigentlich würde ich wirklich gern einmal einen solchen Menschen ken- nenlernen. Vielleicht denken Sie jetzt, dass jemand mit so rigorosen Vor- stellungen verächtlich auf andere hinabblickt, die diesen Er- wartungen nicht entsprechen, oder dass in meinem Freundes- kreis alle die gleichen Insignien ihrer Mitgliedschaft in einem exklusiven Zirkel zur Schau tragen. Damit wären Sie allerdings im Irrtum. Widersinnigerweise lösen gerade Leute, die die gleichen (oder unangenehm ähnliche) Zeichen wie ich herum- tragen, bei mir eine reflexartige Mischung aus Abneigung und Anspannung aus. Ich nenne diese Menschen LWWs - Leute wie wir -, und sie sind, zu meinem beständigen Missvergnü- gen, wirklich überall. Sie tragen meine Jeans, sie fahren mein Fahrrad, sie lesen meine Zeitung. Ich habe das Gefühl, dass sie darauf aus sind, mir meine hart erarbeitete Identität unter der Nase wegzustehlen. Schlimmer noch, wenn sie auf der Straße an mir vorübergehen, lächeln sie mich an, als ob ihnen dieser himmelschreiende Diebstahl völlig bewusst sei. Warum in al- ler Welt sollte ein Mensch einem anderen zuwinken, nur weil sie im gleichen Auto aneinander vorbeifahren? Wer kann so oberflächlich sein und detaillierte Annahmen über den Cha-
- 30
- rakter eines völlig Fremden machen, nur weil er bestimmte Marken benutzt? Ach so, ich. Schließlich ist mir klar geworden, dass dieses Wertesystem, mit dem ich mich selbst und meine Mitmenschen einordne, komplett hohl ist. Mein ganzes Leben lang habe ich mich selbst über eine Reihe von künstlichen Beziehungen zu Mar- ken definiert. Das hat mir die Akzeptanz meiner Altersgenos- sen gesichert, und es hat mir in meinem Berufsleben Chan- cen eröffnet - doch es wird mir immer deutlicher klar, dass es mir keinerlei Zufriedenheit gebracht hat. Eigentlich müsste ich glücklich sein. Ich habe ein angenehmes Zusammensein mit meiner Partnerin, die ich sehr liebe. Meine Eltern leben beide noch, sie sind nach wie vor glücklich verheiratet, und sie geben meinem Dasein ein stabiles Fundament. Ich habe einen großen Freundeskreis, einen interessanten Beruf, und - das versteht sich wohl von selbst - ich besitze eine ganze Menge hübscher Markenprodukte. Ich sollte wirklich ver- gnügt sein. Stattdessen fühle ich mich leer, betrogen und des- illusioniert. Im Alter von dreißig Jahren beschleicht mich der Verdacht, dass meine Liebschaften zu verschiedenen Marken, in die ich so viel Energie investiere, völliger Schwindel sind. Es ist, als ob ich aus einem langen Traum erwrachte. Ich bin wie ein Schlaf- wandler durchs Leben gegangen, war mir meiner Lage besten- falls halb bewusst, und nur gelegentlich wachte ich lange ge- nug auf, um zu fragen, warum ich eigentlich nicht so glücklich war, wie ich es erwarten durfte, nachdem ich so viel in meine Markenflirts investiert hatte. Mit jedem wohlerwogenen Kauf habe ich versucht, mehr ich selbst zu wrerden - in der Annahme, das würde Erfüllung in mein Leben bringen. Mich beschleicht aber ein Gefühl dumpfer Unzufriedenheit, und langsam fange ich an, die Realität zu erkennen: Mit jedem neuen Ich-Em- blem, das ich meiner Sammlung hinzufüge, verliere ich ein Stück von mir selbst an die Marken. Sie können meine Love- story nicht erwidern. Sie können mich nicht zu jenen Orten transportieren, deren Existenz sie mir verheißen. Ich bin nicht so wie die Menschen in den Werbespots - und ich werde es
- 31
- auch nie werden. Es ist eine Lüge, eine Lüge, die ich viel zu lange geglaubt habe. Wenn Sie diese Beichte lesen, müssen Sie mich für einen der oberflächlichsten und vorurteilsbeladensten Menschen der Welt halten. Aber ich schwöre Ihnen, ich bin wirklich ein an- ständiger Kerl. Ich würde mich niemals weigern, Ihnen die Tür aufzuhalten, weil Sie das »falsche« Handy haben, und ich würde meine Freundschaft zu Ihnen nicht davon abhängig machen, ob Sie die richtige oder die falsche Zeitung lesen. Ich würde vielleicht ein bisschen weniger von Ihnen halten, aber ich würde es Ihnen höchstwahrscheinlich niemals sagen. Bitte, glauben Sie mir, ich habe keine Ahnung, wie es geschehen konnte, dass ich so oberflächlich wurde. Ich wollte nichts weiter als lieben und geliebt werden - und diese verdammten Labels schienen der beste Weg dahin zu sein. Erst jetzt, nachdem ich dreißig Jahre lang versucht habe, mein Ich bei irgendwelchen Marken zusammenzukaufen, wird mir klar: Ich habe buchstäblich keine Ahnung, wer ich eigentlich bin.
- 10. März 2006
- Die Offenbarung kam mir, als ich eines Morgens zu Hause auf der Toilette saß. Meine Freundin Juliet hatte ein eselsohriges Exemplar von John Bergers Wuys of Swing auf dem Spülkasten liegen lassen. Ich hatte es nicht besonders eilig, zur Arbeit zu kommen, und ich fing an, darin herumzublättern.
- Es stimmt, dass bei der Werbung eine Marke oder ein Un- ternehmen mit anderen konkurriert; aber es ist ebenso rich- tig, dass jedes Bild in der Werbung alle anderen bestätigt und verstärkt. Werbung ist nicht nur eine Ansammlung konkur- rierender Botschaften: Sie ist eine Sprache für sich, die stän- dig genutzt wird, um dieselbe grundlegende Botschaft zu übermitteln ... Sie fordert uns alle auf, unser Leben zu ver-
- bessern, indem wir etwas mehr kaufen. Wir hören, dass das, was wir mehr erstehen sollen, uns irgendwie reicher machen wird - auch wenn wir selbst durch den Kauf ärmer werden, indem wir unser Geld ausgeben ... Ziel der Werbung ist es, den Betrachter ein klein wenig unzufrieden mit seinem ge- genwärtigen Leben zu machen. Nicht mit dem Leben der Gesellschaft insgesamt, sondern mit seinem eigenen. Sie un- terstellt, dass der Betrachter ein besseres Dasein haben wird, wenn er erwirbt, wras sie anbietet. Sie zeigt ihm eine verbes- serte Alternative zu dem, was er ist... Jede Werbung arbei- tet mit Ängsten. Die Summe von allem ist Geld, und Geld zu bekommen heißt, die Ängste zu überwinden. Andershe- rum betrachtet: Die Werbung spielt mit der Angst, dass man nichts ist, wrenn man nichts hat.1
- Das war meine Entdeckung, mit Pauken und Trompeten. Zum ersten Mal wurde mir bewusst, wras meine Emotionen sind, wenn ich eine Marken Werbung sehe. Eine wunderschöne de- kadente Frau blickt mich von einer Plakatwand aus an. Der Glanz, den dieses Bild verströmt, ist erregend. Es folgt ein er- schütterndes Gefühl der Minderwertigkeit: Ich bin nicht so an- ziehend wie sie - und deshalb auch weniger zufrieden mit mei- nem Leben. Ich kann niemals ein Teil ihrer Welt sein, wenn ich nicht etwas verändere. Diese Seelenqual verwandelt sich in eine große Entschlossenheit: Ich werde alles tun, was nötig ist, damit ich so glücklich werde wie sie, und ich werde die glei- chen Dinge kaufen, die sie hat. Und wenn ich mir ihren Le- bensstil nicht leisten kann, dann werde ich härter arbeiten, da- mit ich es eines Tages kann. Auf eine verrückte Weise gibt diese Angst mir gleichzeitig auch Hoffnung - sie bringt mich auf den Weg, durch den ich mich verbessern werde. Doch das Ziel, das ich erreichen muss, entfernt sich immer wreiter von mir. Ich muss ständig Schritt halten. Im Lauf des Tages sehe ich so viele Werbebotschaften und ich durchlebe diese Abfolge von Empfindungen so oft, dass diese Mischung aus Furcht und Anspannung zur Normalität geworden ist, etwas, das ich bis zum heutigen Tag nie in Frage
- 33
- gestellt habe. Die Angst ist gleichzeitig eine Versuchung, denn sie lockt mit der Vision eines liebenswerteren Ich - liebenswer- ter für andere, vor allem aber für mich selbst. Plötzlich wurde mir klar, dass ich versuche, ausgerechnet die Quelle meiner Angst zum Kurieren derselben einzusetzen. Markenkaufen als Freizeitbeschäftigung. Wenn ich in meinem Beruf Labels ver- herrliche und Werbung für sie machen, dann streichele ich die Hand, die mich umbringt. Menschen, die Verhaltensweisen pflegen, bei denen sie wissen, dass diese sie langfristig umbrin- gen, nennt man Süchtige. Ich bin, trotz vorheriger gegenteili- ger Behauptung, ein Markensüchtiger. »Was machst du denn da drin?«, fragte Juliet und klopfte an die Tür. »Ah, ich lese bloß ... bin gleich fertig.« »Beeil dich ein bisschen, da ist jemand von Levi's am Tele- fon, der mit dir sprechen will.« Es ist eine beunruhigende Erfahrung, eine Offenbarung zu erleben, die dem eigenen Wertesystem widerspricht. Ich war davon überzeugt, dass es mich zu einem ausgeglichenen Men- schen machen würde, Dinge mit auffälligen Labels zu kaufen und zu benutzen, es war eine meiner wichtigsten Motivationen, ein Grund, morgens aufzustehen und zum Job zu gehen, so hart zu arbeiten wie ich nur konnte, um so viel Geld wie mög- lich zu verdienen, damit ich mir die Dinge leisten konnte, die ich haben wollte. Es kam, was kommen musste: die Desillusio- nierung. In den darauffolgenden Tagen schaute ich auf meine Umgebung, auf das Konsumparadies, das Londons Innenstadt nun einmal ist, und ich sah nur eines: konsumieren, um glück- lich zu werden. Jetzt wurde mir klar, dass ich - ebenso wie die zehntausend anderen Shopper auf der Oxford Street - belogen worden war. Aber von wem? Vielleicht waren wir auch alle Komplizen ei- ner großen Verdrängung. Oder wussten wir, dass diese Art von Konsum selbstzerstörerisch ist, waren aber zu bequem, um un- ser Verhalten zu ändern? Diese langsam erwachende Erkennt- nis war verwirrend und beängstigend zugleich. Während dieser ganzen Zeit blieb das Ausmaß meiner Ein-
- 34
- kaufe unverändert. Ich ging zu Selfridges, um mir die neueste Schuhkollektion anzusehen, und versuchte anschließend, meine Schuldgefühle dadurch zu besänftigen, dass ich mir eine Aus- gabe der konsumkritischen Zeitschrift Adbitsters besorgte. Im Wissen um diese Heuchelei ging ich nach Hause, um mich mit radikalen Gedanken aufzuladen, indem ich Gil Scott-Herons »The Revolution Will Not Be Televised« auf meiner teuren Hi-Fi-Anlage hörte. Aus der Desillusionierung wurde ein Verleugnen - war ich wirklich mit dem gesamten Rest der westlichen Welt zu einem markenbesessenen Konsum wahnsinnigen geworden? Oder war es nicht vielleicht doch einfach so, dass w ir uns an den Ergeb- nissen des Kapitalismus erfreuten, etwas, wozu Millionen von Menschen überall in der Welt nicht die Chance bekommen? Diese Argumentation verfing eine Zeit lang. Doch bald begriff ich, dass ich mir damit einfach eine neue Ausrede zum Shop- pen gab. Meine Hilflosigkeit verwandelte sich in Wut. Ich war wü- tend auf mich, weil ich so oberflächlich war, dass ich so viel Zeit und Geld auf nichts anderes als leere Ziele richten konnte. Ich war zornig auf »das System«, weil es überall, wo ich mich auch hinwandte, die Werte des Konsums anpries. In welchem emotionalen Stadium ich mich auch gerade be- fand - ich verlieh ihm Ausdruck, indem ich weiterhin Dinge kaufte. Ich munterte mich mit einem neuen Paar Turnschuhen auf, wenn ich ernüchtert war, ich trug noch auffälligere Marken, wenn ich gerade wieder eine Verdrängungsphase hatte. Und ich erstand Naomi Kleins Buch No Logo und Vance Packards Antiwerbungs-Bibel Die geheimen Verführer aus den Sechziger- jahren. Ich kannte nur eine Möglichkeit, mich auszudrücken: kaufen. Ein paar Monate lang versuchte ich es mit Maßhalten. Ich beschränkte mich darauf, neben den notwendigen Nahrungs- und Reinigungsmitteln nur alle paar Wochen einige überflüs- sige Sachen zu kaufen. Doch Shopping war nur ein kleiner Teil meiner Labelabhängigkeit; was mir vor allem wichtig war, wrar das, wofür eine Marke stand, das Prestige, das mit ihrem Besitz
- 35
- einherging. Einige Menschen hören Ohrwurmmusik, wenn sie sich -aufmuntern, oder sie gehen erstklassig essen, wenn sie sich etwas gönnen wollen. Für all diese Anlässe hatte ich meine Marken. Wie jeder Süchtige weiß, ist Mäßigung nur in den seltensten Fällen ein gangbarer Weg. Jedes Mal, wenn ich eine Zeitschrift aufschlug, sah ich darin Angebote für Objekte, deren Kauf mich glücklicher machen würde. Jedes Mal, wenn ich den Fern- seher anschaltete, sah ich Menschen von diesen Gegenständen umgeben, und sie sahen in der Tat zufriedener aus als ich. Je- des Mal, wenn ich meine Wohnung verließ, gab es in der Nähe Geschäfte mit verführerischen Schaufensterauslagen, die mich zum Zugreifen aufforderten. Askese, wenigstens nahezu, schien ein Ding der Unmöglichkeit, solange die gesamte Kultur um mich herum darauf ausgerichtet war, meine Entschlossenheit zu untergraben. Wie genau soll man die Angewohnheit, Dinge zu erwerben, die man nicht braucht, moderat betreiben? Die Vorstellung eines Lebens ohne Adidas, Nokia und Apple war trostlos. Sie versprach ein graues und freudloses Leben, losge- löst vom Zeitgeist, von meinem sozialen Netzwerk, von mei- nem hart erarbeiteten Status - und in letzter Konsequenz auch von meinem Glück. Diese Angst war mir nicht ganz unbekannt, im Alter von dreiundzwanzig Jahren wurde mir klar, dass ich ein Alkohol- problem hatte. Meine Arbeit in den Clubs, die Partys und ganz allgemein das Leben in London, einer der zechfreudigsten Städte der Welt, hatten meine Trinkgewohnheiten außer Kontrolle geraten lassen. Aus diesem Grund ging ich zu einer Suchtbe- ratungsstelle. Mein zuständiger Helfer erklärte mir, dass einer der ersten Schritte aus der Abhängigkeit darin bestehe, dass ich nicht nur mir selbst gegenüber zugab, ein Alkoholproblem zu haben, sondern dass ich das auch allen nahen Leuten in mei- nem Umfeld erklärte. Jetzt, sieben Jahre später, muss ich er- neut eine Erklärung abgeben - nur hört sie sich diesmal weit- aus lächerlicher an als beim letzten Mal:
- 36
- Ich bin süchtig nach Marken. Ich brauche sie, um glücklich zu sein, um mein Selbstwert- gefühl zu stützen. Ich werde die Marken ebenso aufgeben, wie ich den Alkohol aufgegeben habe. Zumindest fürs Erste.
- An dem Tag, als ich das Trinken aufgab, schüttete ich meine ganzen Vorräte in den Ausguss, zerschlug die Flaschen und zerdrückte die leeren Dosen. Es war eine Art symbolische Geste, an die ich mich jedes Mal erinnern konnte, wenn ich das Bedürfnis verspürte, zu Alkoholischem zu greifen. Meine neue Therapie würde eine ähnlich theatralische Aktion verlangen, um vor mir selbst und vor anderen zu demonstrieren, dass ich es ernst meinte. »Du willst wirklich jeden einzelnen Markenartikel aus der Wohnung tragen und vernichten?«, fragt mich juliet, als ich ihr zum ersten Mal von meinem Plan erzähle. »Ich sehe keine andere Möglichkeit«, sage ich. »Ich habe ein Problem, dem ich mich stellen muss.« »Kannst du die Sachen nicht irgendwo einlagern, bis es dir besser geht?« »Nein, ich muss etwas Dramatisches veranstalten, es muss ein Statement sein. Eine umfassende Zerstörung oder Ver- brennung.« »Du willst deine ganzen Sachen ins Feuer werfen?« Das gehört zu meinen Vorgehensweisen - erst manövriere ich mich in eine Sackgasse, anschließend gebe ich ein völlig ab- surdes Gelübde ab, um mich aus der Zwickmühle zu befreien. »Richtig«, sagte ich. »Ich werde das gesamte Labelzeugs ver- brennen. Damit wäre das geklärt.« »Du kannst machen, was du willst, Neil«, sagte Juliet. »Aber von meinen Dingen, die du als Markenobjekte einordnen könntest, lässt du die Finger.«
- 37
- 16. März
- Der Begriff Marke - oder das in der Wirtschaft mindestens ebenso häufig gebrauchte englische Wort Brand - ist in unse- rem Leben mittlerweile so allgegenwärtig, dass wir ihn oft ge- brauchen, ohne eigentlich zu verstehen, was er bedeutet. Wir kaufen Dinge, die »brandneu« sind. Wir drücken unsere Vor- lieben für Gegenstände aus, indem wir sagen: »Das genau ist meine Marke.« Wenn wir über ein Produkt reden, dann nen- nen wir es oft nicht bei seiner eigentlichen Bezeichnung, son- dern benutzen wie selbstverständlich die Labelbezeichnung. In Businessmeetings höre ich, wie Manager von Brand Vahle, Brand Personality oder Brand Extension sprechen, ohne im Grunde zu verstehen, was sie damit genau meinen. Wenn Demonstranten sagen, dass sie gegen Marken sind, meinen sie dann, dass sie gegen das Unternehmen sind oder gegen die Labels, die es produziert? Oder sind sie gegen die Praxis des Branding- oder gegen den Kapitalismus ganz allgemein? Als jemand, der sein ganzes Leben mit Marken gelebt hat, frage ich mich natürlich, wie und wann genau sie entstanden sind. Und wie schaffen es Firmen überhaupt, dass ihre Logos so viel bedeuten? Schließlich sind es zunächst einmal einfach nur Etiketten, die die Hersteller von Produkten und die Anbie- ter von Dienstleistungen in Umlauf bringen. LTnd um zu ver- stehen, woher meine Besessenheit rührt, sollte ich über den Ursprung von Labels Bescheid wissen. Mit Sicherheit gab es eine Zeit, in der das Kaufen und Verkaufen von bestimmten Dingen keine so große Bedeutung hatte. Aber um das genauer zu eruieren, besorgte ich mir einen Leseausweis der British Li- brary. Immer hatte ich mich, als ich noch Bildungsinstitutio- nen besuchte, redlich bemüht, so wenig Bücher wie nur irgend möglich zu lesen. Ich zog es vor, lieber nebenher zu arbeiten, um mehr Zeit und Geld zum Shoppen zu haben. Jetzt betrat ich freiwillig eine Stätte des Lernens, um etwas über die Ge- schichte der Marken herauszufinden. Schon das war für mich ein riesiger Schritt.
- 38
- Man kann sich kaum noch eine Handlung in unserem Alltag vorstellen, die nicht in irgendeiner Weise mit Marken zu tun hat, egal, ob uns dies etwas bedeutet oder nicht. Sie finden sich in un- serem Zuhause, im Büro, wo immer wir unsere Freizeit verbrin- gen; sie begleiten uns in der Öffentlichkeit und im Privatleben. Und sie sind Teil all der Dinge, die uns das Dasein leichter ma- chen. Mit anderen Worten: Sie stellen die Annehmlichkeiten einer modernen industrialisierten Gesellschaft dar. Die Vor- stellung eines Lebens ohne Autos, Computer, gutes Essen, an- ständige Läden und Dienstleistungen ist die eines Daseins iin finsteren Mittelalter. Kulturen, die keinen Zugang zu derartigen Dingen haben, werden den Entwicklungsländern zugerechnet. Marken gehören zu den Grundbestandteilen unseres tägli- chen Lebens. Wir konsumieren jeden Tag Hunderte von ih- nen. Sie helfen uns, schnelle Entscheidungen zu treffen, das Leben einfacher zu gestalten. Marken sind von zentraler Be- deutung für den Zeitgeist; wer up to date sein oder den Durch- blick haben will, muss über sie Bescheid wissen. Menschen, die sich diesbezüglich neue Trends zu eigen machen, bevor sie die große Masse erreichen, heißen bei den Marktforschern Opinion Farmers. Diejenigen, die neue Produkte nur langsam anneh- men, nennt man Lutc Adapters. So viele Dinge können Labels sein (Waren, Dienstleistungen, Orte, sogar Menschen), dass die Unterscheidung zwischen Marke, Produkt und Hersteller zunehmend schwierig zu treffen ist.
- Produkt Ein Produkt ist etwas, das Geldwert besitzt und das man kauft und benutzt.
- Marke Eine Marke ist der Name, der Begriff, das Zeichen oder das Symbol, das die Herkunft eines Produkts kennzeichnet.
- Unternehmen Die Organisation, die das Produkt herstellt und die das Recht besitzt, die Marke zu nutzen.
- 39
- Auf den einfachsten Nenner gebracht: Unternehmen, die mit Produkten und Dienstleistungen handeln, nutzen Labels dazu, ihre Waren zu kennzeichnen und zu bewerben. Uberall dort, wo in einem Markt Wettbewerb herrscht, ist eine Markenpo- litik auszumachen - das heißt, sobald zwei oder mehr Erzeug- nisse existieren, die das gleiche Bedürfnis stillen, benötigen die Hersteller, Händler und Verbraucher Brands, um die Herkunft der Waren zu bestimmen. Wo eine Auswahl existiert, da gibt es auch Marken. Grundsätzlich ist ein Branding ein Versprechen - das Verspre- chen, sowohl den Konsumenten als auch den Hersteller zu schützen. Uns Verbrauchern verheißt die Marke, dass die Her- kunft des Produkts nachvollziehbar ist und dass man es deshalb von ähnlichen Gütern auf dem Markt unterscheiden kann. Auf der Basis dieses Schwurs können wir den Fertiger für die Quali- tät des Produkts verantwortlich machen, und wir können uns dank unserer Erfahrung schnell entscheiden, wenn wir uns einer Vielzahl von Angeboten im Warenregal gegenübersehen. Mar- ken helfen uns, das Risiko zu verringern, das mit dem Kaufeines Erzeugnisses einhergeht. Ohne dieses Versprechen der Authen- tizität können wir nicht sicher sein, dass ein Fabrikat das leisten wird, was wir von ihm erwarten, ob es den Preis wert ist, den wir dafür bezahlen, oder ob es sich als schädlich oder gar peinlich er- weisen wird. Indem wir ein Markenprodukt kaufen, akzeptieren wir das Versprechen des Herstellers, dass dies ausgeschlossen ist. Der Erzeuger kennzeichnet mit einer Marke sein Eigentum und schützt so seine Investitionen. Ein Unternehmen, das sein Geld dafür ausgibt, Güter zu entwickeln und ihre Qualität zu verfeinern, kann diese Inputs durch das Eintragen von Waren- zeichen, Patenten und Geschmacksmustern absichern. Indem man die Qualität des Produkts konstant hält und seine Vorzüge durch Werbung und Marketing bekannt macht, kann man eine Erwartungshaltung an Qualität und Prestigewert wecken, die letzten Endes den Preis rechtfertigt. Ein klares Branding, also eine eindeutige Markenpolitik, erleichtert es den Kunden, das Erzeugnis zu identifizieren und sich dafür zu entscheiden, es wieder zu kaufen.
- 40
- Durch dieses System können wir im Alltag eine ganze Reihe von Entscheidungen gewissermaßen per Autopilot treffen. Ohne Alarken würde unser Leben zweifellos viel langsamer voran- kommen. Stellen Sie sich die folgende kleine Interaktion in Ih- rem Lieblingskiosk in einer Welt mit und in einer Welt ohne Marken vor:
- Ohne Marken Ich hätte gerne Kaugummi mit Pfefferminzgeschmack. Der Geschmack sollte lange vorhalten und das Kaugummi muss zuckerfrei sein. Außerdem will ich eigentlich nicht mehr als 50 Pence ausgeben. Welche Sorte können Sie mir empfeh- len?
- Mit Marken Geben Sie mir ein Päckchen Extras.
- Wenn man einmal von ihrem Logo und dem Design der Ver- packung absieht, dann sind Marken im Großen und Ganzen nicht konkret fassbar - sie existieren nur in der Gedankenwelt von Hersteller und Verbraucher. Unsere mentale Vorstellung einer bestimmten Marke setzt sich aus mehreren Schichten von Erfahrungen zusammen, die wir mit dem jeweiligen Pro- dukt in Verbindung bringen. Laut dem amerikanischen Marken- guru Kevin Lane Keller muss man »dem Konsumenten bei- bringen, >wer< das Produkt ist - indem man ihm einen Namen gibt - und ebenso >was< das Produkt tut und >warum< das den Konsumenten interessieren sollte.«2 Marken sind mentale Strukturen, die uns dabei helfen, unser Wissen und unsere Ge- fühle gegenüber einem Produkt zu ordnen. Die Markenpolitik des Herstellers muss den Kunden in die Lage versetzen, Diffe- renzen zwischen konkurrierenden Marken wahrzunehmen; der Grad dieser registrierten Unterschiede verleiht dem Label Wert. Manchmal sind konkurrierende Produkte einander so ähn- lich, dass es eigentlich nur ihre Marke ist, die sie unterscheidet. Nehmen Sie zum Beispiel Mineralwasser. Es sind Hunderte
- 41
- von Sorten auf dem Markt, was uns Verbraucher vor die Qual der Wahl stellt. Der Inhalt dieser vielen Wasserflaschen schmeckt im Großen und Ganzen kaum unterschiedlich, stillt den Durst gleich gut, und er besteht, abgesehen von einigen in Spuren enthaltenen Mineralien, aus einem identischen Naturelement. Die einzigen Divergenzen sind die Quelle des Wassers und das Unternehmen, das es abgefüllt hat. Wenn man in einer Bar oder in einem Restaurant etwas zu trinken bestellt, verlangt man beim Kellner nicht nach der Wasserkarte. Und wenn man nicht ausgesprochen patriotisch veranlagt ist (und zum Beispiel lieber französisches Evian als Belgisches Spa-Mineralwasser kauft) oder um die besondere Reinheit des Wassers einer be- stimmten Region weiß, dann kann der Auslöser für die Ent- scheidung, ein bestimmtes Wasser zu kaufen, nur darauf beru- hen, wie man diese Marke wahrnimmt. Ist sie ihr Geld wert? Garantiert sie gute Qualität? Ist es eine, mit der wir uns gern in der Öffentlichkeit zeigen? Die Entscheidung hat praktisch nichts mit dem Produkt selbst zu tun, sondern in erster Linie mit dem, was wir mit der Flasche verbinden, in der sich das Wisser befindet. Diese Assoziationen oder Markenattribute sind eine Mischung aus persönlichen Erfahrungen und erin- nerten Wahrnehmungen, die angesichts von Werbung und Marketing, denen man ausgesetzt war, hängen geblieben sind. Schon die Tatsache, dass wir uns dafür entscheiden, für Was- ser in Flaschen zu bezahlen, wenn wir es aus dem Wasserhahn umsonst trinken könnten (von den Wassergebühren einmal ab- gesehen), belegt, dass wir die Dinge glauben, die Marken wie Evian uns versprechen. Eine moderne Marke leistet viel mehr als nur die optische Kennzeichnung von Produkten und Dienstleistungen durch Logos und besondere Verpackungen. Marken arbeiten mit ei- ner ganzen Reihe von Gedankenverknüpfungen, Bedeutungen und emotionalen Schlüsselreizen, um ein Produkt attraktiver und besser verkäuflich zu machen. Eine Marke steht für die Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, und für den Geist, der dieses beflügelt (Markenimage). Eine Marke kann auch für die »Vision« der Firma herhalten und versuchen, Werte
- 42
- und Einstellungen zu verkörpern, die zu der Zielgruppe pas- sen, für die ihre Produkte gedacht sind (Markenpositionie- rung). Durch diese Ideale baut sie einen Kontakt zum Verbrau- cher auf, der über die praktischen Aspekte eines Bedürfnisses hinausgeht und der mehr mit Hoffnungen, mit einem Wunsch zu tun hat. Virgin-Chef Richard Branson bringt klar auf den Punkt, welche Vision eine erfolgreiche Marke besitzen muss:
- Produkte oder Dienstleistungen werden zu Marken, wenn sie mit Werten durchtränkt sind, die sich in Tatsachen und Empfindungen übertragen, die die Angestellten nach drau- ßen vermitteln und die Kunden sich zu eigen machen kön- nen ... Es sind Gefühle - und nur Gefühle -, die den Erfolg der Marke Virgin ausmachen.3
- Für den Konsumenten muss eine Marke Identität und Markt- position transportieren, außerdem Werte und Kernüberzeu- gungen, die ihn ansprechen - das ist das Markenversprechen. Der Hersteller muss seine Entscheidungen und die Werte auf- einander abstimmen, damit seine Angestellten in der Lage sind, dieses einzulösen. Wenn ich selbst ein Markenprodukt kaufe, dann orientiere ich mich nur selten an Kategorien wie Fertigungsquali tät oder Preis-Leistungs-Verhältnis. Stattdessen wähle ich ein Label, das am besten mit mir spricht. Meine Schuhsammlung ist so groß, dass sie mir wahrscheinlich für den Rest meines Lebens ausreichen würde, trotzdem kaufe ich weiter neue Paare, ein- fach, um meine Zugehörigkeit zu dieser oder jener Marke zu bezeugen. Damit sind die Schuhe nicht mehr nur Artikel, die meine Füße bekleiden und schützen sollen, sie sind ein Mittel, das es mir erlaubt, meine Bindung an die Werte, von denen Ri- chard Branson spricht, zu demonstrieren. Aus Gründen, die ich selbst nicht verstehe, würde ich viel lieber mit Virgin Atlantic als mit British Airways fliegen.
- 43
- TEIL II Countdown
- i
- 17. März 186Tage bis zum Feuer
- Im 15. Jahrhundert führten Priester in Italien auf den Markt- plätzen regelmäßig öffentliche Verbrennungen durch, um Spie- gel, edle Kleidung und Schönheitsutensilien zu zerstören, Ar- tikel, die in ihrer Zeit für Gefallsucht und Sünde standen. In sechs Monaten, von heute an gerechnet, werde ich meinen ei- genen Scheiterhaufen der Eitelkeiten veranstalten. Jeder Tag, der vergeht, ist ein weiterer Tag in Richtung Freiheit (oder ein Tag Komfort weniger, je nach meiner momentanen Stimmung). Ich habe fast zweihundert Tige, in denen ich meinen übermä- ßigen Konsum reduzieren und zu einem markenfreien Lebens- stil finden kann. Wenn ich mich in meiner Wohnung umsehe, dann wird mir schlagartig klar, dass mein Bedürfnis, bestimmte Luxusgegen- stände zu kaufen, schon vor längerer Zeit außer Kontrolle ge- raten ist. Hier finden sich Kleidung, Elektrogeräte und Möbel in Mengen. Aber auch Markenschachteln, Aufkleber, Anhän- geschildchen, sämtliche Arten von erbeuteten Werbeartikeln - alles Dinge, die für mich einen großen Wert zu haben scheinen. Ich habe schon immer gesammelt - Star Wv/z^-Figuren als Kind, im Teenageralter Schallplatten -, das war aber nie mehr als ein Hobby für mich. Doch all dieses Labelzeugs, das sich in sämt- lichen Ecken meiner Wohnung stapelt, ist viel mehr als eine nette Freizeitbeschäftigung. Mein Denken kreist die ganze Zeit darum, Markenartikel zu suchen, auszuwählen, zu erwer- ben, zu konsumieren und zur Schau zu tragen. Ich bin ständig auf der Suche nach neuen Dingen, die ich kaufen könnte. Doch diese müssen eine verwirrende Anzahl von Bedingungen erfül- len: Woher kommt es? Was bedeutet es? Welche Art von Mensch benutzt es? Bin ich das? Wie werde ich mich fühlen, wenn ich es benutze? Was werden andere Menschen denken? Wenn meine strengen Richtlinien erfüllt sind, wird das Produkt auf meine mentale Einkaufsliste gesetzt, und ich muss es erwerben, so-
- 46
- bald ich Muße und das Geld dazu habe. Wird die Zeit zwischen Wollen und Haben zu lang, dann werde ich unruhig. Wenn ich etwas sehe, muss ich es sofort haben. Ich kann nicht auf Son- derangebote warten oder Preise vergleichen, um eine billigere Alternative zu finden. Ist das Kaufsucht? Statusbesessenheit? Eine ungesunde Mar- kenfixierung? Ich habe das Gefühl, es ist von allem etwas.
- - 1 8 2 Tage
- Wie teilt man seinen Freunden mit, dass man markensüchtig ist und bald den Großteil seiner weltlichen Besitztümer ver- brennen will? Auch hier finden sich Parallelen zu dem Ende meiner Alkoholsucht: Unmittelbar nach meinem ersten Bera- tungsgespräch verkündete ich meinen Freunden, Kollegen und meiner Familie, dass mein Alkoholkonsum außer Kontrolle ge- raten sei und dass ich versuchen wolle, das Trinken ganz aufzu- geben. Ich bat um ihre Hilfe, sagte ihnen, dass der Weg dahin schwer werden würde, dass ich jedoch sicher sei, auf ihre Un- terstützung zählen zu können. Damit war ich allerdings völlig auf dem Holzweg. In meiner Aussage, dass Alkoholgenuss zu einem negativen Teil meines Lebens geworden war, steckte implizit auch eine Kritik der Trinkgewohnheiten vieler Leute in meinem Umfeld, die sich von den meinen nicht wesentlich unterschieden. Zu- erst sagten sie mir, ich solle mich nicht so anstellen, ich hätte kein Problem: »Setz dich und trink erst mal einen.« Als ihnen klar wurde, dass ich es ernst meinte, wurden sie erst recht skep- tisch: Seihst wenn ich Schwierigkeiten hatte, wäre ich ja wohl der Letzte, der dazu in der Lage wäre, mit dem Trinken aufzu- hören. Die finale Stufe war schließlich Ablehnung: Ich war ein Miesepeter, nahm die Sache zu ernst, das Ganze war ihnen un- angenehm. Einladungen wurden seltener. Von der Unterstüt- zung, auf die ich gerechnet hatte, war in bestimmten Bereichen
- 47
- meines Bekanntenkreises bald nicht mehr viel zu spüren; es entstand eine Distanziertheit zwischen uns. Wir arbeiteten weiterhin zusammen und sahen uns bisweilen auch privat. Aber es war deutlich, dass ich meine Mitgliedschaft in ihrem Club aufgekündigt hatte, dass ich zu einem Büßprediger wider die Lebensfreude geworden war. Aber Alkoholismus nimmt man letztlich nicht auf die leichte Schulter. Meine neue, von mir selbst diagnostizierte Krankheit, eine Art zwanghafte Markenstörung, w ird ein bisschen schwe- rer zu verkaufen sein. Die Erklärung, mit der ich jetzt meine Freunde konfrontiere, wenn sich unsere Wege kreuzen, ruft die gleiche durchaus verständliche Skepsis hervor: »Du willst das durchziehen? Das glaubt doch keiner.« »Was willst du denn anziehen, einen alten Kartoffelsack?« »Du kannst nicht ohne Marken leben, das ist unmöglich.« »Es wäre besser, wenn du das Feuer mit billigem Plunder veranstaltest und die guten Sachen auf die Seite schaffst.« »Kann ich deine Helmut-Lang-Jacke haben, bevor du sie verbrennst?« Im besten Fall erlebe ich als Reaktion eine wohlwollende Ratlosigkeit, im schlimmsten Fall reflexartige Aggression. Im Übrigen herrscht ziemliche Uneinigkeit darüber, was eigent- lich ein Label definiert. (»Alles ist eine Marke, Neil. Was willst du denn machen, nackt in einer Höhle leben und verhungern?«) Ein befreundetes Ehepaar - er ist Journalist, sie recherchiert für Dokumentarfilme - steht meiner Idee etwas offener gegen- über. Doch bei einem gemeinsamen Essen fangen auch sie an, die Schwachstellen meiner Idee offenzulegen, und ich spüre langsam Panik in mir aufsteigen, dass das, wras ich mir vorge- nommen habe, eine unmögliche Aufgabe, zumindest aber eine sinnlose Geste ist. »Was ist denn für dich eine Marke?« »Nun ja, alles mit einem allgemein bekannten Label darauf.« »Und wras ist mit den Eigenmarken der Supermärkte? Eine Dose Value-Bühnen von Tesco ist vielleicht nicht so schick wie eine Dose von Heinz oder irgendeine Sorte aus biologischem Anbau, aber eine Marke ist es trotzdem.«
- 48
- »Theoretisch gesehen hast du recht, aber der Kauf von Handelsmarken ist doch wohl nicht mit Prestige verbunden, oder?« »Und was ist, wenn man Nicht-Markenartikel in einem La- den erwirbt, der eine Marke darstellt?« »Ah, na ja, über Geschäfte als Marken habe ich noch nicht nachgedacht... ich werde mir wohl ein paar Grundregeln zu- rechtlegen müssen.« Diese beiden Menschen gehören zu den größten Marken- fans, die ich kenne. Er war, als ich ihn kennenlernte, völlig be- geistert von Prada Sport, aber er hat auch ein Auge für die sportlichen Kollektionen anderer Luxusbrands (Comme des Garçons, Missoni, Evisu). Man muss schon genau hinschauen oder fragen, wenn man seine Labels entdecken will, wenn man sie aber dann erkennt, dann zeugen sie stets von souveränem Understatement, treffen genau das richtige Maß. Seine Frau dagegen war früher eine reine Massenmarkt-Konsumentin, doch seit sie mit ihrem Alann zusammen ist, hat sie die Wald-und- Wiesen-Boutiquen hinter sich gelassen, und jetzt gibt es bei ihr nur noch Marc Jacobs und Vivienne Westwood. Ein bisschen dick aufgetragen, aber es steht ihr gut. Ob ich die beiden ein klein wenig mehr schätze, weil sie mich dauernd mit ihren un- auffällig zur Schau gestellten Marken beeindrucken? Wahr- scheinlich schon. Das Zusammensein mit Leuten wie ihnen gibt mir ein angenehmes Gefühl - so, als ob etwas Gutes von ihren Marken an mir hängen bliebe. Bei seinen Nike-Sandalen bin ich mir allerdings nicht so ganz sicher. Es ist klar, dass ich strenge Richtlinien für mein Projekt fest- legen muss, schon um der endlosen Debatte darüber Einhalt zu gebieten, was eigentlich eine Marke ist. Im Verlauf der nächsten Woche definiere ich die Regeln, de- nen ich folgen, und die Ziele, die ich erreichen will:
- Die Ziele 1. Die Markenprodukte in meinem Leben durch markenlose Erzeugnisse ersetzen. 2. Aufhören, Markenprodukte zu benutzen.
- 49
- 3. Alle Markenprodukte verbrennen. 4. Sechs Monate lang ohne Marken leben.
- Die Regeln Produkte, deren Verbrauch erlaubt ist: · Jedes Produkt, das von einem kleinen/lokalen/unabhän- gigen Händler hergestellt wird und keine sichtbaren Mar- kenzeichen trägt. Produkte, deren Verbrauch nicht erlaubt ist: · Alle Markenprodukte, einschließlich der Eigenmarken von Supermarktketten. · Ladenketten, die diskrete oder gar keine Logos verwenden, wie zum Beispiel Muji oder Uniqlo.
- Ausnahmen Gibt es absolut keine markenfreie Alternative für ein Pro- dukt des täglichen Bedarfs, muss ein ethisch korrekter Ersatz gefunden werden.
- - 1 8 0 Tage
- Meine Literaturagentin schlägt vor, dieses Tagebuch in Buch- form zu publizieren. Ich fühle mich etwas unwohl bei der Vorstellung, dass Fremde meine ziemlich oberflächlichen Ver- lautbarungen lesen werden. Andererseits würde ein Offendich- machen diese ganze Angelegenheit aus meinem Kopf in die »reale« Welt hineinkatapultieren: Das ist keine schizophrene Wahnvorstellung meines markenüberfluteten Kopfes, sondern ein Ereignis des realen Lebens. Ist mein Plan erst einmal pu- blik gemacht, dann kann ich wirklich nicht mehr zurück. Juliet witzelt, dass ein Buchvertrag mir helfen würde, einen Teil des Geldes zurückzubekommen, falls ich mein Marken-Ich nach der Verbrennung zurückkaufen möchte. Also starte ich einen Blog, eine Online-Version meines Tage-
- 50
- Iruchs, das den täglichen Abiaufmeines Markenentzugs Schritt für Schritt nachzeichnen wird (und das mir dabei helfen soll, einen Verlag für das Buch zu finden). Der erste Blog-Eintrag ist eine Absichtserklärung, die ich gleichzeitig per Mail an meine alten Auftraggeber in Journalismus, Mode und Werbung schi- cke, außerdem an einige hundert Marketing-Webseiten und konzernkritische Blogs. Ich bin gespannt, ob sich jemand da- für interessiert.
- - 1 7 8 Tage
- Samstag. Shopping-Tag. Gibt es etwas Schöneres, als an einem sonnigen Nachmittag wie dem heutigen durch die Londoner Geschäfte zu streifen und nach Dingen zu stöbern, die man kaufen könnte? Ich bin von einer wilden Vorfreude erfüllt. Es ist, als ob etwas von größter Wichtigkeit in meinem Leben fehlt, eben Markendinge, etwas, das sofort in meinen Besitz gelan- gen muss, etwas, das mich lockerer, zufriedener und selbstbe- wusster machen wird. Juli et geht auch gern einkaufen, doch bei ihr ist der emotionale Einsatz längst nicht so hoch wie bei mir. Ich muss, wenn ich mit einer Partnerin shoppen gehe, meinen kindlichen Enthusiasmus bremsen - da dieser allerdings die Hauptmotivation meiner Einkaufsstreifzüge ist, ziehe ich oft mittendrin alleine los. Ich ziehe mich schick an (die Klamotten für eine Shopping- tour sind von großer Wichtigkeit, allerdings darf es nicht zu auffällig sein. Man will ja nicht wie ein Tourist aussehen), mar- schiere in die Stadt und direkt in das in Frage kommende Ge- schäft. Das ist zielgerichtetes Shopping. Normalerweise richte ich mich gerade auf und hole noch einmal tief Luft, wenn ich den Laden betrete. Ich schaue der Verkäuferin in die Augen und sage Hallo mit diesem gewissen Selbstbewusstsein, das ihr zu verstehen gibt, dass ich es ernst meine, dass ich weiß, was ich tue, und dass ich keine Hilfe brauche. Ich bin jetzt völlig zum
- 51
- Jäger und Sammler geworden, und ich halte nach dem Stück Ausschau, das ich im Sinn habe. Der Höhepunkt ist normaler- weise der Moment, in dem ich /.um Produkt greife und zur Kasse gehe: Dieses Ding wird mir gehören, und ich werde mit ihm so viel glücklicher sein. Während die Kassiererin den Preis in die Kasse tippt, ziehe ich meinen Geldclip heraus und bereite mich aufs Bezahlen vor. Von diesem Zeitpunkt an fällt die Euphoriekurve langsam w ieder ab. Ich fange an, über den Betrag nachzudenken. Brau- che ich diesen Gegenstand wirklich? Passt er überhaupt zu mir? Furcht befällt mich, als mir klar wird, dass Juli et mich wahrscheinlich nicht verstehen wird, weil ich immer mehr Zeug in die Wohnung schleppe. Doch als die Verkäuferin die Sachen hübsch einwickelt und in eine Tüte steckt - ich liebe es, wenn sie die Einkaufstaschen mit einem Aufkleber verschlie- ßen, das hindert einen daran, einen Blick in diese zu riskieren, bevor man zu Hause ist, wodurch die Erwartungshaltung wie- der ansteigt -, hebt sich meine Stimmung augenblicklich wie- der, und ich gehe an der Kasse vorbei aus dem Laden hinaus auf die Straße. Ja, schaut nur her, ich habe etwas gekauft, ich kann es mir leisten, ich bin es wert. Ich schwenke beim Gehen die Tüte, pfeife vor mich hin und behalte die vorübergehenden Shopper im Auge, um zu sehen, ob sie mich mit meiner großen glänzenden Einkaufeta sehe voll brandneuer Sachen auch wahrnehmen. Nichts fühlt sich bes- ser an, als mit einer teuren Tragetasche in jeder Hand heimzu- gehen; ich wandle auf rosa Wolken. Erst wenn ich wieder in meiner Wohnung bin, fällt mein Dopamin-Spiegel. Ich hole die Sachen heraus und lasse schnell die Verpackungen und die Tüten verschwinden, damit Juliet nicht sieht, dass ich etwas Neues gekauft habe, wenn sie nach Hause kommt. Ich probiere an, probiere aus, betrachte eine Zeit lang, was ich erstanden habe. Und ich warte darauf, dass die Magie zu wirken beginnt, dass ich mich vollständiger fühle als vorher. Das ist es schließlich, was ich den Markenprodukten abverlange: dass sie mir das Gefühl geben, mehr ich selbst zu sein. Ich fange an, mich dämlich zu fühlen, dämlich wegen des
- 52
- Geldes, das ich gerade ausgegeben habe, weil ich mich so sehr in den Gedanken hineingesteigert habe, diese dummen Dinge zu kaufen; dämlich, weil sie in ein paar Tagen auf dem Stapel vergessener teurer Klamotten im Gästezimmer landen werden. Das Verrückte ist: Ich wusste, dass das passieren würde. Ich wusste die ganze Zeit, dass ich keine neuen Sachen mehr brau- che, dass neue Sachen mich nicht glücklicher machen und dass ich das Geld sparen sollte, um mir etwas Lohnenderes zu kau- fen. Ich weiß nicht, wie das immer wieder geschieht. Es ist, als ob ich in Trance falle. Erst jetzt, da ich die ersten Schritte unternehme, um mich von diesen ganzen Marken zu lösen, erkenne ich, in welchem Maß sie mein Leben bestimmen. Ich denke wirklich die ganze Zeit an Labels, scheine für ihren Lockruf überempfindlich zu sein. Im Kino fällt mir auf, dass George Clooney das gleiche BlackBerry benutzt wie ich, und ich freue mich darüber, dass wir im Bezug auf Mobil technologie den gleichen Geschmack haben. Obwohl ich von mir behaupte, nicht viel fernzusehen, kenne ich normalerweise jeden Werbespot, der bei den gro- ßen Sendestationen läuft. Einmal bekam ich einen Anruf von einem Marktforschungsunternehmen. Sie wollten wissen, ob ich bereit sei, an einer Umfrage über Musik in T\ T -Werbe- spots mitzumachen. Man spielte mir den Jingle vor und ich musste sagen, zu welcher Marke er gehören würde. Ich wusste achtzehn von zwanzig. Die Dame am Telefon sagte, so viele Treffer hätte sie die ganze Woche noch nicht gehabt. Um ehr- lich zu sein, ich war richtig stolz und erzählte es meiner dama- ligen Freundin. Sie war allerdings nicht so beeindruckt, wie ich gehofft hatte. Auf der Straße achte ich bei jedem Passanten darauf, welche Marken er trägt. Bei einem Mann ist von weitem schwer zu er- kennen, welches Logo genau auf seine Brust gestickt ist, doch ich wende meinen Blick nicht ab, bis ich es erkennen kann. Ich gehöre durchaus nicht zu den Leuten, die auf der Straße nur nach unten schauen und das Pflaster betrachten (außer natür- lich, Labelfighter hätten irgendeine Botschaft auf den Asphalt gesprüht). Wenn ich andere Leute privat besuche, dann ist -
- 53
- wie bei Arnold Schwarzenegger als Tenninator - mein Marken- auge ständig auf der Suche nach Informationen, und ich regis- triere jedes Zeichen für guten oder schlechten Geschmack.
- - 1 7 6 Tage
- Heute saß ich in einem überfüllten Bus, als ich eine wirklich schöne Frau unter den Fahrgästen erblickte. Große dunkle Augen, wunderbar geschwungene Lippen und volles braunes Haar. Wenn ich Single wäre, hätte ich vielleicht irgendeinen ironischen, nonchalanten Baggerspruch versucht (oder zumin- dest darüber nachgedacht). Da ich aber ausgesprochen gebun- den bin, lehne ich mich lediglich zurück und bewundere sie aus der Distanz. Es ist erstaunlich, wie mühelos manche Menschen Schönheit verstrahlen können. Sie müssen sich dazu nicht im Geringsten anstrengen, sie sind es einfach. Ein leichter Schmollmund, ein Zurückwerfen des Kopfes, ein Krausen der Nase. Plötzlich fährt der Bus eine Haltestelle an, der Gang leert sich und die Schöne wird vollständig sichtbar. Katastro- phe. Sie trägt Puma-Schuhe, die bescheuertste Turnschuh- marke aller Zeiten. Die Marke, die sagt, dass man gern cool und abenteuerlustig wäre, aber weder das Selbstvertrauen noch das Flair dazu hat. Wenn man an Puma denkt, dann denkt man an James Blunt, an einen Samstagabend bei Pizza Express, an die DVD-Box von Friends. Mit einem Schlag ist die fesselnde Schönheit der Frau verpufft, und ich drehe mich ernüchtert zum Fenster, um mir etwas weniger Deprimierendes anzu- schauen. Das Verbrennen meiner Statussymbole ist nur ein Aspekt meiner Entwicklung hin zu einer markenfreien Existenz. Min- destens ebenso erschreckend ist es für mich, mir selbst klarzu- machen, nach welchen Gesichtspunkten ich meine Mitmen- schen beurteile. Ich frage mich, wie viele meiner persönlichen Beziehungen auf derart wacklige Fundamente gegründet sind?
- 54
- Ich würde gern glauben, dass ich über diesen Dingen stehe. Aber an solchen Tagen wie heute bin ich nicht so sicher.
- - 1 7 0 Tage
- Meine Recherchen über die Geschichte der Marken fördern einige interessante Parallelen zwischen historischen und mo- dernen Zeiten zutage. Dort, wo wir heute freiwillig Logos auf der Brust tragen, waren die Menschen früher gezwungen, durch bestimmte Zeichen ihre Zugehörigkeit oder ihren Charakter kundzutun. Die frühen europäischen Sklavenhändler verwen- deten Brandmale auf der Haut als Merkmal dafür, dass ihre »Ware« juristisch dem Vieh gleichgestellt war, etwas, das will- kürlich gekauft oder verkauft, gebraucht oder missbraucht wer- den konnte. Das Wort Brand stammt vom altnordischen Wort brandr ab, das buchstäblich »verbrennen« heißt. Die alten Grie- chen kennzeichneten ihre Sklaven mit dem Buchstaben Delta, die Römer brandmarkten flüchtige Sklaven init einem F, meist auf dein Arm, am Hals oder auf der Wade, um ihr Vergehen dauerhaft kenntlich zu machen. Verurteilte Kriminelle, die in der Zirkusarena als Gladiatoren kämpfen sollten, erhielten Markierungen auf der Stirn. Die Angelsachsen übernahmen später diese Praxis, indem sie bei Vagabunden, Zigeunern und Streithähnen ein großes V auf der Brust einbrennen ließen. Diese wurde in England im Jahr 1829 abgeschafft, außer im Fall von Deserteuren, die mit einem D versehen wurden, das man ihnen mit Tinte und Schießpulver eintätowierte. Notori- sche Querschläger unter den Soldaten bekamen auch ein BC (für bad character) eingebrannt, eine Strafe, die erst 1879 abge- schafft wurde. Berichte von Branding in unserer Zeit beschrän- ken sich auf die Initiationsriten amerikanischer Straßengangs und die Fetischszene. Allerdings ging auch die Meldung durch viele Aledien, dass der amerikanische Präsident George W. Bush in seiner Zeit als Präsident der Studentenverbindung »Delta
- 55
- Kappa Epsilon« an der Universität Yale die Praxis einführte, Neumitgliedern mit einem heißen Drahtkleiderbügel ein gro- ßes Delta auf die Pobacken zu brennen. 4 Natürlich wurden nicht nur Menschen mit Brand- oder Mar- kenzeichen versehen. Bereits bei den Griechen und Römern finden sich Logos auf verschiedenen Produkten. Töpfer gehör- ten zu den Ersten, die ihre Waren mit Kreuzen oder stilisier- ten Fischen markierten, und zwar auf Wunsch von Händlern, die die Ton er Zeugnisse in immer größere Entfernungen ver- kauften, auch dort, wo die Reputation der örtlichen Handwer- ker nicht mehr hinreichte. Markenpiraterie war schon im Jahr 50 v. Chr. ein Problem, als Manufakturen damit begannen, minderwertige Produkte mit identischen Markierungen zu versehen, w*as die römische Gesetzgebung schließlich dazu zwang, die Stempel der Handwerker juristisch ernst zu neh- men. Mit dem Untergang des Römischen Reichs ging die Komplexität und geografische Ausbreitung des Handels zu- nächst zurück - und damit verbunden blieben die Warenzei- chen weitgehend auf den örtlichen Handelsverkehr be- schränkt. Unter dem Patronat von Alonarchen, die zunehmend versuchten, über Zünfte und Gilden Monopole zu errichten, begannen die Handwerker des Mittelalters damit, Möbel, Por- zellan und Papier zu kennzeichnen, um Herkunft und Qualität kenntlich zu machen. Als das Ausmaß des Handels wieder zu- nahm, wurde es nötig, dass Hersteller für ihre Produkte ver- antwortlich gemacht werden konnten, und so wurde im 13. Jahrhundert verlangt, dass die Bäcker jeden Laib Brot mit einem Herstellerstempel versahen. Im 17. Jahrhundert wurden Gesetze zur Feingehaltsstempe- lung von Silberwaren verabschiedet und streng überwacht, um das Vertrauen der Kunden in das Produkt zu erhalten. Der Prozess Southern gegen How, der 1618 in England verhandelt wurde, gilt als eines der ersten Gerichtsverfahren über Mar- kenverletzungen. Ein Hersteller hochwertiger Stoffe verklagte einen konkurrierenden Produzenten minderwertiger Stoffe, der seine Ware mit Bezeichnungen versah, die für höhere Quali- täten reserviert waren. Europa und Nordamerika trieben inter-
- 56
- nationalen Handel mit allen möglichen Gütern, von Tabak bis zu Medikamenten, und mit zunehmendem Wettbewerb zwi- schen den Erzeugern erreichte auch die Markenpolitik eine neue Dimension. Neben dem Firmenstempel erschienen nun auch Abbildungen der Hersteller, und die Produkte selbst be- kamen einen eigenen Namen und eine Identität, neben dem Namen des Unternehmens, das sie gefertigt hatte. Eine moderne Markenpolitik entstand offenbar im 19. Jahr- hundert, im Zuge des Produktions- und Konsumentenbooms der Industriellen Revolution. Die Fabriken übten eine starke Sogwirkung auf die Landbevölkerung aus, die auf der Suche nach Arbeit in die Städte zog und ihre weitgehend autarke Le- bensführung hinter sich ließ. Diese neu entstandene Arbeiter- schicht kannte keine Massenprodukte und misstraute ihnen, weshalb sie für die Qualitätsversprechen empfänglich war, die auf verpackten Waren neben den Warenzeichen aufzutauchen begannen. Verbesserte Produktionsprozesse erlaubten es den Herstellern nun, großen Mengen von Waren individuelle Ver- packungen zu geben, wodurch sich Möglichkeiten für aufwen- dige Markenkennzeichnungen boten, was in einem zunehmend umkämpften Markt immer wichtiger wurde. Verbesserungen im Transportwesen sorgten für größere Zuverlässigkeit im in- ternationalen Handel, und einige Hersteller erfreuten sich bald weltweiter Bekanntheit. Um 1850 herum fiel dem Seifen- und Kerzenhersteller Procter & Gamble auf, dass die Hafenarbei- ter Kisten mit ihren Kerzen mit einem Stern versahen, um sie leichter zu identifizieren. Händler, die sich auf den Stern als Qualitätssymbol verließen, weigerten sich bald, Kerzenliefe- rungen anzunehmen, wenn sie nicht dieses Zeichen trugen, und so begann das Unternehmen selbst, seine Verpackungen mit dem Stern zu versehen und das Produkt »Star« zu nennen. Mittlerweile verschlangen die Produktionsstätten Unmen- gen von Geldbeträgen, und die Industrie verlangte angesichts der immer weiter um sich greifenden Produktpiraterie nach Rechtssicherheit, um ihre Investitionen zu schützen. So wurde im Jahr 1870 in den USA ein Markenschutzgesetz verabschie- det; Europa zog bald nach. Im selben Jahr ließ sich Averiii Paints
- 57
- als erste moderne Handelsmarke der USA registrieren, und 1876 wurde das rote Dreieck der Bass-Brauerei zur ersten ein- getragenen Tradeinark Großbritanniens. Um 1890 herum existierten in den meisten Ländern Markengesetze, die Pro- duktnamen und Logos als gesetzlich zu schützende Güter de- finierten. Der durchschnittliche Wohlstand der Familien in westlichen Ländern stieg an. Feste Arbeit in den Fabriken sorgte für ein verfügbares Einkommen, und durch die Entlastung von der Feldarbeit gab es plötzlich mehr Freiräume. Es entwickelte sich die Vorstellung vom Einkaufen als Freizeitbeschäftigung, und damit entstand auch ein Bedarf an nicht lebenswichtigen Produkten (den die Hersteller prompt erfüllten). Neu eröff- nete Kaufhäuser und Katalogversender warteten mit einer rei- chen Auswahl von scheinbar identischen Produkten auf, und der Verbraucher hatte nun wirklich die Qual der Wahl. Viele der besonders verpackten Markenprodukte wraren den Kun- den, die traditionellerweise bei örtlichen Produzenten gekauft hatten, nicht bekannt. Also mussten die Hersteller ihre poten- ziellen Kunden davon überzeugen, dass die nicht vor Ort ge- fertigten Waren vertrauenswürdig waren. Auf diese Weise ent- stand Produktmarketing. Im Jahr 1877 gründete J. Walter Thompson die wahrschein- lich erste Werbeagentur der Welt, und er versprach, jedem Unternehmen zu Ansehen zu verhelfen, das gewillt war, Geld für Werbung auszugeben. In einer 1911 herausgegebenen Bro- schüre mit dem Titel Dinge, die man über Handelsmarken ivissen muss umreißt Thompson die Strategie des Trademarking. Es ist die erste kommerzielle Erklärung dessen, was wir heute als Mar- kenpolitik oder Branding kennen:
- Die Handelsmarken sind das Bindeglied zwischen dem Her- steller und dem Endkunden. Durch die Nutzung von Han- delsmarken, die breit beworben werden, sind die Produzen- ten in der Lage, ein Geschäft aufzubauen, das für einen bestimmten Grad der Qualität, Handwerkskunst und Mate- rial steht.'1
- 58
- Thompson nervte persönlich die Herausgeber von Zeitungen und Zeitschriften, damit sie neben den Leitartikeln Produkt- werbung abdruckten. Bis zu dieser Zeit hatten Printmedien al- lein von den Einnahmen aus Kiosk- und Abonnementsverkäu- fen existiert. Doch Thompson sah in ihrem großen Publikum das ideale Vehikel fiir kommerzielle Werbung, die er als einen zentralen Aspekt des modernen Handels pries:
- Werbung wandelt den menschlichen Glauben in Kapital um. Glauben ist ein mentaler Eindruck. Es ist eine Eigenschaft des menschlichen Geistes, dass es die Dinge sind, die darin den tiefsten Eindruck hinterlassen, nicht abstrakte Ideen. Das heißt, dass erfolgreiche Werbung fest an einen Namen (oder eine Marke) gebunden und dass diese Marke klar defi- niert sein muss und nicht mit etwas anderem verwechselbar sein darf/'
- Dank neuer Werbeplattformen gab es bald Markenprodukte, die im In- und Ausland gleichermaßen bekannt waren. Nach- dem grundlegende Dinge wie Wiedererkennbarkeit und V ei - trauen in die Qualität von Marken gesichert waren, sorgte der immer stärker werdende Wettbewerb dafür, dass die jeweiligen Unternehmen sich auf komplexere Marketingstrategien ver- legten. Designprofis wurden verpflichtet, um Firmen- und Pro- duktidentitäten zu schaffen, Verkäufer gründlich darin geschult, den Markt ihrer Produkte zu verstehen, und die Kreativen in den Werbeagenturen fingen an, in ihren Slogans größere Über- redungskünste anzuwenden sowie die Kunden zu Loyalität ge- genüber ihrer Marke zu ermutigen. Eine Anzeige für Wood- bury's Facial Soap aus dem Jahr 1912 zeigte einen Mann, der in der Pose eines Verführers den Arm einer Frau liebkoste und ihr die Hand küsste, darüber stand der Spruch: »Eine Haut, die man gern berührt.« Einige Leserinnen des Ladies' Home Jour- nal waren von der offenen Sexualität der Anzeige so schockiert, dass sie umgehend ihre Abonnements kündigten. Doch diese Kampagne war der Anfang einer der erfolgreichsten Verkaufs- techniken aller Zeiten.
- 59
- Anfang der Zwanzigerjahre entstanden in Europa kommer- zielle Radiostationen. Die BBC war die erste, sie fing 1922 in London an zu senden. Im gleichen Jahr strahlte in New York WEAF die erste Radiowerbung aus. Die Industrie stürzte sich auf das neue Medium, und im Jahr 1929 wurden in den USA bereits 10,5 Millionen Dollar für Radiokampagnen ausgege- ben. Die Unternehmen und ihre Werbeagenturen fingen an, Marktstudien in Auftrag zu geben und Verhaltenspsychologen zu beschäftigen, um ihre Kunden besser zu verstehen und um Bedarf in Produkte zu verwandeln. John B. Watson, der in den Zwanzigerjahren für J.W. Thompson arbeitete, behauptete, dass Menschen zu drei grundlegenden Emotionen in der Lage sind: Liebe, Angst und Aggression. Also fingen Werbestrategen damit an, sich solcher Konzepte zu bedienen, die mit Status, Sexualität und Unsicherheit arbeiteten. Sigmund Freuds Neffe Edward Bernays, ein früher Pionier der Industriewerbung, ar- beitete für Klienten wie American Tobacco, General Electric und Dodge Motors mit psychologischen Prinzipien. In seinem einflussreichen, 1928 erschienenen Buch Propaganda vertritt er den Standpunkt, es sei in Wirtschaft und Politik gleicherma- ßen legitim, raffinierte Uberzcugungstechniken einzusetzen:
- Die bewusste und intelligente Manipulation der organisier- ten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wich- tiges Element in demokratischen Gesellschaften ... Wir wer- den regiert, unser Geist wird geformt, unsere Ideen werden angeregt, meist von Männern, von denen wir nie gehört ha- ben. Das ist eine logische Konsequenz aus der Alt und Weise, wie unsere demokratische Gesellschaft organisiert ist.'
- Wenn ich mich in meiner Wohnung umsehe, dann wird mir klar, dass ich Tausende schwer verdienter Pfund für Dinge aus- gegeben habe, die mir, zumindest in dem Moment als ich sie kaufte, lebensnotwendig erschienen, die jedoch in Wirklich- keit nur von sehr geringem Nutzen waren. Einige von diesen Dingen, etwa ein lederüberzogenes Roberts-Radio oder ein
- 60
- übergroßer Pra da-Schlüssel ring, werden auf Regalen zur Schau gestellt, wie Trophäen, auf deren Besitz ich einmal sehr stolz war. Wenn ich sie jetzt betrachte, schäme ich mich fast ein we- nig. Wie kam ich eigentlich auf die Idee, dass ich einen 80 Pfund teuren Aschenbecher von Heals brauchet
- - 1 6 9 Tage
- Nennen Sie mir eine Marke, irgendeine, und ich wette, dass ich Ihnen eine fundierte Auskunft über ihre Werte, ihren Status (im Vergleich zu den Mitbewerbern und innerhalb der Gesell- schaft als (Tanzes) und ihre Werbekampagncn der Vergangen- heit geben kann. Ich sage »fundiert«, obwohl ich wahrschein- lich von vielen Brands noch nie einen Artikel gekauft noch mich je für sie interessiert habe. Hier ist ein Mini-Test. Ich denke mir ein halbes Dutzend Marken mit dem Anfangsbuchstaben »Bv< aus (nicht da würden unweigerlich Apple und Adidas auftauchen, und diese Namen werden Sie am Ende des Buches wahrscheinlich nicht mehr hören können) und schreibe Ihnen auf, was mir spontan dazu einfällt.
- Benson & Hedges Sozialer Wohnungsbau, surreale Werbung, heftiges Aftershave, Drogen
- Goldene Zigarettenpackungen, von denen es rätselhafte, aber wirklich coole Werbekampagnen auf Plakatwänden in der Nähe meiner Schule gab. B&H und Silk Cuts waren bei Ziga- rettenmarken das, was Coca-Cola und Pepsi bei den Getränken waren. Schließlich aber wurden sie beide irgendwie ein biss- chen gewöhnlich, und jetzt raucht jeder stattdessen Ma.rI.boro. Wenn ich an B&H während meiner Kindheit denke, dann denke ich an Männer mit Schnurrbärten und schweren Goldringen,
- 61
- die heimliehe Pomostars hätten sein können, was ich cool fand. Heute denke ich bei B&H an zwielichtige Teenager in Kapu- zenpullovern, die am Kiosk »zehn Benson und ein Päckchen King-Size-Blättchen« verlangen. Alan sieht Benson & Hedges auf dem Armaturenbrett von Handwerker-Kleinbussen. Wenn einer meiner Freunde ein Päckchen aus der Tasche ziehen würde, wäre ich überrascht und würde fragen, warum er sie raucht. Vielleicht eine ironische Referenz an die Achtziger)ahre?
- BP Grünes Logo, Umweltverschmutzung, Ginsters Pasties, nackte Frauen
- Das BP-Logo war früher ein Schild, jetzt ist es eine grün-gelbe Blume, was dem Unternehmen ein etwas umweltfreundliche- res Aussehen gibt, auch wenn es der zweitgrößte Öllieferant der Welt ist (was kaum damit vereinbar ist). In jüngeren Jahren war ich stolz, wenn ich das BP-Logo auf Reisen im Ausland sah, weil es die Fahne für Großbritannien hochhielt und so weiter. BP-Tankstellen sind die Heimat der Autofahrer-Junkfood- Marken wie Pringles und Ginsters Pasties. Als Teenager wurde BP für mich zum Synonym von Sex; die örtliche 24-Stunden- BP-Tankstelle lag auf dem Weg vom Pub zu meinem Eltern- haus; dort kaufte ich öfters mit betrunkenem Schädel eines ihrer »Drei zum Preis von zwei«-Vorteilspakete unverkaufter Sexmagazine des Vormonats wie Hustler oder Leg Show. Für das Unternehmen vielleicht nicht unbedingt das, was den Kern der Marke ausmacht, könnte ich mir vorstellen.
- BBC Wahrheit, vornehme Schulleiter,; Roberts-Radios, Imperialismus (auf die wohlwollende und milde Art)
- Wenn ich an die BBC denke, fühle ich mich aufgeklärt, dank- bar und beschützt. Wie im Fall von BP fand ich es immer groß- artig, wenn Leute, die ich im Ausland traf, die BBC kannten -
- 62
- auch wenn ich selbst nie BBC-Fernsehen schaute, weil ITV im- mer die besten amerikanischen Fernsehserien zeigte, Knight Rider und das A-Team. Die BBC war immer ein wenig ange- staubt und gehörte zum Establishment. Zu wenig Schießereien und Verfolgungsjagden für meinen Geschmack. Aber jetzt bin ich erwachsen und ich verstehe: Die BBC ist ein nicht kommer- zialisiertes Wunder, an dem ich mich jeden Tag erfreue, nicht ohne denVerdacht zu hegen, dass sie eines Tages mit der Regie- rung oder dem profitorientierten Sektor in Konflikt geraten wird. Wenn man den Käse ignoriert, den sie als Unterhaltung verkaufen, dann sind die Nachrichten- und Musikprogramme sowie die digitalen Kanäle der BBC eine tägliche Bereicherung meines Lebens.
- Bacardi Mädchen in kurzen Röcken, Fledermauslogo, leuchtendes Orange, Kotze
- Bacardi war schon immer ein Frauengetränk. Als der Sechzehn- jährige, der am ältesten aussah, bekam ich immer die Aufgabe, in Spirituosenhandlungen von zweifelhaftem Ruf Alkohol zu kaufen. Die Mädels wollten immer eine Flasche Bacardi (die Jungs Bier von Tennen t's Super). Seit das Unternehmen die Marke auf widerlich süße Alkopops ausgeweitet hat, denke ich an schlecht gekleidete betrunkene Mädchen, die nachts die Hauptstraße entlangtorkeln und so laut sie können alte Oasis- Hits grölen. Und an die Werbespots mit den Tropenklischees, die uns daran erinnern wollen, dass Bacardi aus der Nähe von Kuba kommt. Nicht, dass es jemanden interessieren würde.
- British Telecom Kajkaeske Callcenter, Familienwerbung, Maureen Lipman, Wutausbrüchc
- Von den gemütlichen, alle Generationen ansprechenden Wer- bespots mit Maureen Lipman aus den Achtzigerjahren bis zur aktuellen Kampagne, die einen gestressten Stiefvater dreier
- 63
- Kinder zeigt - das Marketing von BT erinnert mich an die ge- pflegte Fadheit, die England so vollkommen perfektioniert hat. Wenn es ein Unternehmen gibt, das in der Lage ist, mir die Trä- nen der Langeweile in die Augen zu treiben und mich zu Tob- suchtsanfällen zu provozieren, indem es mir unter die Nase reibt, dass ich kein Individuum bin, sondern eine unbedeutende Nummer unter hundert Millionen anderer Trottel, die sich für dieses Elend entschieden haben, dann ist es dieses. Der Tag, an dem ich meine BT-Verbindung kündigte und zu einer anderen Gesellschaft wechselte, war ein Freudentag für mich (obwohl die Dame im BT-Callcenter meinen Triumph nicht zu regis- trieren schien).
- Branston Pickle Meine Mutter in der Küche, Brot dosen für das Schulfrühstück, braun gelbes Schraubglasy Käsetoast
- Wenn ich an Branston denke, fallen mir nur gute Dinge ein. Ich erinnere mich daran, wie sehr ich meine Mutter liebe, die es reichlich benutzte, wenn sie meine Schulbrote schmierte (die ich zwei Stunden vor der Mittagspause mampfte). Ich denke an die zahllosen Gelegenheiten, bei denen ich die letzten Reste aus dem Glas herauskratzte, oder an kalte Tage, an denen ich von draußen in die warme Küche kam und mir leckere und sät- tigende Käsetoasts mit Pickle obendrauf machte. So etwas kann nur gut sein. Jedes Mal, wenn ich ein Glas aus dem Küchen- schrank nehme, murmele ich unwillkürlich den Werbeslogan »Bring out the Branston« vor mich hin. Empfinden alle Men- schen so über Branston Pickle? Ich denke schon.
- Vielleicht die wichtigste B-Marke in meinem Leben ist im Mo- ment das BlackBerry, diese Verbindung aus Handy und E-Mail- empfänger, die so »nützlich« ist, dass die Community, die die- ses Gerät benutzt, ihm den Namen »Crackberry« gab, weil es ebenso abhängig machen kann wie Crack. Nachdem ich die smarten Manager und die Power-Kreativen mit diesen Din- gern herumfummeln sah, habe ich mir selbst eins gekauft, weil
- 64
- ich ebenso online und up to date sein wollte wie sie. Außerdem suchte ich nach einer neuen Clique, der ich mich anschließen konnte, und das BlackBerry - ein ernst zu nehmendes Werk- zeug für Erwachsene - war ein Ausweg aus diesem ganzen po- lyphonen 3-G-WAP-Wahnsinn der modernen Handys, die, w enn wir einmal ehrlich sind, für Kinder entworfen wurden. Crack ist die richtige Droge für einen Vergleich mit diesem Gerät. Ich bin seit mehr als sechs Alonaten von diesem Teil hypnotisiert, starre ständig auf das Display und schalte zwi- schen den E-Mails und Text-Messages hin und her. Ich lege es nie aus der Hand. Es bestimmt zunehmend mein ganzes Leben und lässt alle Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwin- den - meine Freundin hat eine Videoaufnahme von mir, die mich an einem verlassenen Strand in Siidindien zeigt, wrie ich ziellos am Meer wandere und mein BlackBerry in den Himmel halte, um ein Signal zu erhalten. »Früher waren Blackberrys - also Brombeeren - Dinger, die wir im September entlang der Landstraßen pflückten und aus denen wir einen köstlichen Nachtisch machten«, schrieb Tom Hodgkinson im Guardian. »Heute ist BlackBerry keine kostenlose Leckerei mehr, son- dern eine ausgesprochen teure Landplage.«
- - 1 6 6 Tage
- Meine Agentin arrangiert ein Treffen mit einem Verlag, der In- teresse an meinem Tagebuch hat. Wie so oft habe ich auch hier das Gefühl, dass meine Gesprächspartner nicht wirklich glau- ben, dass ich das Projekt durchziehen werde - obwohl ich Geld dafür bekommen werde, darüber zu schreiben. Während un- serer Besprechung macht der Verleger einen Vorschlag, der mich offenbar zwingen soll, Farbe zu bekennen: Ich soll in ei- ner Art Testlauf eines der Markenprodukte, die mir am wich- tigsten sind, verbrennen. Ein Entschlossenheitstest. Ohne mit der Wimper zu zucken, stimme ich zu.
- 65
- Sobald ich das Büro verlassen habe, fange ich an, darüber nachzudenken, welche Markenartikel für mich die größte Be- deutung haben. Tief in meinem Inneren weiß ich, welche es sind, aber ich kann mich nicht dazu überwinden, sie auch nur in Gedanken in Flammen aufgehen zu sehen: Mein Leben ohne sie wäre so viel ärmer, emotional ebenso wie finanziell. Nach einer Zeit ernsthafter Selbsterforschung enge ich die Liste auf drei Dinge ein:
- Karierte Umhängetasche von Louis Vuitton Einer der ersten Luxusartikel, die ich mir 1999 kaufte, als ich etwas mehr eigenes Geld in der Tasche hatte als sonst. Ich war gerade von zu Hause ausgezogen, und 400 Pfund für diese Tasche auszugeben war ein symbolischer Akt finanziel- ler Freiheit. Alle meine Bekannten hielten es für eine völlig überzogene Geste, aber ich interpretierte diese Reaktion als Neid, was mich dazu veranlasste, das Ding noch demonstra- tiver zu tragen. Sie hat mir sechs Jahre lang gedient, heute wird sie nicht mehr produziert.
- Adidas Turnschuhe »Adistar Runner« Keine Rarität, aber dieses spezielle Paar wurde mir über- reicht, als ich zum ersten Mal mit den Markenmanagern von Adidas UK zusammentraf. Ich komme mir immer etwas grö- ßer vor, wenn ich sie trage. Sie werden nach jedem Gebrauch sorgfältig gereinigt und mit Scotchgard behandelt.
- BlackBerry Ich habe eine Hassliebe zu diesem Ding. Die ständige Ver- fügbarkeit von E-Mail und Telefon hat mich zum Sklaven ei- nes 24-Stunden-Arbeitstages gemacht. Aber der Effekt, den es auf die Umstehenden hat, wenn man es aus der Tasche zieht, ist unübersehbar. Es verleiht mit ein selbstbewusstes, dynamisches, erwachsenes Aussehen und Auftreten. Es zeigt buchstäblich, dass ich im Geschäft bin.
- 66
- Je länger ich darüber nachdenke, umso klarer wird mir, dass meine intensive Beziehung zu unbelebten Objekten (und den Leuten, die sie herstellen) am deutlichsten durch die Adidas- Turnschuhe auf den Punkt gebracht wird. Sie werden den Flammen geopfert. Ich gewähre mir einen Aufschub von sie- ben Tagen. Während dieser Zeit werde ich die Dinger Tag und Nacht tragen, ein angemessener Abschied für etwas, das ich wirklich liebe.
- -164Tage
- Ein Fernsehsender hat mich eingeladen. Es besteht Interesse, das Feuer zu filmen. Während des Meetings fragt mich einer der Produzenten, ob auch Menschen zu Marken werden kön- nen. Jennifer Lopez, Janiie Oliver oder David Beckham zum Beispiel vermarkten jeden Aspekt ihres Lebensstils und ihrer Einstellung, und sie verkaufen Produkte von Parfüm über Koch- bücher bis hin zu Turnschuhen. In gewissem Sinne sind sie wohl selber diese Produkte. »Ihre Partnerin arbeitet doch in einer großen Kunstgalerie, oder?«, fragt er. »Ist sie auch ein Teil Ihrer Markensamm- lung?« »Ja, das könnte man vermutlich sagen. Aber sie kommt na- türlich nicht mit ins Feuer.« »Wären Sie ebenso von ihr angezogen gewesen, wenn sie nicht so einen coolen Job hätte?« Das ist ein bisschen unter der Gürtellinie. Es folgt eine be- deutungsschwangere Pause, und ich erröte über meine offen- sichtliche Oberflächlichkeit. Das Meeting endet kurze Zeit später, ebenso wie meine Chance, ein Fernsehstar zu werden.
- 67
- - 1 6 3 Tage
- Im Rahmen meiner Recherchen zur Geschichte der Marken habe ich mit Adam Curtis Kontakt aufgenommen, einem bri- tischen Dokumentarfilmer, der mit The Century OfThe Seif (zu übersetzen mit: Das Jahrhunden des Ich) einen erstaunlich pes- simistischen Film über den Konsumismus gemacht hat. Ein großer Teil der Dokumentation dreht sich um Edward Ber- nays, der weithin als der Erfinder der Werbung gefeiert wird. Curtis sieht in Bemays einen Pionier des manipulativen Mar- ketings, das eine Kultur des selbstsüchtigen Individualismus hervorgebracht hat. Heute bekomme ich eine E-Mail mit eini- gen seiner Notizen zum Thema:
- Edward Bernays war der Erste, der Freuds Ideen dazu be- nutzte, die Massen zu manipulieren. Er zeigte amerikani- schen Unternehmen, wie sie die Öffentlichkeit dazu bringen konnten, Dinge zu wollen, die sie nicht brauchten, indem sie massenproduzierte Güter mit den unterbewussten Wünschen der Menschen verknüpften. Daraus wiederum entstand eine politische Tdee, wie man die Massen kontrollieren kann: In- dem man ihre innersten Wünsche befriedigt, machte man sie glücklich und damit fügsam. Es war der Beginn des allum- fassenden Ich, das heute unsere Welt dominiert. Einer von Bernays' frühen Kunden war George Hill, der Präsident der American Tobacco Association. Hill bat Ber- nays, einen Weg zu finden, das Tihu des Rauchens unter amerikanischen Frauen zu durchbrechen. Zusammen mit dem amerikanischen Psychologen Abraham Brill stellte Ber- nays fest, dass Zigaretten ein Symbol für den Penis und die sexuelle Alacht des Mannes seien. Wenn er eine Möglichkeit finden konnte, die Zigaretten mit einem Infragesteilen männ- licher Macht zu verbinden, würden die Frauen auch rauchen, weil sie dann ihre eigenen Penisse hätten. Bernays überre- dete eine Gruppe reicher Debütantinnen dazu, mit unter ih- rer Kleidung verborgenen Zigaretten an der New Yorker
- 68
- Osterparade teilzunehmen und dann zu einem vorher fest- gelegten Zeitpunkt auf dramatische Weise ihre Zigaretten anzuzünden. Inzwischen informierte er die Presse, dass eine Gruppe von Suffragetten einen Protest plane, bei dem sie das, was sie »die Fackeln der Freiheit« nannten, entzünden wür- den. Die Nachricht füllte prompt die Zeitungen überall in Amerika, und der Event wurde ein großer Erfolg. Was Bernays geschaffen hatte, war die Vorstellung, dass das Rauchen eine Frau stärker und unabhängiger machte, eine Idee, die sich bis heute gehalten hat. Er erkannte, dass es mög- lich war, die Menschen dazu zu bringen, irrational zu handeln, wenn man Produkte init Gefühlen verknüpfte. Das hieß, dass willkürlich gewählte Objekte zu mächtigen emotionalen Sym- bolen dafür werden konnten, wie man von anderen gesehen werden wollte. Nach dem Ersten Weltkrieg florierte das System der Massen- produktion, Millionen neuer Güter strömten von den Fließ- bändern. Diese Hersteller hatten Angst, dass ein Punkt er- reicht werden könnte, an dem die Menschen genug Waren besaßen und einfach aufhören würden, etwas zu erwerben. Bis dahin war die Mehrheit der Produkte aufgrund von Be- darf verkauft worden - Schuhe, Strümpfe und sogar Autos wurden mit ihrer Funktionalität und ihrer Haltbarkeit be- worben, und das Ziel der meisten Anzeigen war es, der Öf- fentlichkeit die Vorzüge des Erzeugnisses vorzustellen, nicht mehr. Den Unternehmen wurde klar, dass sie die Art und Weise verändern mussten, wie die Amerikaner über Pro- dukte dachten. Edward Bernays hatte einen entscheidenden Anteil an diesem Prozess. Er bekam von dem Verleger Wil- liam Randolph Hearst den Auftrag, die Auflage von einer Reihe von neuen Frauenmagazine zu steigern, und Bernays verlieh diesen Zeitschriften Glanz, indem er Artikel und Wer- bungen darin platzierte, die die Produkte seiner anderen gro- ßen Klienten mit Filmstars verknüpften, zum Beispiel mit Clara Bow, die auch seine Auftraggeberin war. Doch Bernays' Rolle war nicht auf Zeitschriften beschränkt. Er erfand auch die Praxis des Product Placcment in Filmen,
- 69
- indem er dafür sorgte, dass die Filmstars von bestimmten Herstellern mit Kleidung und Schmuck ausstaffiert wurden. Er behauptete, der Erste gew esen zu sein, der den Autoher- stellern sagte, sie sollten ihre Fahrzeuge als Symbole für Se- xualität verkaufen. Er bezahlte Psychologen für Untersu- chungen, die zu dem Ergebnis kamen, dass gewisse Produkte hervorragend seien, und tat dann so, als handle es sich um unabhängige Studien. Er organisierte Modenschauen in Wa- renhäusern und bezahlte Stars dafür, die zentrale Botschaft zu verbreiten: Man kauft neue Dinge nicht nur, um ein Be- dürfnis zu stillen, sondern auch, um anderen sein Selbstbild mitzuteilen.
- Ich könnte nicht viele Produkte benennen, die einfach auf der Basis dessen, was sie können, vermarktet werden. Verglichen mit den offenbar lebensverändernden Eigenschaften so vieler Marken, die im Fernsehen beworben werden, erscheinen diese Gegenstände eher trivial und langweilig. Ein Beispiel ist der Werbespot für Ronseal-Zaunlack, der durch seine ehrliche Ba- nalität besticht: Ein Arbeiter hält eine Dose von diesem Zeugs in die Kamera und sagt einfach: »Wenn Sie Ihr Holz schützen wollen, nehmen Sie Ronseal-Holzschutzlack. Der macht ge- nau das, was auf der Dose steht.«
- - 1 6 2 Tage
- Die Abschiedswoche für meine geliebten Adidas-Schuhe ist vorüber. Ich habe sie zu Hause getragen, auf Meetings und beim Einkaufen. Durch den ganzen Gebrauch sind sie ziemlich schmutzig geworden, darum reinige ich sie ein letztes Mal mit Foot Locker Sneaker Refresh Mousse. Es ist wirklich schreck- lich, mich von ihnen zu trennen - eigentlich armselig. Ich trauere um meinen Verlust und verachte mich gleichzeitig da- für; man kann ohne Übertreibung sagen, dass dies nicht gerade
- 70
- einer der glücklichsten Tage meines Lebens ist, und der unab- lässige Frühlingsnieselregen trägt wenig dazu bei, meine Stim- mung zu verbessern. Ich stapfe durch die Nebenstraßen und Gassen meines Viertels und suche nach einem geeigneten Ort für mein erstes Brandopfer, außer Sichtweite irgendwelcher Uberwachungskameras oder neugieriger Passanten. Schließ- lich finde ich einen alten Treppenschacht aus der Zeit derja.hr- hundwertwende. Er führt zu einer Brücke, die, dem beißenden Uringeruch nach zu urteilen, öfter als Behelfsunterkunft für Obdachlose dient. Das macht die Treppe zum perfekten Ort für den ersten Akt meiner Labelreinigung. Schließlich stehe ich wie die Penner im Begriff, auf meine eigene Türschwelle zu pinkeln. Auf dem zum Urinal verkommenen Treppenabsatz bleibe ich stehen, nehme die Schuhe aus ihrer Originalschachtel und fange an, sie mit Feuerzeugbenzin zu übergießen. Trotz ihrer Jahre sehen die Dinger noch ziemlich klasse aus. Mit einem letzten zärtlichen Blick nehme ich ein Streichholz und stecke die Schnürsenkel in Brand. Sofort ergreifen die Flammen mit einem leisen »Wusch« Schuhe und Schachtel. Die Schnürsenkel zerfallen fast augenblicklich, und die Gum- misohlen rollen sich vorne und hinten auf. Die Oberflächen aus Wildleder und Nylon sind bald nur noch ein schwarz ver- kohlter Brei. Ich stehe auf einer Straße und verbrenne ein Paar Turnschuhe, das vollkommen in Ordnung ist. In ein paar Mo- naten werde ich mit fast allen Dingen, die ich besitze, das Glei- che tun. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, einen Rückzieher zu machen. Ich habe Angst, dass die Flammen außer Kontrolle geraten, deshalb übergieße ich sie mit Wasser (Evian, wenn Sie's genau wissen wollen). Ein unangenehm nach Chemie rie- chender Qualm steigt aus dem zerfallenden Kunststoff. Als der Rauch sich verzogen hat, lässt auch meine Beunruhi- gung wieder nach, und ich seufze erleichtert. Was genau habe ich denn hier eigentlich betrauert? Nicht den finanziellen Ver- lust, auch wenn ich durchaus nicht reich bin. Nein, es ist die emotionale Bindung. An ein Paar Turnschuhe. Das kann nur eine positive Sache sein: Mein erster Schritt in ein neues Le-
- 71
- ben. Die Dinge, die du besitzt, werden am Ende dich besitzen, dies habe ich irgendwo einmal gelesen, und diese dämlichen Turnschuhe haben mich schon viel zu lange besessen. Bald werde ich frei sein von all dem. Vermutlich ist es einfach nur eine Frage einer Umprogrammierung meines Denkens. Ich kann mich selbst lieben und fiir andere liebenswürdig sein, ohne diese ganzen Marken zu besitzen. Ich kann mir Ziele setzen, die über das Anhäufen von Dingen hinausgehen. Ich kann ler- nen, andere Menschen anzuschauen und mir ein Urteil über sie zu bilden, das nicht nur auf den Labels ihrer Kleidung beruht. Oder noch besser, mir gar kein Urteil bilden.
- - 1 5 8 Tage
- Ich habe einen Buchvertrag. Mit einem Schlag ist diese ganz persönliche Reise zu einer öffentlichen Angelegenheit gewor- den.
- - 1 5 5 Tage
- Ich erzähle in meinem Blog die Geschichte von der schönen Frau mit den Puma-Turnschuhen, und innerhalb von zwei Ta- gen meldet sich einer der PR-Manager von Puma:
- Neil, Ihre Kommentare über PUMA sind sehr interessant - für mich nicht zuletzt deshalb, weil Sie einen nicht unbeträchtlichen Teil des letzten Jahres bei uns gesessen haben und uns erzähl- ten, wie wundervoll PUMA sei und Ihre Zeitschrift (die nicht . mehr existiert .. aus irgendeinem Grund?). Sie wissen, dass ich eine Menge Geld bei Ihnen ausgegeben habe, weil Sie uns deut-
- 72
- "lieh machten, wie großartig Zeitschrift und Marke zusammen- passten. Ich nehme an, dass Sie, wenn Sie jemals wieder für eine ähnliche Zeitschrift arbeiten werden, keinen Wert auf Werbeeinnahmen von PUMA legen???? Lassen Sie mich wissen, wie Sie darüber denken.
- Er hat nicht unrecht. Während meiner Zeit bei Lifestyle-Ma- gazinen fühlte ich mich oft unaufrichtig, wenn ich bei Marken, die ich persönlich nicht mochte, um Werbegelder betteln ging (was zeigt, dass ich als Herausgeber und Verleger ungeeignet für diese Aufgabe war). Halbwahrheiten und falsche Freund- schaften zeichnen viele Beziehungen im geschäftlichen Alltag aus, doch Markenmanager sind eine ganz eigene Spezies. Für sie wie diesen hier von Puma ist ihr Job nicht nur ein Mittel dazu, die Hypothek abzubezahlen, etwas, bei dem sie nur das Nötigste tun, um so schnell wie möglich nach Hause zu ver- duften. Sie sind die fanatischsten Angestellten, die man sich vorstellen kann. Sie bleiben in der Regel viele Jahre lang beim gleichen Unternehmen und betrachten es als persönlichen Kreuzzug, die Botschaft ihrer Marke in die Welt zu tragen. Das ist der Grund, warum sie jede Kritik so persönlich nehmen. Es ist auch der Grund, warum ich aus dem Geschäft aussteige und dieses Buch schreibe - Marken wie diese sind eben keine hei- ligen Ikonen. Es sind einfach Firmen, die Schuhe herstellen und verkaufen.
- - 1 4 9 Tage
- Die Leute von Adidas haben von meinem Projekt gehört und laden mich in ihr Büro ein, damit ich ihnen erklären, was ich genau mit diesem Feuer da vorhabe. Adidas, meine allerliebste Marke, das Unternehmen, das am meisten Geld in meine Zeit- schriften investiert hat und, zumindest hier in England, gemes- sen an seiner Popularität im Markt und dem Einfluss innerhalb
- 73
- der Industrie der mächtigste Sportartikelhersteller ist. Ich komme gelaufen wie ein trainiertes Affchen. Als ich das Büro der Presseabteilung betrete, fühle ich mich plötzlich unwohl. Es ist, als würde ich in diesem von mir ange- zettelten Privatkrieg Fremdland betreten. Doch die Paranoia verschwindet schnell wieder, angesichts der dort ausgestellten neuen Produktlinien und der Werbeplakate und Memorabi- lien, die über Jahre hinweg liebevoll gesammelt wurden. Of- fenbar soll das dreiblättrige Adidas-Logo die Kontinentalplat- ten darstellen, die sich im olympischen Geist annähern. »Also, worum geht es denn bei dieser Sache?«, fragt einer der beiden Markenmanager und reißt mich aus meinem dreifach gestreiften Tagtraum. Vorsichtig spiele ich meine Platte ab: von Geburt an eine Marke ... kein Ichgefuhl... alles verbrennen ... gesundes neues Leben ... Ich fühle mich wie ein Katholik, der in der Kirche aufsteht und verkündet, dass er Jude werden will. Es ist klar, dass sie mich eingeladen haben, um die Situation für ihr Unternehmen einzuschätzen, doch zu meiner Überraschung nicken sie immer an den richtigen Stellen, lachen sogar über einige meiner Witze. Sie äußern die üblichen Kritikpunkte - es ist Verschwendung, das alles zu verbrennen, Sie werden das nie durchhalten, es ist sowieso unmöglich, und was ist über- haupt falsch an Marken? Doch erst als ich die peinliche Ge- schichte mit dem Puma-Mädchen im Bus erzähle und berichte, welchen Unmut sie bei Puma UK hervorgerufen hat, wird das Meeting lebhafter. »Sie hatten völlig recht mit dieser Frau«, sagt einer der Ma- nager. »Sie trägt Puma-Schuhe, weil sie glaubt, dass die cool sind und dass sie selbst cool ist. Sie dagegen halten Puma für alles andere als cool, und durch den Blick auf ihre Schuhe können Sie das auch sofort feststellen. Diese Schuhe haben Ihnen die Mühe erspart, die Frau kennenzulernen und erst viel später zu bemerken, dass Sie nicht zusammenpassen. Denken Sie nur, wie viel Zeit Sie verschwendet hätten. Aus diesem Grund braucht man Marken.« Es fällt mir schwer zu widersprechen. Unsere Markenent- scheidungen spiegeln tatsächlich wider, was für Menschen wir
- 74
- sind. Ist daran wirklich etwas Falsches? Es hat mir oft ein Ge- fühl der Sicherheit, ja, der Solidarität gegeben, Teil einer Mar- ken-Community zu sein. Es gibt mir Bodenhaftung: Ich weiß, wo ich im Leben hingehöre. Vielleicht ist dieses ganze Projekt wirklich eine hirnlose Zeitverschwendung. Ich kann mir vorstellen, dass die Adidas-Alarkenleute sich über die negative Publicity freuen, die Puma als Folge meines Blogs bekommt - eine ansehnliche Zahl von Mit-Bloggern hat auf meiner Webseite geschrieben, dass sie meine Abneigung gegen Puma teilen. Ich frage mich, wie sie reagiert hätten, wenn die Sache andersherum gewesen wäre. Wie auch immer, das war zu erwarten. Einer der Manager wechselt das Thema und fragt mich, ob ich ein paar kostenlose Sachen mitnehmen möchte. Mit dem Mut der Verzweiflung halte ich an meinen neuen Prinzipien fest und lehne ab. Nun ja, was hätte ich an- deres tun können, wenn ich einigermaßen in Würde abgehen wollte? Wir wissen alle, dass meine Entschlossenheit wackelt. Es steht mir ins Gesicht geschrieben. Nachdem wir das Buch besprochen haben, geht unser Mee- ting rasch zu Ende. Da ich kein Lifestyle-Journalist mehr bin, ist mein Nutzen für sie nur noch minimal, und ich habe das Gefühl, freundschaftlich in die Vergessenheit verabschiedet zu werden. Als ich auf die belebte Straße hinausstol pere und rechts und links neben mir die Geschäfte sehe und die Kundenströme, die sich mit Plastiktüten voll frischer Konsumenten beute durch die Shopping-Welt wälzen, fühle ich mich sehr, sehr deprimiert. Jetzt sind meine beruflichen Brücken unwiderruflich abgebro- chen. Ich schaue mich um und habe den Eindruck, dass jeder völlig zufrieden mit seinem Markenleben weitermacht, hart ar- beitet, um Geld zu verdienen, das er für die Dinge ausgeben kann, die ihn glücklich machen. Kleidung, Autos, Handys, Es- sen - überall sehe ich Marken und Menschen, die sich an ihnen erfreuen, als ob daran nichts Falsches sei. Vielleicht ist es das auch nicht. Ich will nicht aus der Gesellschaft ausgeschlossen sein, von der Realität abgekoppelt wie irgendein Schizophre- ner, der dem »System« entfliehen w ill. Ist es zu spät umzukeh- ren?
- 75
- - 1 4 3 Tage
- Meine Kindheitserinnerungen aus den Achtziger jähren sind voll von Marken. In der sommerlichen Sportfrei zeit spielte ich Tennis unter einem riesigen Poster von John McEnroe in ei- nem Sergio-Tacchini-Trikot. Neben ihm stand Björn Borg auf dem Centre Court von Wimbledon, gekleidet in Fila. Am Wo- chenende gab es im Fernsehen Autorennen, wobei die Autos nicht an ihren Fahrern zu unterscheiden waren, sondern an ih- ren Sponsoren Marlboro oder John Player Special. Während des Familienurlaubs auf Teneriffa schaute ich den Mädchen nach, die am Strand auf und ab flanierten, prächtig anzusehen in ihren imitierten Gucci-T-Shirts und Hugo-Boss-Miitzen von den örtlichen 'iburistenmärkten. Das höchste Lebensziel war, eines Tages eine goldene Rolex Oyster zu besitzen. Zu die- ser Zeit war die Selbstdarstellung der Marken zweifellos auf- dringlicher und demonstrativer, als es heute der Fall ist. Meine Recherchen über die Geschichte des Werbebooms der Achtziger in der British Library scheinen diesen Eindruck zu bestätigen. In den frühen Achtzigerjahren wurde den Herstellern be- wusst, dass die Konsumenten von der zillionenfachen Auswahl, die ihnen zur Verfügung stand, überfordert waren. Überfüllte Märkte verlangten nach einem starken Branding als Reaktion auf die schwindende Kundenloyalität. Als Reaktion auf den Druck der Aktionäre und schwindende Marktanteile fing die Privatwirtschaft an, Pr.in.t- und elektronische Medien bis zur Ubersättigung mit Werbung anzufüllen, um den Wert ihrer Marken auszubauen. Die Unternehmen gingen zunehmend dazu über, den Kern der Markenidentität - das, was die Mar- ketingleutc Brand Essen ce nennen - in den Mittelpunkt ihrer Werbung zu stellen. Das äußerte sich oft in bombastischen Vi- sionen von einer besseren Welt - die durch die Existenz der ei- genen Produkte noch besser gemacht wurde. Die Verbraucher kauften jetzt nicht mehr nur ein Markenprodukt, sondern eine Reihe von Werten, einen Lifestyle. Das lässt sich deutlich an der Entwicklung der Coca-Cola-Werbeslogans ablesen:
- 76
- 1886 »Drink Coca-Cola« 1900 »For headache and exhaustion drink Coca-Cola« (»Bei Kopfschmerzen und Erschöpfung hilft Coca-Cola«) 1906 »Thirst quenching - deliciouis and refreshing« (»Durst- löschend - köstlich und erfrischend«) 192 3 »A perfect blend of pure products from nature« (»Eine perfekte Mischung reiner Naturprodukte«) 1943 »It's the real thing« (»Das einzig Wahre«) 1957 »Sign of good taste« (»Zeichen des guten Geschmacks«) 1971 »I'd like to buy the world a Coke« (»Ich möchte der Welt eine Coke kaufen«) 1976 »Coke adds lile« (»Coke bringt Leben«) 1989 »Can't beat the feeling« (»Das unschlagbare Gefühl«) 1993 »Always Coca-Cola« (»Immer Coca-Cola«) 1998 »Thirsty for Life? Drink Coca-Cola!« (»Durst auf Le- ben? Trink Coca-Cola«) 2001 »Liie tastes good« (»Leben schmeckt gut«) 2006 »The Coke side of life« (»Die Coke-Seite des Lebens«)
- Marken schienen die Welt zu vereinen. Ein Mensch in China konnte das gleiche Erfrischungsgetränk genießen wie einer in Puerto Rico, auf der anderen Seite des Globus. McDonald's, inzwischen praktisch auf allen Einkaufsstraßen der Welt prä- sent, verkündeten 1988 stolz die Eröffnung ihrer ersten Restau- rants in Ungarn und Jugoslawien, noch vor dem Zusammen- bruch der Sowjetunion. Das Bild des allmächtigen Konsumenten fand seinen Niederschlag in der zunehmenden Bedeutung des Individuums in der Ideologie der politischen Rechten, die auch in England regierte.
- Das Recht des Menschen zu arbeiten, was er will, auszuge- ben, was er verdient, Besitz zu haben, den Staat als Diener und nicht als Herren zu erleben, diese Dinge gehören zum Wesen einer freien Wirtschaft, und von dieser Freiheit hän- gen alle anderen Freiheiten ab. Margaret Thatcher, Wahlw erbespot der Konservativen Partei, 1987
- 77
- Nichts brachte den wirtschaftlichen Boom der Achtziger jähre besser auf den Punkt als der Markt für Luxuslabels, der sich aus seinem angestammten demografischen Segment befreite und jetzt nicht nur den oberen Zehntausend, sondern dem gesam- ten Mainstream die Erfüllung seiner Wünsche versprach. Das weltweite Prestige von traditionellen europaischen Taschen- herstellern (Gucci und Louis Vuitton) und neueren amerikani- schen Modehäusern (Donna Karan, Tommy Hilfiger und Cal- vin Klein) war so groß, dass sich jedes Produkt, das ihr Logo trug (Parfüm, Uhren, Unterwäsche, Sonnenbrillen), zu Höchst- preisen verkaufte, egal, von welcher Qualität es war. Es folgte eine Welle von Produktfälschungen, weil auch die Arbeiter- klasse sich die Symbole der Superreichen aneignen wollte. Angesichts der steigenden Bedeutung, den die Markenpoli- tik für den Verkauf von Produkten hatte, fing die internatio- nale Wirtschaft an, Brands als materielle Werte zu betrachten. Westliche Finanzleute suchten nach Unternehmen mit unter- bewerteten Marken, um sie zu übernehmen, in der Überzeu- gung, dass starke Labels bessere Ertragsleistungen nach sich ziehen und deshalb eine größere Wertschöpfung für die Aktio- näre bedeuten. Die Sachwerte des britischen Süßwarenherstel- lers Rowntree wurden 1988 mit 900 Millionen Dollar ange- setzt, doch im gleichen Jahre kaufte Nestlé das Unternehmen für 4,5 Milliarden Dollar. Was den höheren Preis rechtfertigte, war der immaterielle Wert von Rowntrees bekannten Marken - KitKat, Polo und Smarties. In der Folge erlebte der Welt- markt eine hektische Periode von Fusionen und Übernahmen, wobei fast 50 Milliarden Dollar für allgemein bekannte Mar- kennamen den Besitzer wechselten. Für die Verbraucher wurde die symbolische Bedeutung von Markenprodukten zunehmend wichtiger als deren Nutzwert, und die Werbung lieferte immer neue Offenbarungen und Le- bensziele. Markenwerbung war so emotional geworden, dass einige loyale Verbraucher damit anfingen, ein ungesundes Maß an Zuneigung für ihre Marken zu entwickeln. Als Kellogg's in England den Namen einer seiner Frühstücksflocken von Coco Pops zu Choco Crispies änderte, gab es zu einem Aufschrei.
- 78
- Eine Zeitung veranstaltete eine nationale Umfrage, an der fast eine Million Menschen teilnahmen, 92 Prozent davon stimm- ten für eine Rückkehr zum Namen Coco Pops. Schließlich fügte sich Kellogg's dem Wunsch der Verbraucher und ließ wieder den alten Namen auf die Packungen drucken. Für ei- nige Menschen kam Re-Brandmg, das Verändern einer Marke, der Vernichtung von Kulturgütern gleich. Coca-Cola musste sich von loyalen Kunden, die das verbesserte Rezept der »New Coke« nicht mochten, vorwerfen lassen, dass sie den American Way of Life zu zerstören. Margaret Thatcher bedeckte in einem berühmt gewordenen Vorfall angewidert ein Flugzeugmodell mit dem neuen British-Airways-Logo mit einem Tischentuch. Eine Verbraucherumfrage in den USA wollte herausgefunden haben, dass Marken wie Coca-Cola, Microsoft und Ford Mo- tors als glaubhafter und vertrauenswürdiger eingeschätzt wer- den als Amncsty International, Greenpeace und Oxfam. 8 Su- san Fournier von der Harvard Business School schrieb dieses Phänomen einer generellen Sehnsucht nach bedeutungsvollen Bindungen zu:
- Beziehungen zu Massenmarken können das »leere Ich« be- ruhigen, das zurückbleibt, wenn die Gesellschaft Tradition und Gemeinschaft hinter sich gelassen hat, und sie können in einer Welt des Wandels einen stabilen Anker darstellen. Das Bilden und Aufrechterhalten von Markenbeziehungen erfüllt in der postmodernen Gesellschaft viele kulturell ge- stützte Funktionen. 9
- In den frühen Neunziger jähren kam es schließlich zu einer Ab- kehr von der Markenprahlerei. Auch wenn die Kernbereiche einiger Brands inzwischen geradezu fanatisch umkämpft wur- den, so entwickelte doch der Gesamtmarkt nach und nach ei- nen gewissen Werbeüberdruss. Ein Grund dafür war sicherlich der wilde Eifer vieler Labels, sich am lautesten Gehör zu ver- schaffen. Aber auch die allgemeine wirtschaftliche Rezession sorgte für einen neuen Trend, und zwar einen zu echter Quali- tät und einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis. Der
- Einzelhandel fing an, den Wert großer Marken mit neuen Dis- count-Kaufhäusern und der Veräußerung von Eigenmarken zu untergraben. Der größte Schock kam im April 1993 mit dem Marlboro Fridtiy: Beunruhigt von der Tatsache, dass man zu- nehmend Marktanteile an Discountmarken verlor, verkündete Philip Morris, damals der weltgrößte Konsumgüterkonzern, dass man den Preis des Marktführers Marlboro um sage und schreibe 20 Prozent senken werde. Die Aktien von Philip Mor- ris und vieler anderer brachen prompt ein. Die Zeitschrift Tbc Ecoimnist sagte, ebenso wie andere Wirtschaftsexperten, un- mittelbar darauf den Niedergang der großen Markenunterneh- men voraus:
- Von Marlboro bis Kellogg's, die großen Marken werden von den Eigenmarken der Supermärkte unter Druck gesetzt. Viele werden verschwinden oder nie mehr so profitabel sein, wie sie es einmal waren. The Economist, Juni 1993
- Während die Outlet-Zentren und Discounterketten florierten, traten neue Unternehmen auf den Plan, die eine weniger kra- wallige und eher verantwortungsbewusste Art der Markenpoli- tik favorisierten - Firmen wie The Body Shop oder Aveda. Doch die große, emotional aufgeladene Marke war durchaus noch nicht tot. Uberall dort, wo Regierungen Monopole schleiften und in deregulierten Märkten eine Vielzahl neuer Firmen aus dem Boden schoss, entwickelten sich neue Handelsbereiche für lebensbejahende Prestigemarken. Abstrakte Dienstleistungen wie Energie, Gesundheit oder Telekommunikation verlangten nach Gefühlen, um ihren Produkten echten Wert zu verleihen. Und so wurden Marken wie Enron, The Co-Operative Bank und Orange geboren. Im neuen Jahrtausend war auf einmal alles eine Marke, was vorher keine gewesen war. Pharmaprodukte wie Viagra oder Prozac wurden so extensiv vermarktet, dass ihre Namen Teil der Alltagssprache wurden. Nichtstaatliche Organisationen wie Amnesty International oder Oxfam folgten dem Beispiel der
- 80
- politischen Parteien und machten sich und ihre Ideale zu Mar- ken. Sogar Menschen wurden zu Marken, und ganze Indus- trien entstanden, um aus der Popularität von Stars wie Martha Stewart Profit zu schlagen. David Beckham bekam von Adidas ein eigenes Logo entworfen. Entertainer, Sportierund Politi- ker wurden professionell betreut, damit sie ein kohärentes Wertebild verkörperten, das sich zur kommerziellen Vermark- tung eignete; ihr Erscheinungsbild und Verhalten wurden sorg- fältig kontrolliert und auf die von Experten ermittelte jeweilige Zielgruppe abgestimmt. Das Ende der Rezession und die Öffnung bislang nicht exis- tierender internationaler Märkte, die es zu erobern galt, ließen die Marken zu alter Stärke zurückfinden. Althergebrachte La- bels wie Burberry und Gucci, die lange kaum mehr wahrge- nommen worden waren, erlebten ein Comeback im neu er- starkten Luxussegment, während die Mega-Marken immer mehr an Größe und Einfluss gewannen, bis ihre Kultur ihnen praktisch »gehörte«. Nike war Sport, Microsoft war Compu- ter. Die Besitzer von Autos der Marke Saturn bildeten einen Club, der auf den traditionellen Werten des Unternehmens ba- sierte. Starbucks erschuf eine Art eigenen Dialekt, gab den an- gepriesenen Kaffeegetränken Bezeichnungen wie »Barista« oder »Grande Frappuccino«. Die Disney Corporation baute in Florida eine keimfreie Kommune namens Celebration, eine umzäunte und bewachte Wohnsiedlung für Wohlhabende. So wurde es zu Beginn des 21. Jahrhunderts möglich, seinen Le- bensstil völlig um eine Marke herum zu gestalten.
- - 139Tage
- Mein Blog ist erst ein paar Wochen alt, aber die Zugriffszah- len und der Datenverkehr mit anderen Webseiten nehmen zu. Die Kommentare, die andere User auf meiner Seite hinterlas- sen, sind zu zwei Dritteln positiv und zu einem Drittel wüten-
- 81
- der Mob, wobei mich die Aggressivität der letzteren Gruppe ziemlich überrascht:
- DU BIST EIN IDIOT!!! Los, Neil, ab auf den Scheiterhaufen!
- Man sollte dir in deinen verwöhnten Verschwender-Hintern treten.
- Sehen wir einmal darüber hinweg, dass das Ganze eine große Werbeaktion für die Marke Neil Boorman ist. Dann soll es also eine Selbstverbrennung werden, oder was?
- Der Versuch, gegen »die Marke« vorzugehen, um die wirtschaft- liche Ordnung zu verändern, ist, als wolle man dem Rassismus ein Ende setzen, indem man sich die Haare schneiden lässt.
- Die wütenden Blogger sind der Meinung, dass es arme Men- schen auf der Welt gibt, denen es helfen würde, meine Sachen zu erhalten, und dass ich das ganze Zeug an Wohlfahrtsorga- nisationen spenden sollte, anstatt es zu verbrennen. Es wird auch die Sorge geäußert, dass mein Feuer zur Erderwärmung beitragen könnte. Um allein die Krone aufzusetzen, werde ich auch noch dafür bezahlt, ein Buch über die ganze Sache zu schrei- ben, was wieder einmal zeigt, was für ein oberflächlicher Typ ich bin. Ein Journalist schickt mir eine Nachricht, in der er mir dazu gratuliert, so viele Menschen auf die Palme gebracht zu haben, als ob dies der Sinn der Übung wäre. Ich erkläre, dass das Feuer für mich ein Akt einer persönlichen Katharsis ist, den ich öffentlich mache, um auf die Problema- tik von Konsum verhalten und emotionalisierter Markenwer- bung hinzuweisen. Ja, es soll ein Buch darüber erscheinen und wie jeder kommerzielle Autor werde ich dafür bezahlt, es zu schreiben. Aber die Leute, die meinen Blog lesen oder kommen, um sich die Verbrennung anzuschauen, sind nicht verpflichtet, es zu kaufen. Es kommt mir lächerlich vor, dass ein Star über- all in den Medien auftreten kann, um für seinen neuesten mil- lionenschweren Film, Tonträger oder Sponsorendeal Werbung
- 82
- zu machen, während ein Otto Normalverbraucher, der einen ernsthaften Diskussionsbeitrag leisten und dafür eine beschei- dene Entlohnung erhalten möchte, opportunistisch genannt wird und sich Größenwahn vorwerfen lassen muss. Meine Sammlung von Markenartikeln an wohltätige Orga- nisationen zu spenden sieht vielleicht auf den ersten Blick wie eine vernünftige Lösung aus. Doch werden ein paar zusätzli- che T-Shirts für Oxfam auf lange Sicht irgendeinen nennens- werten Unterschied machen? Wäre es nicht doch besser, wenn man es auch nur einen Tag lang schaffen könnte, das Liebesle- ben von Kate Moss aus den Schlagzeilen zu verdrängen und stattdessen über den Schaden zu reden, der durch Prestigekon- sum angerichtet wird? Ich befürchte, meine Aktion wäre we- der kathartisch noch nachrichtenwürdig, wenn ich sie statt Der Scheiterhaii fen der Marken beispi elsweise Die Spende der Marken für einen wohltätigen Zweck nennen würde.
- - 1 2 6 Tage
- Ich kann nicht genau sagen, warum ich mich im jugendlichen Alter dazu entschloss, ein Apple- oder ein Adidas-Tvp zu sein. Diese Marken sprachen mich einfach instinktiv an, und sie brachten irgendwie die Person auf den Punkt, die ich werden wollte. Doch was ist mit den banalen Alltagsdingen wie Erd- nussbutter oder Toilettenpapier? Ich vertraue so vielen Labels, ohne eine Minute darüber nachzudenken. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, jemals den Markt für Toilettenpapier sondiert zu haben, um eine fundierte Entscheidungsgrundlage für meine Markenwahl zu bekommen. Google ist die Startseite, die auf meinem Mac auftaucht, wenn ich den Browser starte, ob- wohl ich mich nicht entsinne, diese Suchmaschine jemals be- wusst Yahoo oder Ask.com vorgezogen zu haben. Die Visa Card? Die Lurpak-Butter? Der Bic-Kugelschreiber? Diese Lo- gos sind ein Teil meiner Alltagsrituale, beruhigend und ver-
- 83
- traut. Aber ich habe keine Ahnung, warum ich diese erwählt habe. Ich besuche die nächstgelegene Filiale der Buchhandelskette Borders, und ich bin überrascht, wie viele Handbücher zum Thema Marken und Marketing publiziert worden sind. Noch überraschender ist der missionarische Ton dieser Werke, die ganz offen die besten Methoden anpreisen, den Verbraucher- markt zu manipulieren. In seinem Buch Lovemarks behauptet Kevin Roberts, der CEO von Saatchi & Saatchi, man müsse, um das Herz des Konsumenten zu erreichen, Mysterium, Sinnlich- keit und Vertrautheit wecken:
- Wenn die großen Brands überleben wollen, dann müssen sie Loyalität schaffen, die das Rationale übersteigt. Das ist der einzige Weg, wie sie sich von den Millionen »Blands«, den faden, uninteressanten Marken, unterscheiden können, die nirgend wohin gehen. 10
- Das Buch Tbc Culting of Brands erklärt anhand von Fallstudien bei fanatischen Sekten, wie man Konsumentenstämme bildet. In EfuotionalBrandingkaim man nachlesen, welche Konsumen- tengefühle sich am besten ausbeuten lassen. 360 Dcgrce Bran- dhig ist eine Art Manifest, um das Verbraucherumfeld für eine totale Penetration zu sättigen. Es gibt buchstäblich Dutzende dieser Werke, die behaupten, das Geheimnis der »Loyalität jenseits der Ratio« zu besitzen. Die Marke als Ritual, die Marke als Wertesystem, die Marke als Religion, und der Verbraucher fungiert als Anbeter: Diese Bücher mögen sich in haarsträu- benden Übertreibungen überbieten - erstaunlicherweise ist aber die Grundannahme bei allen von ihnen die gleiche: Der Verbraucher ist ein leicht zu formender Tölpel, nichts weiter als das Futter für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Viel- leicht sind wir das tatsächlich.
- 84
- -- 121 Tage
- Ich setze mich in meinem Blog mit der Moral dieser Marken- handbücher auseinander. Ein Journalist namens Matthew de Abuita stellt einen Kommentar hinein, den ich sehr passend finde:
- Würde man jedes Logo, jede Werbung und jedes Markenzeichen, das man auf den Einkaufsstraßen sieht, durch ein Bibelzitat ersetzen, dann bekäme man das Gefühl, in einem unerträglich strengen religiösen Staat zu leben. Ich meine, wenn man all die Plakatwände nähme und Jesus darauf abbildete, dann würde es eine Revolution geben. Wenn man die Symbole der einen Ideologie durch Symbole einer anderen ersetzt, dann erkennt man die Absurdität, der man an jedem Tag seines Lebens ausgesetzt ist, lebenslang.
- - 1 2 3 Tage
- Seit den Babyboomern der frühen Sechzigerjahre hat jede Ge- neration im Westen von den Demografen ihren eigenen Na- men bekommen - Generation X, Generation Y und so weiter. Die gegenwärtige Generation ist allerdings die erste, die nach einer Marke benannt ist. So groß ist die Allgegemvart von App- les iPod und so groß ist der Stellenwert von Marken in der Ju- gendkultur, dass die heute Sechzehn- bis Fünfundzwanzigjäh- rigen als iGeneration bezeichnet werden. Ein Bericht in der Times kommt unterdessen zu dem Ergebnis, dass die Genera- tion Y, zu der ich gehöre, statistisch gesehen, die egoistischste aller bisherigen Generationen ist.11 52 Prozent von uns glau- ben, dass sich die Lebensqualität in England am besten dadurch steigern ließe, dass man das Individuum in den Mittelpunkt stellt - was die extremsten Ausprägungen der Selbstbezogen- heit in der Geschichte manifestiert.
- 85
- -- 121 Tage
- An diesem Samstagnachmittag erfüllten Juliet und ich jedes Klischee, das es für Menschen in meiner Marketingkategorie gibt (macht 21,9 Prozent der Bevölkerung aus). Als männlicher Stadtbewohner aus der unteren Mittelschicht, der in der Krea- tivindustrie beschäftigt ist, kann ich gar nicht anders, als mei- nem Verbraucher-Stereotyp zu entsprechen. Wir schauten uns in einer Kunstgalerie um und kauften ein Exemplar des Guar- dian. Wir gingen in einen Supermarkt der gehobenen Preis- klasse (Waitrose) und erwarben biologische Lebensmittel. Wir schauten uns in einem Möbelgeschäft um (Habitat), und wir kauften dort unnötigen Designer-Nippes für unsere Wohnung. Dieser Tag war so nicht geplant gewesen: Juliet und ich hatten ursprünglich vorgehabt, mehrere Galerien aufzusuchen und dann vielleicht in einen Park zu gehen. Doch unterwegs erga- ben sich so viele Gelegenheiten, Dinge zu erstehen, dass wir scheinbar ganz von selbst in unser natürliches Konsumenten- verhalten verfielen - und bald waren wir mit Einkaufstüten be- laden, deren Marken unseren Lebensstil auf den Punkt brach- ten. Es war angenehm, ja geradezu selbstverständlich für uns, nach ergonomischen Danipfkochtöpfen für Fische zu suchen. Doch dann, auf dem Nachhauseweg, wurden wir an der Bus- haltestelle mit unseren Doppelgängern konfrontiert. Dort stand ein Pärchen um die dreißig, weiß, Angestellte, politisch eher links, ihre Kleidung war unserer sehr ähnlich, in den Hän- den trugen sie ein beinahe identisches Sortiment von Einkaufs- taschen; ganz offenbar hatten sie Designer-Einrichtungsge- genstände für Einsteiger eingekauft und Nahrungsmittel mit beruhigend hohen Preisen und symbolischem ethischen Wert. Mein ganzes Leben lang habe ich versucht, meine Individua- lität durch Markenprodukte auszudrücken; in den Augen all derer, die es sehen wollen, machte meine persönliche Kombi- nation von Dingen mich einzigartig. Das einzige Problem die- ser Methode ist, dass das ganze Zeug aus Massenproduktionen stammt, was der Einzigartigkeit ziemlich zuwiderläuft. (Außer
- 86
- man kauft ein »Limited Edition«-Produkt, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, einem Zeitgenossen mit gleicher Ausstat- tung zu begegnen: Statt von absoluter Sicherheit kann inan in diesem Fall von einer realistischen Chance sprechen.) Man kann natürlich argumentieren, dass die Einzigartigkeit in der Entscheidung für das Produkt liegt, nicht in diesem selbst. In- dividualität kann man nicht aus einer Fabrik kaufen, die 10 000 Einheiten des gleichen Produkts pro Tilg herstellt. Wie dieses Paradoxon mir so lange entgehen konnte, ist mir schleierhaft. Das Selbstwertgefühl, das ich von meinen Marken beziehe, be- ruht zumindest teilweise auf der Überzeugung, dass meine Sa- chen irgendwie einzigartiger sind als die der anderen. Jetzt erst begreife ich langsam, dass ich alles andere bin als ein frei den- kender Verbraucher - im Gegenteil: Ich entspreche in sämtli- chen Einzelheiten meinem demografischen Stereotyp. Ich bin ein wandelndes Klischee mit durchschnittlichen Erwartungen und einem ausgesprochen beschränkten Überblick darüber, was meine Rolle im Leben ist. Nach einer harten Arbeitswo- che kenne ich kein größeres Vergnügen, als meine Zeit damit zu verschwenden, Dinge zu kaufen, die mir ein gutes Gefühl über mich selbst geben - so wie alle anderen Menschen auch. Auf dem Oberdeck unseres Busses schauten wir zu, wie unsere Doppelgänger ihre Tageseinkäufe aus den Plastiktüten nah- men, sie betrachteten und befühlten - die Markentrophäen ei- ner erfolgreichen Jagd.
- -120Tage
- Nach der zurzeit auf meinem Blog vorherrschenden Meinung sollte ich meinen Kram entweder den Londoner Obdachlosen übergeben oder nach Äthiopien fliegen und die Sachen dort persönlich verteilen oder einfach die Klappe halten und dank- bar sein für mein Schicksal. Endlich bekomme ich auch einmal eine Mail mit dringend nötiger Unterstützung:
- 87
- Neil, Sie müssen die Sachen verbrennen. Recycling hat keine ästhetische Aufladung. Ein Protest erfordert Feuer, wie die Selbstverbrennung buddhistischer Mönche zeigt. Die schlechte Information muss zerstört werden, nicht recycelt.
- - 116Tage
- Ich gehe mit einem engen Freund etwas trinken. Simon ist je- mand, der ich gern wäre: intelligent, wortgewandt, witzig und von sanfter Natur, einer der guten Menschen auf dieser Welt. »Ich wollte heute Abend meine Puma-Turnschuhe anziehen, Neil. Aber ich habe deinen Blog gelesen und es mir anders überlegt.« »Ich, äh ... oh, sorry.« »Nein, ist schon in Ordnung. Ich werde darauf achten, sie nie zu tragen, wenn du dabei bist. Es würde mir leidtun, wenn unsere Freundschaft wegen eines Paars Turnschuhe in die Brü- che geht.« »Komm schon, Simon, so war das doch nicht gemeint.« »Doch, Neil, das glaube ich schon.«
- - 1 1 5 Tage
- »Denken Sie an eine Farbe«, sagt Jim. »Rot«, sage ich »Okay, jetzt sehen Sie sich um und versuchen Sie, sich sämt- liche Dinge in diesem Raum zu merken, die rot sind.« Er gibt mir dreißig Sekunden Zeit, um mir alles einzuprägen: Stuhl, Ringbücher, Hefter, Kulis. »Jetzt schließen Sie bitte die Augen und denken Sie gut nach. Nennen Sie mir alle Dinge in diesem Raum, die blau sind.«
- 88
- »Ich ... äh, mir fallen keine ein.« »So funktionieren Marken - selektives Filtern. Das Bewusst- sein sagt dem Unterbewusstsein, worauf es sich konzentrieren soll. Man sieht mehr von einer Sache und weniger von einer anderen, obwohl beide da sind. Markenpolitik besteht also zum Teil darin, die Kunden darauf zu trainieren, dass sie die Kon- kurrenz herausfiltern.« Ich sitze im Büro von ESP, einer Kommunikations-Bera- tungsfirma, die sich auf psychografische Forschung spezia- lisiert hat. Firmen wie ESP analysieren die Psychologie von Verbrauchermärkten und versuchen zu entschlüsseln, welche unterbewussten Wünsche uns zum Kaufen motivieren. Mit diesem Wissen bewaffnet, können sie Unternehmen dabei hel- fen, die Loyalität und die Zufriedenheit ihrer Kunden zu ver- größern. Im Grunde genommen vermessen diese Leute die Persönlichkeiten verschiedener Kimdentypen und bestimmen, aufweiche Art von Werbung sie jeweils am besten reagieren. Ich bin im Internet über diese Firma gestolpert und habe mich gefragt, ob ein psychometrischer lest mir vielleicht helfen würde, meine Bindung an spezifische Marken zu erklären. Warum ge- nau ziehe ich einen Schuhhersteller so entschieden einem an- deren vor? Wenn es jemand herausfinden kann, dann müssen es diese Leute sein; sie arbeiten schließlich die meiste Zeit für BMW und Tesco. »Das hat alles mit Rapport zu tun, Neil. Marken versuchen, Ihren eigenen Rapport zu imitieren und zu spiegeln, genau so, wie wir das mit unserer Körpersprache machen. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie man die Haltung seiner Freimde kopiert, wenn man im Pub mit ihnen redet - die Beine übereinander- schlagen, die Schultern recken, diese Dinge? Nun, wir machen hier das Gleiche, wir stellen eine Bindung zwischen Menschen und iMarken her. Wenn Menschen sich ähneln, dann mögen sie sich auch. Wissen Sie, was bei N L P die Definition von Rapport ist? Das unbewusste Akzeptieren von Anregungen.« In den nächsten Stunden lasse ich eine Reihe von Interviews und Fragebögen über mich ergehen, einige davon unter Hyp- nose.
- 89
- Wenn Sie Ihre Batterien wieder aufladen wollen, machen Sie das lieber allein oder mit anderen zusammen? Alkin.
- Wenn Sie in eine Situation kommen, handeln Sie normaler- weise schnell, nachdem Sie die Situation erfasst haben, oder bedenken Sie zuerst alle möglichen Konsequenzen und han- deln erst dann? Ich handle schnell.
- Wenn jemand zu Ihnen sagt »Ich habe Durst«, würden Sie diese Bemerkung interessant finden, aber wahrscheinlich nichts unternehmen - oder würden Sie sich verpflichtet füh- len, deswegen etwas zu machen? Ich würde mich verpflichtet fühlen, etwas zu unternehmen.
- Sortieren Sie die Antworten auf die folgenden Aussagen da- nach, welche am ehesten auf Sie zutreffen (4 für diejenige, die Ihnen am meisten, 1 für diejenige, die Ihnen am wenigsten ent- spricht).
- Während eines Streits beeinflusst Sie am ehesten: · der Ton der Stimme Ihres Gegenübers (1) · ob Sie den Standpunkt Ihres Gegenübers nachvollziehen können oder nicht (4) · ob Ihr Gegenüber die Fakten oder eine logische Argumen- tation auf seiner Seite hat (3) · ob Sie das Gefühl haben, die wahren Gefühlen Ihres Gegen- übers zu kennen (2)
- Es ist für Sie am leichtesten: · eine Stereoanlage anzuschalten und die ideale Lautstärke zu finden (2) · bei einem Thema den intellektuell wichtigsten Punkt zu er- kennen (3) · die gemütlichsten Möbel auszusuchen (1) · lebhafte, attraktive Farbkombinationen herauszusuchen (4)
- 90
- Man zeigt inir anschließend Diagramme mit Schachteln unter- schiedlicher Größe und Anordnung, die ich kommentieren soll. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, sagt man mir. Dann geht es weiter mit Wertvorstellungen. Was ist mir im Leben wichtig? Was ist der Sinn des Lebens, was gibt mir das Leben? Da ich noch nie richtig darüber nachgedacht habe, ant- worte ich mit dem Ersten, was mir in den Kopf kommt. Wir erstellen eine Hierarchie meiner Konsumentenwerte:
- 1. Zufriedenheit 2. Befriedigung meiner Wünsche 3. Glück 4. Aufregung 5. Vergnügen 6. Identität
- Das Interview geht zu Ende und Jim erklärt, dass er durch Zu- sammenziehen aller Ergebnisse mein Profil ermittelt hat. Er weiß jetzt, welche unterbewussten Werte mein Verhalten mo- tivieren, und er könnte mit großer Genauigkeit erraten, auf welche Marken ich am ehesten anspreche. Im Laut der Zeit wäre er in der Lage, zu beeinflussen, wie ich über eine Marke denke, indem er die Werte, die mein Unterbewusstsein antrei- ben, spiegelt oder gar verändert.
- Zusammenfassung des psychometrischen Profils von Neil Boorman
- Introvertiert Ich ziehe es vor, allein zu sein und Informationen innerlich zu verarbeiten. Ich neige dazu, Entscheidungen ohne den Rat anderer zu treffen, anders als Extrovertierte, die eher in- stinktiv handeln und sich durch die Meinung anderer Men- schen beeinflussen lassen. 60 Prozent der Engländer sind in- trovertiert.
- 91
- Überblickstyp Ich ziehe den großen Überblick dem kleinen Detail vor. Ich denke gern darüber nach, wie Dinge sich auf die Zukunft auswirken. Nur 25 Prozent der Engländer sind Überblicks- denker. Die Mehrheit sind Detaildenker, die lieber mehr In- formation haben und sich für die praktischen Aspekte von Sachen interessieren.
- Gefühlstyp Ich bin emphatisch, denke sozial und nutze Ereignisse der Vergangenheit als Bezugs rahmen. Ich treffe Entscheidun- gen, die oft unbewusst auf meinem Bauchgefühl und persön- licher Erfahrung basieren - im Gegensatz zu Denkertypen, die objektiver sind, weniger loyal und dazu neigen, sich gründlich zu informieren.
- Impulsiv Ich bin flexibel und offen für Vorschläge, doch ich mag es nicht, wrenn sie mir aufgezwungen werden. Planungstypen sind dagegen plötzlichen Veränderungen eher abgeneigt.
- Visuell Marken, die gut aussehen, sprechen mich eher an als solche, die sich gut anfühlen, gut anhören oder die gar vernünftig sind. Lange schriftliche Gebrauchsanweisungen langweilen mich. Andere Menschen reagieren vielleicht eher auf Berüh- rung, Klang oder Logik.
- Loyalität Hier habe ich eine hohe Punktzahl - ich schätze die Loyali- tät einer Marke, und ich bin im Gegenzug selbst ausgespro- chen loyal.
- »Ich wette, Sie benutzen nur Apple-Com puter«, sagt Jim. Ich habe kerne einzige meiner Lieblingsmarken erwähnt, seit ich hier bin, und ich habe meinen Laptop zu Hause gelassen. Er- staunlich.
- 92
- »Woher in aller Welt wissen Sie das?«, frage ich. »Sie sind ein Uherhlickskonsunient, wie ich. Sie haben einen Rapport mit Apple, weil Apple persönliche Freiheit, Stil und Individualität repräsentiert. Das sind die Marken werte von Apple. Für Microsoft dagegen sind die Werte eher logisch, sie konzentrieren sich mehr darauf, was in dem Computer drin ist, und weniger, wie er aussieht.« Apple ist der einzige Computerhersteller des Planeten mit diesem Profil, also ist Jims Vermutung vielleicht gar nicht so überraschend. Um seine Theorie zu testen, frage ich ihn, warum ich so eine starke Loyalität ausgerechnet für Adidas entwickelt habe und nicht für eine der anderen Sportmarken mit Life- style-Appeal. »Wenn Sie so loyal zu Adidas sind, dann wurde das wahr- scheinlich verankert, als Sie in einem hochsuggestiblen Zu- stand waren. Eine Marke ist ein externer Stimulus, der interne Reaktionen auslöst. Oft kann man sich beim Hören eines spe- ziellen Musikstücks sofort an ein Ereignis erinnern, das mit ei- ner starken Emotion verbunden ist. Marken verankern sich an einem bestimmten Moment in Ihrem Leben und funktionie- ren dann als Trigger, genauso wie Musik. Jedes Mal, wenn Sie die Marke sehen, löst das eine Empfindung aus. Erzählen Sie mir von Ihren frühesten Erinnerungen, die Sie mit Adidas ver- binden.« Ich erzähle von Musikvideos, Fernsehübertragungen von den Olympischen Spielen, schwärme von einer älteren Mit- schülerin, die einen Adidas-Trainingsanzug besaß - keine die- ser Erinnerungen scheint einen Sinn zu ergeben. Dann fällt mir mein erster Schultag ein, das Gefühl, aus der Gruppe auf dem Schulhof ausgeschlossen zu sein, weil ich nicht die rieht i- gen Klamotten anhabe. Diese Jungen trugen alle Adidas. »Das ist es! Adidas ist in den Gefühlen verankert, die Sie an diesem Tag verspürten. Sie waren hochsuggestibel. Sie hatten das Bedürfnis nach einer externen Verbindung, und Sie sahen die Marke als ein Mittel für persönliches Wachstum. Wenn Sie heute Adidas sehen, dann erinnern Sie sich daran, wie es sich anfühlt, zurückgewiesen zu werden, und diese Marke bietet lli-
- nen die Möglichkeit, akzeptiert zu werden. Für Sie bedeutet Adidas, akzeptiert und geliebt zu werden.«
- -110Tage
- Ich suche hektisch in der Wohnung nach der »richtigen« Plas- tiktüte, um ein paar Bücher mit zum Job zu nehmen. Dass ich schon zwanzig Minuten zu spät für ein Meeting bin, erscheint mir im Moment weniger wichtig. Jede der zahllosen Super- markt-Plastiktaschen, die meine Küchenschublade verstopfen, könnte diese Aufgabe problemlos erfüllen. Aber es erscheint mir wichtig, dass die Tüte ein Logo trägt, das meiner Persön- lichkeit entspricht - mehr Selfridges als Sainsbury's, wenn Sie so wollen. Abgesehen davon, dass ich eigentlich gar kein Self- ridges-Typ bin. Haben wir denn nicht eine John-Lewis-Trage- tasche oder vielleicht eine von Harvey Nichols? Selbsterkennt- nis über mein Tun kommt mir erst, als ich bemerke, dass Juliet mich ungläubig anstarrt. »Neil, warum durchwühlst du das ganze Haus?« »Ich suche nach der richtigen Tüte.« »Was ist denn falsch an den ganzen Tragetaschen, die du auf dem Küchenfußboden verstreut hast?« »Ich habe dir doch gesagt, dass ich nach der richtigen suche.« Sie dreht sich um und geht zur Arbeit, ich bleibe zurück und denke über meine Situation nach, inmitten eines Meeres von Tragetaschen-Trophäen. Betrachten wir diese Situation einmal aus einer realistischen Perspektive. Ich bin gewohnheitsmäßiger Shopper und ich denke viel und intensiv über die Bedeutung von Marken nach. Shopping ist der nationale Zeitvertreib der Engländer, ich bin also kein Einzelfall. Doch meine Gewohnheiten grenzen an Obsession: Wenn ich nicht shoppe, dann plane ich meinen nächsten Einkaufstrip und stelle in Gedanken endlose Listen von Dingen zusammen, die ich unbedingt haben muss. Ich habe
- 94
- eine Woehe dafür gebraucht, mich von einem Paar Turnschuhe zu verabschieden (das ist noch nicht lange her), bevor ich es dann in einer Art Racheakt verbrannte. In wenigen Monaten werde ich meinen gesamten Besitz öffentlich dem Feuer über- geben. Besessenheit. Vergeltungsgedanken. Pyromanie - das ist kein normales Verhalten. Am Ende meiner Alkoholtherapie sagte mein Betreuer, dass eine langfristige psychologische Behand- lung mir vielleicht helfen würde. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür.
- - 1 0 9 Tage
- Wenn ich die Veröffentlichungen der Konsumkritiker lese, dann beschleicht mich oft der Verdacht, dass die Autoren viel- leicht ein klein wenig paranoid sein könnten, empfänglich fur Verschwörungstheorien, die eine gute Story abgeben, aber we- nig Sinn. Dann stolpere ich in der Bibliothek über Zitate von bekannten und erfolgreichen Geschäftsleuten, die mich zutiefst erschrecken. Hier ist eines davon:
- Wir müssen Amerika von einer Bedüifnis- zu einer Wunsch- Kultur umformen. Die Menschen müssen darauf trainiert werden, neue Dinge erstreben zu wollen, bevor die alten völ- lig abgenutzt sind. Wir müssen eine neue Mentalität for- men ... die Wünsche des Menschen müssen seine Bedürf- nisse überschatten.12 Paul Maser, Lehman Brothers (amerikanische Investment- bank), 1924
- Da ich in einer Wunsch-Kultur aufgewachsen bin und nie et- was anderes gekannt habe, sind solche Zitate eine echte Er- kenntnis für mich.
- 95
- -- 121 Tage
- Ich stehe im Supermarkt vor dem Zahnpastaregal. Dort gibt es Hunderte von Marken zur Auswahl. Unter anderen sehe ich eine Tube mit dem Logo von Arm & Hammer. Ich erinnere mich an einen Werbespot, in dem es hieß, dass Arm & Ham- mer Backpulver herstellen. Die Packung sagt mir, dass Back- pulver in der Zahnpasta enthalten ist. Ich entsinne mich, dass in diesem Werbefilm gesagt wurde, Backpulver sei ein gutes Mittel, um Flecken auf den Zähnen zu entfernen, ohne sie zu beschädigen, auch, dass es eine amerikanische Werbung war. Amerikaner haben eine Menge erstklassiger Produkte, manche davon gibt es hier in England gar nicht. Diese Zahnpasta muss also gut sein. Ich sehe nach dem Preis und vergleiche ihn mit dem anderer Marken. Sie ist teuer, aber nicht die teuerste im Angebot. Ich will meine Zähne reinigen, aber sie weißer zu ma- chen wäre auch nicht schlecht. Menschen mit wreißen Zähnen sind attraktiver. Filmstars und Fernsehansager haben weiße Zähne. Wenn ich nun weißere Zähne hätte, würden mich die Leute vielleicht aufregender finden. Ich mag es, mich attraktiv zu fühlen, es gibt mir Selbstbewusstsein. Und ich will mich selbstbewusst fühlen. Ich werde also diese Zahnpasta kaufen. Das ist der Denkprozess, der in meinem Kopf abläuft, wenn ich ein neues Markenprodukt aussuche. Mein Gehirn führt die- sen in Sekundenbruchteilen im Unterbewusstsein durch. Ich werde bei meinem Einkauf in diesem Geschäft wahrscheinlich hundert ähnliche Entscheidungen treffen. Alle Konsumenten, die vor der Wahl stehen, tun dies Tig für Tag. Zugegeben, einige von uns lösen das Dilemma auf der Basis des Preises, andere orientieren sich daran, wie die Verpackung aussieht oder sich anfühlt. Doch die vielen Alternativen können sich auf eine Kons- tante berufen, die für alle zutrifft - und das Gleiche gilt für un- ser Zurückgreifen auf bekannte Marken, die uns die Entschei- dung erleichtern. Ich bin sicher, dass ich deutlich zu viel Zeit damit verbringe, diese zu treffen.
- 96
- -- 121 Tage
- Wenn ich mit Freunden über mein Projekt spreche, vertreten diese oft den Standpunkt, dass zwar einige unserer Einkäufe Wünsche erfüllen, dass wir aber in den meisten Fällen rational konsumieren, auf der Basis unseres Bedarfs. Im Ernst - wie viel Prestige kann man mit einer Tube Markenzahnpasta gewinnen? Diese Argumentation, dass einige Produkte rein funktionaler Natur sind, leuchtet ein. Doch nach den Marketinghandbüchern, die ich gelesen habe, ist das eindeutig nicht der Fall. Eine Reihe von Bedürfnissen muss erfüllt sein, bevor wir etwas kauten. Ei- nige dieser Wünsche sind eher alltäglich und praktisch, andere dagegen aufregend und emotional. Grundsätzlich gibt es vier Kriterien:
- Funktionale Attribute: woraus das Produkt gemacht ist Funktionaler Nutzen: was das Produkt kann Emotionaler Nutzen: welches Gefühl das Produkt auslöst Prestigenutzen: wie das Produkt unser Leben verändern wird
- Natürlich sind nicht all diese Gebrauchswerte in jedem Fall gleich wichtig. Wenn wir uns in ein bestimmtes Paar Schuhe oder in irgendeinen elektronischen Schnickschnack verlieben, dann fragen wir nicht lange, woraus diese Schuhe gemacht sind oder was sich im Inneren des Elektrogeräts befindet. Anders- herum denken wir beim Kauf einer bestimmten Marke von Toilettenreiniger nicht lange darüber nach, ob der uns glück- licher machen wird oder nicht. Und doch spielt selbst bei der banalsten. Kaufentscheidung jedes dieser Kriterien eine Rolle. Und je größer der emotionale und Prestigenutzen ist, den wir im Besitz eines Markenprodukts sehen, desto mehr Geldwert billigen wir ihm auch zu. Wir verbringen sehr wenig Zeit damit, uns zu wünschen, unsere Toilette möge blitzend sauber sein, deshalb ist auch der finanzielle Wert des durchschnittlichen Toilettenreinigers niedrig. Übrigens bin ich davon überzeugt,
- 97
- dass es kein Problem sein dürfte, einen solchen der gehobenen Preisklasse auf den Markt zu bringen.
- COLGATE Zahnpasta Funktionale Attribute: reinigende Wirkstoffe, Fluorid, fri- scher Pfefferminzgeschmack Funktionaler Nutzen: die Zähne weiß machen, vor Karies schützen, Atem erfrischen Emotionaler Nutzen: Selbstvertrauen durch das Bewusst- sein, ein weißes, wohlriechendes Lächeln zu haben Prestigenutzen: dynamischer im gesellschaftlichen Umgang
- MERCEDES Funktionale Attribute: gut designte und gefertigte Kompo- nenten Funktionaler Nutzen: verlässlicher, komfortabler P K W Emotionaler Nutzen: Selbstvertrauen durch Sicherheit und Prestige der Marke Prestigenutzen: besserer Fahrer, wirkt auf den Betrachter at- traktiver/erfolgreicher
- NIKE -Laufschuhe Funktionale Attribute: fortschrittliche Technologie durch Sohlendämpfung Funktionaler Nutzen: bietet Komfort und Stabilität beim Laufen Emotionaler Nutzen: das Gefühl, richtig ausgerüstet zu sein, größeres Selbstvertrauen beim Erreichen von Zielen Prestigenutzen: dem olympischen Läufer in der Werbung ähnlicher werden
- Die Mehrheit der Kaufentscheidungen in unserem Alltag ist funktionaler Natur - welches Sandwich, welches Klopapier, welches Shampoo? Doch bei diesen banalen Überlegungen kommen emotionale und Prestigeerwägungen ins Spiel, die unseren Personentyp reflektieren. Wie kommt es, dass der Kauf eines Shampoos so viel bedeutet? David Ogilvy, der Gründer
- 98
- der Werbeagentur O&.M, hat einmal festgestellt, dass die Ver- nunft bei unseren Entscheidungen an der Ladenkasse nur eine geringe Rolle spielt:
- Je größer die x\hnlichkeit zwischen Produkten ist, desto we- niger spielt bei der Wahl der Marken die Vernunft eine Rolle. Es gibt eigentlich keinen signifikanten Unterschied zwischen den verschiedenen Marken von Whisky, Zigaretten oder Bier - sie sind alle ziemlich gleich."
- Im Allgemeinen sind die funktionalen Unterschiede zwischen den konkurrierenden Produkten im Supermarktregal dünn ge- sät, abgesehen von einer Spur Ylang-Ylang hier und einem spe- zifischen organischen Peptid dort. Meistens erfüllen die Mit- wettbewerber die gleichen Aufgaben, und zwar vollkommen zufriedenstellend. Der Unterschied liegt also darin, wie wir die Erzeugnisse sehen. Und da wir bei mehr oder weniger iden- tischen Erzeugnissen oft keine rationalen Unterschcidungs- maßstäbe ansetzen können, werden wir in unserer Entschei- dungsfindung auf irrationale Weise unterstützt. Die Hersteller versprechen uns in ihrer Werbung, dass wir uns irgendwie bes- ser fühlen werden, wenn wir ihr Produkt gekauft haben. Letz- ten Endes ist dies die Funktion der Marke.
- - 1 0 5 Tage
- Die British Association for Counselling and Psychotherapy hat mich mit Carol in Kontakt gebracht. Carol ist eine Therapeu- tin, die es gewohnt ist, dass in den Aledien über ihre Fälle be- richtet wird (ich hatte erzählt, dass die Sitzungen in einem Buch erscheinen werden). Sie hat bei verschiedenen Nachmit- tags talkshows mitgearbeitet, und in den Tigen vor unserem ersten Termin treibt mich die Sorge um, ob ich nicht einzig die Zeit dieser Dame verschwenden -werde. Ich bin in einer festen
- 99
- Beziehung, ich habe Freunde, meine Eltern sind glücklich ver- heiratet, ich bin nicht reich, aber ich habe ein gutes Auskom- men, gut genug, um eine Sammlung von Marken der mittleren bis oberen Preisklasse zu unterhalten. Was genau sind eigent- lich meine Beschwerden? Mein Problem wird sich anhören wie eine narzisstische Nabelschau, da bin ich mir sicher. Carol ist eine warmherzige, selbstbewusste Frau mittleren Alters, sie trägt Converse, Hosen von Gap und ein Top, bei dem ich vermute, dass es von Next oder Warehouse stammt. Sie ist ein Typ, bei dem ich sagen würde: Mit Würde alt werden und doch ein Auge daraufhaben, was bei den jungen Leuten .so in ist. Als wir uns treffen, hat sie meinen Blog gelesen und weiß von meiner selbstdiagnostizierten Sucht und dem bevorstehen- den Feuer. Wir beginnen Ereignisse der Vergangenheit aufzuspüren, die einen Einfluss auf die gut dreißig Jahre meines Lebens hal- ten: wegen Faulheit vom Gymnasium geflogen, in Nachtclubs gearbeitet statt auf die Universität zu gehen, beim Journalis- mus gelandet, in fester Beziehung lebend (obwohl ich wünschte, ich hätte vorher mehr One-Night-Stands gehabt). »Lassen Sie uns über Ihren Zwang reden, Dinge zu verbren- nen«, sagt Carol. »Haben Sie im Lauf Ihres Lebens schon viele Sachen verfeuert?« »Nun ja, auf dem Cover einer Zeitschrift, die ich herausgab, verbrannten wir einmal ein Bild von Posh Spiee; das sollte dazu aufrufen, mit der Celebrity-Kultur Schluss zu inadien. Als Teenager warf ich alle Kuscheltiere und Valenlinskarien mei- ner Freundinnen ins Feuer, nachdem wir uns gel mini hallen. Sonst eigentlich nichts Destruktives. Meine Freunde und ich saßen am Wochenende oft auf irgendeinem brachliegenden in dustriegelände um ein Lagerfeuer herum, um liier zu h inken und Zigaretten zu rauchen, bevor wir all genug waren, in Pubs zugehen. Die Flammen faszinierten mich, ich konnte stunden- lang hineinstarren.« »Interessant. Ich frage mich, woher dieser aktuelle Drang herkommt, alle Ihre Sachen zu verbrennen. lassen Sic uns einst- weilen weitermachen, ich möchte gern mehr über Ihren fami-
- 100
- liären Hintergrund wissen. Erzählen Sie mir von Ihrem Vater, was macht er beruflich?« »Er entwickelt Feuermelder.« Die Unterhaltung setzt aus. Das ist für uns beide eine Offen- barung. »Die Zeit ist um für heute, Neil. Wir sehen uns nächste Wo- che.«
- - 9 8 Tage
- Ich verbringe den Rest der Woche damit, in der Wohnung he- rumzuschleichen und eine Liste meiner Markenbesitztümer zu machen, die verbrannt werden sollen. Dabei gehen mir Dinge durch den Kopf, die Carol zur Sprache gebracht hat. Warum konzentrieren sich Therapien immer auf die Beziehung zu un- seren Eltern? Es hat doch sicherlich niemand eine perfekte Kindheit gehabt, aber bedeutet das denn automatisch, dass wir alle von psychischen Problemen geplagt werden? Wahrschein- lich ist es eine normale Reaktion, dass Patienten diese Theo- rien von sich weisen, wenn sie schmerzhafte Wahrheiten ans Licht befördern. Trotzdem haben meine Eltern immer gut für mich gesorgt, nie haben sie mich misshandelt. Ich habe wenig Grund zur Klage, abgesehen von ihrer Weigerung, mir ständig neue Adidas-Turnschuhe zu kaufen. Der Brückenschlag vom Beruf meines Vaters zu meinem Scheiterhaufen erscheint mir ein wenig zu simpel. Habe ich wirklich das Bedürfnis, ein Feuer zu entzünden, das mein Vater nicht löschen kann? Es ist wirklich eine elende Beschäftigung, ein Verzeichnis mit meinen gesamten wunderbaren Markenobjekten zu erstel- len, auf die das Feuer wartet. Ich fi nde ungetragene Kleidungs- stücke, noch original verpackt, hinter Möbel gestopft. Nie- mand außer mir weiß, dass ich diese Dinge besitze, ich könnte sie mit Leichtigkeit verstecken, um sie in einer neuen, unbe- schwerten Markenzukunft zu tragen, wenn dieses verrückte
- 101
- Projekt hinter mir liegt. Doch was wäre der Sinn? Wenn The- rapie und Feuer das erreichen, was ich mir von ihnen erhoffe, dann wird es mir nicht mehr wichtig sein, woher meine Klei- der kommen. Jedenfalls nicht mehr so sehr.
- MARKENARTIKEL, DIE V E R B R A N N T W E R D E N SOLLEN
- KLEIDUNG
- 102
- 103
- 104
- 105
- - 9 6 Tage
- Ursprünglich kaufte ich die Marken auf meiner »Verbrennungs- liste«, weil ich dachte, sie seien die besten für mich. Doch wie genau kam ich zu der Uberzeugung, dass dies meine Labels sind? Ich frage mich, ob mein Leben irgendwie besser oder schlechter verlaufen wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte? Zufallig fiel mir eine Studie des amerikanischen Baylor Uni- versity Medical Center in die Hände, in der es um genau die- sen Aspekt geht. 14 Als Studenten gebeten wurden, zwei nicht etikettierte Cola-
- 106
- Getränke zu probieren (es handelte sich um Coca-Cola und Pepsi), waren die Präferenzen etwa gleich verteilt. War eine der Proben als Coca-Cola gekennzeichnet und die andere nicht eti- kettiert (beide enthielten Coca-Cola), gab es eine starke Präfe- renz für die Coca-Cola mit dem Aufkleber, gab man in demsel- ben Versuch der einen von beiden Coca-Cola-Proben allerdings ein Pepsi-Label, war keine ausgeprägte Präferenz festzustellen. Markenwerbung hat einen direkten physiologischen Effekt auf unser Gehirn und seine Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Wenn wir aus einer Dose trinken, die eindeutig als Coca-Cola gekennzeichnet ist, dann reagiert unser Gehirn nicht nur auf den Geschmack des Getränks, sondern auch auf die Assoziatio- nen, die wir mit der Marke verbinden. Eine Marke ist eine Vielzahl von Wahrnehmungen im Ge- hirn des Verbrauchers. Diese übermitteln uns Botschaften, die positive Eigenschaften mit dem Produkt verbinden. Durch wiederholten Kontakt mit Werbung und Marketing speichern wir diese Assoziationen, deren Gesamtheit sich in unserer Per- zcption zum Marken im age verbindet. Schließlich bilden wir uns eine Meinung, indem wir diesen Sinneseindruck der Marke mit unseren Wünschen, Bedürfnissen und Hoffnungen in Bezie- hung setzen. Wenn wir in einem Geschäft stehen und die konkurrieren- den Produkte miteinander vergleichen, dann helfen unsere Wahrnehmungen der verschiedenen Brands uns bei der Ent- scheidungsfindung. Deren Grundlage ist das Versprechen, das die Marke uns gibt. Wenn wir daran glauben, dann wird das Erzeugnis wertvoll für uns. Stellen Sie sich eine Bierflasche mit einem Carlsberg-Logo auf dem Etikett vor. Die Flasche enthält ganz offensichtlich Bier, und wir haben schon fast den Geschmack auf der Zunge, bevor sie auch nur geöffnet ist. Doch stellen Sie sich vor, die gleiche Pia sehe hätte einen Paracetamol-Aulkleber. Wie genau würde das wohl schmecken? Jetzt stellen Sie sich eine Packung Tabletten vor-mit dem Carls berg-Logo darauf. Haben wir jetzt noch eine Vorstellung davon, was die Pillen mit uns machen werden, wenn wir sie einnehmen? Irgendwann kommen wir an
- 107
- einen Punkt, an dem wir die Versprechen einer Marke fraglos akzeptieren. Die Bedeutung einer Marke kann so in uns über- gehen, dass wir die Wirkung des Produkts spüren, bevor wir es benutzen.
- MARKENVERSPRECHEN Herkunftsversprechen: Das Produkt ist authentisch. Leistungsversprechen: Das Produkt ist zuverlässig und wird tun, was man von ihm erwartet, ohne Schaden anzurichten oder Peinlichkeiten zu verursachen. Bestätigungsversprechen: Die Verwendung des Produkts wird unser Selbstbewusstsein steigern. Verwandlungsversprechen: Die Erfahrung wird unser Leben zum Besseren verändern.
- Sämtliche Elemente des Branding sind darauf ausgerichtet, po- sitive Botschaften über das Produkt zu kommunizieren. Das Verpackungsdesign, der Tonfall der Werbung, das Umfeld, in dem wir sie erleben - all diese Dinge kommunizieren Bedeu- tungsaspekte, die nach und nach unsere Meinung und unsere Gefühle diesem Erzeugnis gegenüber prägen. Diese Botschaf- ten umgeben uns, sie sind in fast allen Aspekten unseres Lebens präsent, und das ist auch der Grund, warum wir bei Bedarf jederzeit Informationen abrufen oder eine Aleinung äußern können, selbst für viele Marken, die wir gar nicht konsumieren wollen.
- - 9 3 Tage
- A u d i i n m e i n e r z w e i t e n S i t z u n g mit ( larol l ä u t e n d i e A l a r m - g l o c k e n , als w i r v o l l e z e h n M i n n l c i i d a m i t z u b r i n g e n , ü b e r d i e roten Diadora B e i n k l e i d e r z u s p r e c h e n , i n d e n e n ich g e k o m - m e n bin.
- IOH
- »Neil, was wollen Sie mir damit sagen, dass Sie diese Hose tragen?« »Ah, keine Ahnung, wie meinen Sie das?« »Sie gefällt mir wirklich gut, sie hat so ein lebhaftes, leuch- tendes R o t . . . Sie müssen guter Laune gewesen sein, als Sie sich heute Morgen dafür entschieden haben.« Ich gewinne den Eindruck, dass das hier alles ein bisschen gaga ist. Ich bin nicht hier erschienen, um über meine Hose zu diskutieren. Wäre ich in Lederchaps oder in einem strassbe- setzten Gymnastiktrikot aufgekreuzt - ja, das wäre ein Ge- sprächsthema gewesen. Carol spürt mein Unbehagen. »Fällt es Ihnen schwer, von anderen Menschen Komplimente anzunehmen, Neil?« »Das könnte man sagen.« »Komisch ... Sie investieren so viel, um Ihr öffentliches Er- scheinungsbild bis ins kleinste Detail zu durchdenken, und doch ist es Ihnen unangenehm, wenn Sie für das Resultat Ihrer Anstrengungen gelobt werden.« Sie hat recht. Obwohl ich Unmengen von Zeit und Geld auf- wende, um sicherzugehen, dass mein Image so perfekt wie nur möglich ist, neige ich dazu, Komplimente mit einer wegwer- fenden Bemerkung abzutun oder allenfalls mit einem verlege- nen Erröten anzunehmen. Solche Situationen sind mir immer peinlich. »Hat Ihr Vater Sie jemals gelobt, als Sie jünger waren?« »Ich bin sicher, dass er das hin und wieder getan hat, aber ich kann mich an ihn nur als kritisch erinnern. Ich war in der Schule ein Versager, weil ich faul war, außerdem fiel es mir schwer, mich im Unterricht zu konzentrieren. Ich schloss mich den fal- schen Gruppen an, weshalb ich prompt in der untersten Leis- tungsgruppe landete, sehr zur Enttäuschung meiner Eltern, und ganz besonders meines Vaters. Doch unglücklicherweise, je mehr Druck er mir machte, meine Leistungen zu verbessern, desto mehr wies ich ihn zurück.« »Vielleicht wissen Sie nicht, wrie man Komplimente an- nimmt, weil es Ihnen nie beigebracht wurde, Neil?«
- 109
- - 9 1 Tage
- Marken. Überall. Auf meinen Lebensmitteleinkäufen, auf mei- ner Kleidung, auf meinem Computer, auf meinem Handy. Es gibt kein Entkommen. Jeden Tag entdecke ich neue Dinge, die ich auf die Scheiterhaufen-Liste setzen muss - und jeden Tag frage ich mich, wie ich ohne sie leben soll. Vergessen wir ein- mal die emotionale Abhängigkeit, was ist mit der praktischen Seite? Soll ich wirklich meinen Vertrag bei Orange kündigen und mein BlackBerry in die Mülltonne werfen? Wieder Tele- fonzellen benutzen? Vielleicht werde ich einfach wieder Briefe schreiben: Mein lieber Freund, hast Du Lust, morgen im Pub mit mir einen trinken zu gehen ? Bitte schreib so bald wie möglich zurück und lass es mich wissen. Mit freundlichen Grüßen, Neil. Kreditkarten und Bankkarten gehören zu den mächtigsten Marken der Welt: Soll ich meine Visa Card zerschneiden? Im Moment sehe ich keine Alternative. U n d was das Rauchen an- geht: Sollte ich nicht eine Plantage in Südamerika pachten, dort meinen eigenen Tabak ernten und ihn nach England ein- fliegen lassen, dann wäre der Zeitpunkt jetzt günstig, damit aufzuhören.
- - 9 0 Tage
- Vielleicht wird die Sache leichter, wenn ich es aufgebe, auf diese ganzen Markenbotschaften zu achten. Ich nehme mir fest vor, von jetzt an sämdiche Werbung zu ignorieren - so gut das eben geht in einer Stadt, die mit Anzeigenkampagnen zugepflastert ist. Während der Werbepausen im Fernsehen werde ich den Ton abdrehen oder aufstehen und mir eine Tasse Tee zuberei- ten. Fürs Radiohören dürfte die werbefreie B B C die beste O p - tion sein. In den kommerziellen Printmedien ist die Grenze zwischen
- 110
- Werbung und redaktionellem Inhalt nicht sehr klar definiert. Ich habe in diesem Bereich gearbeitet und weiß, dass eine Zeit- schrift oftmals zur Hälfte aus bezahlten Anzeigen besteht, wäh- rend der Rest nicht selten von jemandem beeinflusst wurde, der etwas zu verkaufen hat. Korruption ist im Ma gazin journa- lismus schwer zu definieren, weil das Annehmen von »Geschen- ken« als Gegenleistung für positive Berichterstattung gang und gäbe ist. Die Unternehmen verlassen sich darauf, dass ihre Pro- dukte auch im redaktionellen Inhalt vorkommen, wenn sie Anzeigen schalten. Weigert sich der Herausgeber, drohen die Markenfirmen mit dem Stornieren dieser, und das will niemand. In Wirklichkeit sind die meisten Journale, die als Lifestyle- Magazine in Erscheinung treten, nichts anderes als Shopping- Kataloge. Das heißt: Nach dem Feuer gibt es keine Zeitschrif- ten mehr für mich. Normalerweise ist eine von Juliets und meinen Lieblingsbe- schäftigungen am Sonntag, alle Wochenendausgaben der über- regionalen Zeitungen zu kaufen, im Wohnzimmer die Füße hochzulegen und uns durch diese zu lesen. Dieses Ritual ist im- mer von leichten Schuldgefühlen begleitet, weil wir uns nor- malerweise zuerst auf die beiliegenden Hochglanzhefte stür- zen: Mode wird favorisiert, dann Kultur, schließlich ein Blick auf die Klatschseiten, gefolgt von Reisen und Lifestyle - und erst zum Schluss (wenn überhaupt) widmen wir uns den eigentlichen Nachrichten. Doch ab sofort werde ich in den Zeitungen nur noch diese lesen und auf die Wochenendbeilagen verzichten.
- - 8 8 Tage
- Sonntag. Zeitungstag. Juliet sitzt zufrieden im Sessel und blät- tert in den Lifestyle-Beilagen herum. Ich dagegen kämpfe mich durch die Nachrufe und Todesanzeigen. Der Drang, ein Hoch- glanzmagazin in die Hand zu nehmen, ist fast überwältigend. »Die sexysten Sonnenbrillen des Sommers«, »Hausrenovie-
- 111
- rung für Alinimalisten«, »Die zehn besten iPod-Accessoires« - grelle Uberschriften, die an meiner ohnehin ziemlich schwa- chen Verfassung zerren. Nein, sage ich zu mir, sie sind böse. Ich wrerde mich nur noch schlechter fühlen, wenn ich sie gele- sen habe, das ist immer so. Die schönen Bilder und die uner- füllbaren Hoffungen, die sie mir aufzeigen, geben vor, einen Einblick in die magische Welt von Vollkommenheit und Gla- mour zu gewähren. In Wirklichkeit aber ist man hinterher nur noch deprimierter über sein eigenes Schicksal. Ich habe beob- achtet, wie Juliet eine Ausgabe der Vogue durchblätterte und dabei zusehends unzufriedener mit ihrer eigenen Garderobe, ihrem Gewicht und ihrem Lebensstil wurde. Warum tun wir uns das an? Irgendwie hat man uns weisgemacht, es sei wichtig, sich Dinge anzusehen, die uns daran erinnern, wäe unvollkom- men wir sind. Und wir bezahlen auch noch Geld dafür! Hin und wieder raschle ich demonstrativ mit den Zeitungs- seiten, um Juliet daran zu erinnern, dass ich DIE NACHRICH- T E N lese und nicht irgendwelchen Konsumkäse, aber sie ignoriert mich. Schließlich habe ich die Nase voll. »Wenn uns die Angst vorm Scheitern verfolgt, dann deshalb, weil die Welt offenbar in unserem Erfolg den einzig verlässli- chen Anreiz sieht, uns ihre Gunst zu erweisen!« »Was?«, fragt Juliet und blickt von der Sty/f-Beilage der Stnidny Times auf. »Alain de Botton, StatusAngst. Solltest du vielleicht auch mal drüber nachdenken.« Juliet starrt mich einige Sekunden mit ausdruckslosem Blick an. »Du bist bloß neidisch. Lies wreiter deine 'Ibdesanzeigcn.«
- - 8 7 Tage
- W i e d e r T h e r a p i e s i t z u n g . W a r u m bin ich s o v e r z w e i f e l t d a r u m b e m ü h t , M e n s c h e n mit diesen M a r k e n zu beeindrucken, wenn e s m i r d o c h s c h w e r füllt, K o m p l i m e n t e a n z u n e h m e n ? W a s
- kümmert es mich, was andere Menschen, zumal völlig Fremde, von mir denken? Möglicher Grund: Ich entsinne mich, dass die hübschen Mädchen in der Schule mir nie viel Aufmerksamkeit schenkten. Eine Episode der Zurückweisung auf dem Schulhof ist mir aus der Grundschulzeit deutlich in Erinnerung geblie- ben: Ein Mädchen namens Hannah mit perfekten langen blon- den Haaren (so etwas nannte man damals Ti motei-Mädchen) weigerte sich, als wir Kuss-Fangen spielten, standhaft, mich zu küssen - mit der Begründung, ich sei zu hässlich. Auf dem Schul- hot war man entweder hässlich oder schön (die Vorstellung von attraktiver Hässlichkeit gab es noch nicht), und dieser Moment zementierte damals mein Selbstbild: Ich war von Natur aus unattraktiv, die hübschen Mädchen würden nie ein Auge auf mich werfen, das Beste, was ich im Leben tun konnte, war, statt- dessen in anderen Bereichen Pluspunkte zu sammeln. Und da- mit kommen dann die Marken ins Spiel. »Ich glaube, dass Konformität ein großes Thema für Sie ist, Neil«, sagt Carol. »Wirklich? Ich habe mich immer für eine Art Rebell gehal- ten.« »Nein. Während Ihrer gesamten Kindheit wurde Ihnen bei- gebracht, dass Sie der Erwartung anderer Menschen entspre- chen müssen, um akzeptiert und geliebt zu werden. Als Erwach- sener kommen Sie nun diesen Fremderwartungen zuvor, indem Sie sich mit den ganzen Statussymbolen umgeben. Ich glaube, ein Teil Ihrer Beziehung zu Marken rührt daher, dass Sie un- erreichbare Erwartungen auf sich projizieren.« Sie hat recht. Hätte mich jemand gefragt, ob es mir wichtig ist, was meine Mitmenschen über mich denken, wäre meine spontane Antwort ein Nein gewesen. Ich lebe mein Leben nach meinen eigenen Regeln, und die anderen sollen zum Teufel ge- hen. Doch in Wirklichkeit werde ich vollständig von meiner Statusangst und der Suche nach Anerkennung gesteuert. Meine Schuhe sind vielleicht ein wenig spezieller als die des Durch- schnittsbürgers, mein Handy ist wahrscheinlich teurer als die meisten anderen, doch das heißt nicht, dass ich wirklich selbst- bewusster oder glücklicher bin. Im Gegenteil: Gerade der Ver-
- 113
- gleich mit dem Durchschnittsmenschen mit langweiligen Schuhen und einem banalen Handy zeigt, dass ich die bedürf- tigere Person bin. Ihm ist es offensichtlich ziemlich egal, ob er akzeptiert oder bewundert oder geliebt wird, sonst würde er sich mehr anstrengen, sowie ich.
- - 8 6 Tage
- Während meiner Zeit als Zeitschriftenherausgeber arbeitete ich oft mit Markenfirmen zusammen, die unsere Partys und Events sponserten. Einige der Projekte, die ich ins Leben rief, hätten ohne diese finanzielle Unterstützung nicht stattgefun- den. in dieser Hinsicht könnte man sagen, dass Markenunter- nehmen, die Geld für Aktionen spenden, die ansonsten finan- ziell nicht durchführbar wären, unsere Kultur bereichern. Evian rettete einmal ein öffentliches Freibad in Südlondon vor der Schließung. Microsoft Xbox zahlte einen Skaterpark für Kinder aus sozial schwachen Familien. Die Mehrzahl der Kunst- ausstellungen und Musikfestivals würde ohne Markenpartner nicht zustande kommen. Doch nach meiner Erfahrung entwi- ckelten sich diese Absprachen oft zu einem Tanz mit dem Teu- fel. Bei den ersten Verhandlungen stimmen die Brandmanager normalerweise zu, ihre Beteiligung unauffällig und belov) the line zu halten. Rückt dann der Termin der Veröffentlichung nä- her, dann muss die vorher abgesprochene Subtilität riesigen Logos weichen, und jeder Inhalt wird dadurch verfälscht, dass er zuerst von allen Hierarchieebenen des Managements abge- segnet werden muss. Oft genug verlangt die Sponsorenmarke, mehr oder weniger das gesamte Verfahren zu kontrollieren. Heute las ich in der Zeitung, dass die Sponsoren der Fußball- weltmeisterschaft in Deutschland viele bizarre Forderungen stellen. Budweiser, die offizielle Biermarke der Veranstaltung, hat verlangt, dass tausend holländische Fans ihre Hosen aus- ziehen, bevor sie ins Stadium dürfen. Die beanstandeten oran-
- 114
- gefarbenen Hosen (die Farbe der Nationalmannschaft) waren Werbegeschenke der Konkurrenzmarke Bavaria, die der FIFA keine Sponsorengelder gezahlt hatte. Und so mussten sich die Fans Hollands 2 : 1-Sieg in der Unterhose anschauen. Die deutschen Fans haben sich vielfach über die FIFA be- schwert, die in den Stadien den Ausschank einheimischer Bier- markenverboten hat und die Fans zwingt, ausschließlich Bud- weiser zu trinken. Im heutigen Guardian stand: »Die scheinbar unbegrenzte Macht, die die Sponsoren mittlerweile bei globa- len Sportereignissen ausüben können, steht außer Frage.«1:1
- - 8 5 Tage
- Es ist faszinierend zu lesen, was den Marken unternehmen al- les einfällt, um an die Sinne zu appellieren. Da ein großer Teil unserer Kommunikation instinktiv abläuft, wissen wahrschein- lich noch nicht einmal die Brandmanager selbst, welche Sig- nale sie aussenden. Zwischenmenschliche Kommunikation ist zu 55 bis 95 Prozent nonverbal. Im Verlauf einer Unterhaltung reagieren wir eher auf Gesten, Tonfall, physische Erscheinung und Kontext als auf das, wras gesagt wrird, obwohl wir uns des- sen die meiste Zeit gar nicht bewusst sind. Im Zweifelsfall ist es wahrscheinlicher, dass wir glauben, was wir sehen, als das, was uns gesagt wird. Marken kommunizieren ziemlich genau auf die gleiche Weise. Die Logos, Symbole, Schrifttypen und Farben, die sich zur Identität einer Marke verbinden, lösen eine Reihe von Emo- tionen aus, die die Brands begehrensw ert erscheinen lassen. Als Konsumenten sind wir Gewohnheitstiere. Wenn wir vor der Wahl stehen, dann entscheiden wir uns zuerst für die Marke, die wir am besten kennen. Auch wenn wir ein Produkt zum ers- ten Mal ausprobieren, greifen wir oft unwillkürlich zu einer vertrauten Marke, die dieses anbietet, weil wir Bekanntheit mit Beliebtheit gleichsetzen. Wenn eine Marke populär ist, dann
- muss sie auch gut sein. Dieser Effekt heißt im Marketing Con- tagioits De///and - ansteckende Nachfrage. Die Farben, derer sich die Marken bedienen, haben spezifi- sche physikalische und psychologische Eigenschaften, die wir auf das Produkt übertragen. Rot steht für Männlichkeit und Aufregung, es kann auch als freundlich empfunden werden. Rot zieht am schnellsten unsere Aufmerksamkeit auf sich, es lässt unseren Puls schneller schlagen und die Zeit scheinbar rascher vergehen. Grün steht für Harmonie, Gleichgewicht und Fri- sche. Anders als bei Rot muss sich das Auge nicht anpassen, um Grün zu sehen, deswegen empfinden wir es als ruhig und be- ruhigend. Blau stimuliert klare Gedanken und wirkt vertrau- enswürdig. Gelb dagegen ist optimistisch, extrovertiert und kreativ. Neben Logo und Farbe bringt der Name der Marke das Pro- dukt und seine Werte auf den Punkt. Um den Wiedererken- nungswert, den Brand Recall, zu verstärken, ist er normalerweise kurz, aussagekräftig und leicht auszusprechen. Studien zeigen, dass wir Marken mit angenehm klingenden Namen positive Gefühle entgegenbringen. Namen, die mit harten Verschluss- lauten wie B, D oder K beginnen, kommen schnell aus dem Mund und werden mit praktischen Erzeugnissen assoziiert (Black & Decker, Dewalt, Bostick). Weichere Zischlaute wie S oder C wecken romantische oder heitere Vorstellungen und passen deshalb gut zu Luxusprodukten (Chanel, Swarovski, Cacharel). Eine berühmte Anekdote erzählt, wie der französische ln- dustriedesigner Raymond Loewy in den Fünfziger jähren auf einer Dinnerparty von einer Frau gefragt wurde, warum er ein doppeltes X verwendete, als er das Markenzeichen für Exxon entwarf. »Warum fragen Sie?«, erkundigte er sich bei der Frau. »Weil es mir einfach aufgefallen ist«, antwortete sie. »Nun«, entgegnete Loewy, »das ist die Antwort.« Marken arbeiten oft mit der Wiederholung von Konsonanten (Coca-Cola) oder Vokalen (AA) oder mit Worten, die das Produkt lautmalerisch umschreiben (Schwcppes). Zunehmend greifen die Unterneh- men auch auf einfache Wörter aus dem Lexikon zurück, die im
- 116
- Gehirn bekannte Bilder hervorrufen - wenn wir eine Werbung für, Apple sehen, dann haben wir schon fertige Assoziationen zu diesem Wort und sind deshalb leichter in der Lage, uns daran zu erinnern. Und wenn wir mit der Marke vertrauter werden, dann verbinden wir diese mit dem Produkt, das sich dieses Wort zum Labelnainen erkoren hat. Während einfache Nutz- artikelmarken oftmals mit ihrem Namen nur ihre Funktion be- schreiben (Blu-Tac, Pritt-Stiit), sind Bezeichnungen mit mehr- deutigen Assoziationen auch in der Lage, große Ideen und Erwartungen zu wecken. Traditionellerweise haben Markenlogos den Namen des Un- ternehmens auf allen Produkten in einer einheitlichen Schrift dargestellt - wie bei KitKat oder Coca-Cola oft zusammen mit einer Figur oder einem Maskottchen (Alichelin-Männchen, Jolly Green Giant). Heutzutage ist es allerdings weitverbrei- tet, ein abstraktes Logo zu haben - wie den Stvoos/j von Nike oder den Mercedes-Stern. Grundsätzlich kann man sagen, dass lineare Logos und Schriften eher praktisch und verlässlich wir- ken, während geschwungene Logos Anpassungsfähigkeit und Kreativität signalisieren. Das moderne Markenlogo steht als optisches Kürzel für eine Reihe von Assoziationen und Metaphern, für Identität, Emo- tion und Wert. Sein Vorhandensein auf einem Produkt be- gründet oft einen höheren Preis, der den materiellen Wert die- ses Er Zeugnisses übersteigt.
- 84 Tage
- ein neues Magazin ist auf den Markt gekommen, das als einzi- ges Thema Shopping hat. Die fünfzig besten Wintermäntel. die einkaulsgewohnheiten der Stars. Jessica Simpson - Stil mit kleinen) Ihidget. Zweihundert Seiten von diesem Zeug. das Magazin heißt HAPPY, Jetzt wird mir alles klar. Früher wiiirn Zeiisclmlicn und Anzeigen einmal meine entschciden-
- 117
- den Hilfsmittel, um mit dem Zeitgeist Schritt zu halten, doch nun sehe ich sie als das Teufelszeug, das sie wirklich sind. Vorsicht, ich darf nicht übertreiben.
- - 8 3 Tage
- Als ich gestern im Kino saß und auf den Beginn des Films war- tete, sah ich eine Werbung für Lynx. Ein Mann besprüht sich mit Deo, und Minuten später wird er von wunderschönen Frauen umschwärmt, die magnetisch von ihm angezogen wer- den. Die Botschaft lautet, wenn man es wördich nimmt: »Frauen finden dich unwiderstehlich, wenn du dieses Deodorant kaufst.« Das letzte Mal, als ich Lynx benutzte, fiel mir keine Steigerung meiner Anziehungskraft auf. Es kann natürlich sein, dass die Frauen sich alle verstellten. Sicher glaubt kein Mann im Kino ernstlich an das Versprechen, das dieser Werbespot macht, oder? Trotzdem muss diese Werbung funktionieren. Sonst würde das Unternehmen nicht das Geld für einen solchen Clip ausgeben. Eine kurze Suche im Internet zeigt, dass Lynx in der Tat die meistverkaufte Deomarke der Welt ist. Auf einer un- terbewussten Kberie funktioniert die Markenwerbung, obwohl das Produkt das gegebene Versprechen nicht einlöst. Die Werbung ist so ansprechend und unterhaltsam gewor- den, dass wir manchmal ganz vergessen, dass ihre Funktion ist, uns etwas zu verkaufen. Wir betrachten diese Spots als Unter- haltung - deshalb war gestern auch das Kino schon zwanzig Minuten vor dem Beginn des Films voll besetzt. Werbefilme sind zu einem Teil des Kinoerlebnisses geworden. Ich kenne sehr wenige Leute, die zugeben mir den, dass sie sich von Wer- bung beeinflussen oder manipulieren lassen - aber mich be- schleicht langsam der Verdacht, dass das genau der Eindruck ist, den die Markenhersteller uns vermitteln wollen. Wir stehen der Werbung ziemlich locker gegenüber, weil wir glauben, dass wir viel zu gerissen und zu rational sind, um uns von solchen
- 118
- übertriebenen Beteuerungen einwickeln zu lassen. Tatsächlich aber sind wir Verbraucher viel weniger rational, als wir selbst glauben. Wie der kanadische Medientheoretiker Marshall McLuhan einmal feststellte: »Werbung ist nicht für die be- wusste Aufnahme gedacht. Sie soll als unterschwellige Pille auf das Unterbewusstsein wirken.«16 Wie viele Menschen rennen sofort los, um ihre Ziele zu ver- wirklichen, wenn sie eine Nike-Werbung sehen? Kaum wel- che. Wie viele aber wünschen sich heimlich, sie wären Serena Williams oder Wayne Rooney? Jede Menge. Wir alle träumen davon - im Lotto gewinnen und reich, bei Pop Idol berühmt werden, Brad Pitt treffen und sich wahnsinnig verlieben. Die Emotionen, die mit einer Marke einhergehen, erhöhen den Moment, in dem wir das Produkt benutzen, zu etwas Besonde- rem. Auf emotionaler Ebene funktioniert das Produkt viel bes- ser, wenn es eine bekannte Marke trägt. Der englische Label- experte Paul Feldwick glaubt, dass die Transformationskräfte der Marke einen echten Zusatzwert darstellen:
- Es wird oft behauptet, der höhere Preis »für den Namen« sei eine törichte Wahnvorstellung des Kunden, eigentlich nichts als eine Hochstapelei des Verkäufers. Doch der Nutzwert für den Kunden ist eine reale Steigerung seiner Konsumerfah- rung, sei es in der Form von Seelenruhe oder als Fantasieer- lebnis.17
- Mit einem Mercedes kauft man sich nicht nur ein qualitativ hochwertiges deutsches Auto, man kauft Selbstvertrauen, Glanz und Kultiviertheit. Die Emotionen, die wir erwarten, wenn wir ein Produkt benutzen - und damit auch der Wert von diesem -, werden durch die Marke deutlich gesteigert. Das Branding will, dass wir Leidenschaft, Erregung und Glücksgefühle verspüren, dass wir mit uns selbst glücklich sind. Ein Werbespot im Fern- sehen bringt uns zum Lachen, und wir erinnern uns später an das positive Gefühl, wenn wir die Marke irgendwo sehen. Auf einer Plakatwand leckt eine wunderschöne Frau mit mehr als deutlichen sexuellen Unter tönen ein exklusives Eis am Stiel,
- 119
- und wir assoziieren die Eissorte daraufhin mit sinnlichem Lu- xus. Eine Rummarke tritt als Sponsor eines Musikfestivals auf, war assoziieren die Alarke mit Genuss und Lebensfreude. Diese Markenpolitik mag den Herstellern dabei helfen, mehr von ihren Erzeugnissen abzusetzen, aber das geht zwei- fellos auf die emotionalen Kosten des Verbrauchers. Eiscreme essen fühlt sich durchaus nicht wie ein sexueller Akt an. Ein Schluck Rum ist kein Garant für sofortige Euphorie. Von die- sen übertriebenen Versprechungen ständig enttäuscht zu wer- den kann nicht ohne Auswirkungen auf unser Wohlbefinden bleiben.
- - 8 2 Tage
- Wann war das letzte Mal, dass ein realer Mensch mir das Ge- fühl vermittelte, glamourös zu sein? Oder zu mir sagte, dass ich abenteuerfreudig, intelligent oder erfolgreich sei? Außerhalb meiner engsten Beziehungen zu Juliet und meiner unmittelba- ren Familie kann ich mich kaum an Gelegenheiten erinnern, bei denen ich ein Kompliment bekam, das mir ein gutes (ie- fiihl und Selbstbewusstsein gab. A'Iarken tun das die ganze Zeit. Sie stärken mein Selbstwertgefühl und geben mir so das Ver- trauen, dass ich ich selbst sein kann - nur noch toller. Sie schei- nen meine geheimsten Wünsche zu kennen, manchmal besser, als es selbst meine engsten Freunde vermögen. Im Jahr 2005 wechselte die Fußballmannschaft des Sh eving- ton Technical College in Wigan ihren Ausrüster und kleidete sich statt mit Trikots eines wenig bekannten örtlichen Fabri- kanten fortan mit Nike ein. Die Eltern waren zuerst verärgert über die hohen Kosten der neuen Trikots, doch die Beschwer- den verstummten, als das Team eine deutliche Leistungsstei- gerung zeigte. Das Selbstvertrauen der Spieler kannte keine Grenzen, gegnerische Mannschaften machten ihnen Kompli- mente über ihre Ausrüstung, und die Fehlquote in den Sport-
- 120
- stunden ging deutlich zurück.18 Nach Erkenntnissen der ame- rikanischen Livingston Market Research Group gibt es vier emotionale Bedürfnisse, die eine Rolle spielen, wenn wir dem Versprechen einer Alarke Glauben schenken:19
- 1. Selbstverwirklichung oder Ich will die Kontrolle haben Unser Selbstwertgefühl wird gestärkt, indem wir uns Ziele setzen und sie erreichen - das erfüllt uns mit Selbstvertrauen. Wir haben das Gefühl, unser Schicksal in der Hand zu haben. Beispiel Microsoft: Where da yon want to go today? (Wohin willst du heute gehen?)
- 2. Liebesgefühle und Romantik oder Ich will, dass die Menschen mich lieben, ich will dazugehören Unser Selbstwertgefühl wird gestärkt, wenn wir von jeman- dem geliebt werden, den wir selbst sehr schätzen. Es ist das Bedürfnis, attraktiv zu sein und liebenswert zu erscheinen. Beispiel Olay: Olay, love the skinyoirre in. (Olay, damit du gern in deiner Haut steckst.)
- 3. Fürsorge und elterliche Gefühle oder Ich will Verant- wortung übernehmen Für Nachwuchs oder Lebenspartner verantwortlich zu sein gibt uns ein gutes Gefühl. Beispiel Scottish Widows: Preparation is eve/ything. (J o?sorge ist alles.)
- 4. Altruismus und gesellschaftliche Anerkennung oder Ich will der Gesellschaft etwas zurückgeben; ich sorge mich um das Wohlergehen anderer Menschen Es ist angenehm, etwas zum allgemeinen Wohl und zum Reichtum der Gesellschaft beizutragen. Beispiel Oxfam: Help ing people to help themselves. (Wir helfen den Menschen, sich seihst zu helfen.)
- Diese emotionalen Trigger kommen mir sehr bekannt vor. Man könnte den Standpunkt vertreten, dass nichts dagegen
- 121
- einzuwenden ist, Produkte zu benutzen, die uns ein gutes Ge- fühl geben. Doch die emotionale Komponente der Marken hat eine heimtückische Kehrseite, die die entsprechenden Hand- bücher zu diesem Thema oft unter den Tisch fallen lassen. Ich meine das Arbeiten mit negativen Empfindungen, um ein Pro- dukt zu verkaufen. Denn natürlich sind Marken genauso gut in der Lage, Gier, Paranoia, Minderwertigkeitsgefühle und Kon- kurrenzdenken anzusprechen.
- 1. Selbstverwirklichung oder Meine Ziele gleiten mir durch die Finger, während alle anderen sie verwirklichen Zuzusehen, wie andere ein besseres Leben führen als wir selbst, löst Neidgefühle und Depressionen aus. Wir befürch- ten, unser Leben nicht im Griff zu haben. Beispiel Moet & Chandon: Be fabulous. (Sei fantastisch.)
- 2.Liebesgefühle und Romantik oder Alle anderen sind jünger/fitter/schöner als ich Wenn wir uns mit den Standardvorstellungen von Schönheit vergleichen, fühlen wir uns minderwertig, ausgeschlossen, einsam und nicht liebenswert. Beispiel Maybelline: Maybe she V born with it - maybe ifs May- belline. (ist es angeboren - oder ist es Maybelline?)
- 3. Fürsorge und elterliche Gefühle oder Ich kann meinen Lieben nicht das geben, was sie sich wünschen Wir sind angespannt und deprimiert, wenn wir den Erwar- tungen anderer nicht gerecht werden, und wir fühlen uns verpflichtet, das zu kompensieren. Beispiel Abbey: Because life is complicated enough. (Weil das Le- ben kompliziert genug ist.)
- 4. Altruismus und gesellschaftliche Anerkennung oder Ich habe nicht genug Verant wortungsgefühl, um die Pro- bleme anderer Menschen /,u lösen Das Leid von Menschen zu sehen, die weniger (»lück haben i -- als wir, gibt uns das C ieliihl, selhslsiiehiig zu sein. Wir fit I
- 122
- len uns verpflichtet, etwas gegen die Schuldgefühle zu tun. Beispiel National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC): Cruelty to children must stop. Füll stop. (Kiiidesmisshandlung muss aufhören. Ohne Wenn und Aber.)
- Welche Art von emotionaler Marken werhung bei mir am bes- ten funktioniert, weiß ich genau: Angst ist die Triebfeder hin- ter einem großen Teil meiner Einkäufe. Es ist eher selten, dass ich Markenartikel erstehe, damit die Leute mich mehr lieben. Meistens erwerbe ich sie für den Fall, dass man mich ohne sie weniger lieben würde.
- - 8 1 Tage
- Ich verbringe einen wundervollen Tag auf dem Land, um dem lauten Treiben des Stadtlcbens einmal zu entfliehen. Keine Geschäfte und keine Plakatwände - die einzigen Logos weit und breit finden sich auf Gummistiefeln der Firma Hunter an den Füßen der Leute, denen ich begegne. In diesem noch un- erschlossenen Gebiet für Labels ist meine Markenneurose überflüssig. Die Menschen hier können auf sinnentleerten Kon- sumwahn verzichten, und sie tun das auch - obwohl ich mir si- cher bin, dass alle ihren Wocheneinkauf im Supermarkt der nächstgrößeren Stadt erledigen. Städter wie ich fahren aufs Land, wenn sie dem Trubel des Großstadtlebens einmal ent- kommen wollen. Doch nur wenige halten es länger als ein Wo- chenende aus. Wir fangen an, das zu vermissen, was wir doch eigentlich hinter uns lassen wollten. Die Stille eines Feldes dröhnt auf ei nmal viel stärker in den Ohren als das Getöse des Verkehrs, der jeden Tag an meinem Schlafzimmerfenster vor- beiströmt. Wenn es nichts gibt, das die Augen und den Ver- stand ablenkt, wenden sich die Gedanken dem »großen Gan- zen« zu, was meist ein unangenehmes Thema ist. Ich brauche die Großstadtumtriebigkeit, um mich abzulen-
- ken, obwohl ich schon immer den Verdacht hatte, dass sie nicht nur gut für mich ist. Das ist wie beim Rauchen: Du weißt, dass es dich langsam umbringt, aber du kannst einfach nicht damit aufhören. Was genau macht diesen Trubel aus? Sicherlich ist es das Gewusel von Menschen, vielen Menschen, die nahe bei- einander leben. Doch nun wird mir klar, dass Werbung und Marken viel zum mentalen Lärm beitragen. Unentwegt fallen mir riesige Plakatwände ins Auge, Neonreklamen blinken um die Wette, um meine Aufmerksamkeit zu erregen. Vom Zeit- punkt meiner Geburt an wurde mein Gehirn ständig durch Hunderte von Bildern und Geräuschen stimuliert, deren Bot- schaften Tag für Tag in meinen Ohren dröhnten. Kalle Lasn, der Gründer der Zeitschrift Abutters, beschreibt diesen Lärm als Toxizität des Geistes. Mr Muscle loves the jobs you hate. Burger King Flame-Grilled Whopper for only - 2.99. Big Brother, tonight at 9 on 4. New Elvive Anti-Breakage Shampoo from VOréal Paris. The KFC Family Feast for only - 9.99, the pel feet way to end your day. Oral-B Pul- sar,; changing the way you brush ... forever. Call 0800 50 50 50for cheaper car insurance "with the AA-team, here to get you a better deal. Download official ringtones with jamster.co.uk. Disney Pixar's Cars in cinemas from July 28th. Get yourself some hatrapy with Sunsilk. Always, keeps you shower fresh all day. Save double in the DFSsiun- mer sale. Big splash lashes and 50 per cent more length and curve with Rimmel London. Get closer to Robbie Williams with the WSOOi Walkman phone. Dentists recommend Sensodyne for sensitive teeth. Birds Eye: fishermen catch the salmon, freezing catches the freshness. 02, see what you can do.20 In einer Großstadt ist es unmöglich, dem grellen Schein der Werbung völlig aus dem Weg zu gehen, das gilt besonders, wenn man in London lebt. Doch seit ich mir im A4ärz vorge- nommen habe, nicht mehr so viele Werbe!)otschaften anzuse- hen und anzuhören, fühlt sich mein Kopf etwas klarer an, der Lärm des Großstadtrummels ist ein oder zwei Stufen leiser ge- worden. Als ich nach London zurückfahre, frage ich mich, ob ich bei meinem nächsten Besuch auf dem Land mehr als ein Wochenende lang durchhalten werde.
- 124
- - 8 0 Tage
- Ich stolpere über ein Zitat des amerikanischen Markenexper- ten David A. Aaker. Es scheint zu belegen, dass meine Uber- zeugung, eine Beziehung zu einer Marke unterhalten zu kön- nen, nicht völlig verrückt ist.
- Einige Menschen werden vielleicht nie eine kompetente Führungspersönlichkeit, doch sie wären gern mit einer sol- chen befreundet, vor allem dann, wenn sie einen Banker oder einen Rechtsanwalt brauchen. Ein vertrauenswürdiger, ver- lässlicher, beständiger Mensch mag langweilig sein, doch er besitzt Alerkmale, die man bei einem Finanzberater oder ei- nem Anwalt zu schätzen weiß - und übrigens auch bei einem Auto.21
- Studien über den Narzissmus haben belegt, dass wir uns in- stinktiv zu anderen Menschen hingezogen fühlen, die die glei- chen Persönlichkeitsmerkmale aufweisen wie wir selbst - oder die wir gern hätten. Die Anziehungskraft von Labels funktio- niert auf eine ähnliche Weise. Wenn wir uns für eine be- stimmte Marke entscheiden, anstatt eine andere vorzuziehen, dann fragen wir: »Wäre dieses Produkt ein Mensch, wie wäre er?« Und noch wächtiger: »Wenn es ein Mensch wäre, würde ich ihn mögen, ihm vertrauen oder ihn bewundern?« Mit die- sen Entscheidungen bestätigen wir unser Selbstwertgefühl und verleihen unserer Persönlichkeit Ausdruck. Der bodenstän- dige, familienorientierte Käufer wird in der Regel Coca-Cola kaufen, während der junge, trendige Konsument nach Pepsi greift. Diese unausgesprochenen Verbraucherwerte sind ent- scheidend für Markenloyalität. Letzten Endes helfen Marken uns, unser Selbstbild zu bestätigen. Produkt + Persönlichkeit = Marke.
- 125
- - 7 9 Tage
- Ich habe vergessen, einen sehr wichtigen Punkt auf meine Do-Liste zu setzen: Ich sollte mit dem Rauchen aufhören. Ich bin Gelegenheitsraucher seit meinem sechzehnten Lebensjahr. Meine erste Marke war Consulate, weil ich glaubte, das Men- thol darin würde den Tabakgeruch überdecken und von mei- nen Eltern nicht bemerkt werden (womit ich mich irrte). Als einstiger vehementer Zigarettenverfechter griff ich in meinen Teenagerjahren zu Marken, die in den Fünfzigerjahren popu- lär gewesen waren, als das Rauchen noch gesellschaftliche Ak- zeptanz genoss - ich ging über zu Dunhill. Schließlich wech- selte ich zu Marlboro, weil alle coolen Leute in London diese Marke zu rauchen schienen. Angesichts der Tätsache, dass der Geschmack eines Essens individuell sehr unterschiedlich wahrgenommen wird, fand ich es schon immer bemerkenswert, dass ganze Bevölkerungsgrup- pen ein und dieselbe Zigarettenmarke bevorzugen. Doch es ist tatsächlich so: Wenn man in irgendeine angesagte Bar in Lon- don geht, dann sind die Zigarettenautomaten normalerweise \ nur mit einer ia l k r e gefüllt: Marlboro Lights. Bei den Rauchern im Südwesten Englands sind Silk Cut und Benson & Hedges die beliebtesten Marken. Im Norden Englands wird der Ziga- rettenmarkt von Embassy und Royais beherrscht. Fragte man alle Raucher in einem Londoner Pub, was ihre Lieblingsmarke bei Chips ist, dann wäre das Ergebnis uneinheitlich - sie hät- ten äußerst unterschiedliche Vorlieben. Dieselben Pub-Besu- cher greifen aber fast ausschließlich zu Marlboro Lights. Of- fenbar hat die Bevorzugung bestimmter Zigarettenmarken nur wenig mit Geschmack zu tun. Zigaretten sind ein derart sym- bolisches Produkt, dass wir die Alarke wählen, die unsere Iden- tität am besten zum Ausdruck bringt. Die Arbeiterklasse in Nordengland raucht Embassy Filters, die Hausfrauen in den Londoner Vorstädten B&H. Marlboro Lights - das ist die Alarke für den Angeber aus dem Süden. Es ist selten, dass ein Raucher seine Markenloyalität aufgibt und zu einer anderen Alarke
- 126
- wechselt. Wenn er es tut, dann zu einer, die von der gleichen so/.ialcn Klasse ak/.eptiert wird. IHW versuchte der amerikanische Gesellschaftstheoretiker I 'horstein Vehlen aufzuzeigen, dass der alltägliche Konsum zu einem Prozess der sozialen Unterscheidung geworden war, wohei er den Begriff des »Geltungskonsums« prägte. Vehlen beobachtete, dass die aufsteigende Klasse vermögender In- dustrieller in Neuengland (Nouveau riebe) begann, in ihrer Klei- dung, Ernährung und in ihrem Benehmen die oberen Gesell- schaftsschichten der Europäer zu imitieren. Zwar blieb innerhalb der rigiden Klassenstrukturen des frühen 20. Jahrhunderts der höhere soziale Status der landbesitzenden Klasse unangetastet, doch die neureichen Fabrikanten versuchten ihre Position zu verbessern, indem sie teure und geschmackvolle Gebrauchsge- genstände kauften und zur Schau stellten. Diese wohlhabende Klasse der Kapitalisten kopierte die Ge- bräuche höherer Klassen, um sich von den Arbeitern und Hand- werkern abzusetzen. Die Aristokratie blickte auf diese neuen Hochstapler mit Verachtung herab. Vehlen sah in diesem Prin- zip der sozialen Nachahmung - die Armen orientieren sich in Geschmacksfragen immer an den Reichen - die Triebkraft hin- ter den ständigen Weiterentwicklungen und dem steigenden Maß des Konsums. Die Spitzen der Gesellschaft verändern beständig ihre Moden, um sich von den niederen Ständen zu distanzieren, Letztere dagegen konsumieren immer mehr, um aufzuholen. Als Hüter des guten Geschmacks behaupten die Reichen ihre Position in der sozialen Hierarchie und schaffen einen Trickle-down-Effekt, weil die niederen Klassen Moden und Symbole der oberen kopieren, die so ihren Weg über die Nouveau riche und die Mittelklasse schließlich bis in die Ar- beiterklasse hineinfinden. Vieles hat sich verändert, seit Vehlen sich über die seidenen Zylinder der Bradford-Millionäre den Kopf zerbrochen hat. Doch diese Hierarchie des Geschmacks beeinflusst auch heute noch verschiedene Schichten der Gesellschaft, nur haben sich in unserer Zeit die Ordnungen verschoben, die Trends werden bewusst gesteuert und ausgerufen, und Kommerz fördert den
- 127
- Prozess nach Kräften, um die Profite zu steigern. Heute wer- den die Moden nur noch von der Industrie und ihren Sprach- rohren gemacht. Materielle Objekte erhalten eine soziale Bedeutung, mit de- ren Hilfe wir uns ausdrücken und miteinander kommunizieren können. Wir wünschen uns Dinge, kaufen sie und stellen sie zur Schau - nicht nur weil diese etwas für uns tun können, son- dern weil sie etwas bedeuten. Unsere Konsumentscheidungen werden zu einem Teil unseres Lebensstils. Und dieser wiede- rum wird zu einem Teil unserer Identität. Selbst ein banales Produkt wie ein Laib Brot sagt etwas über unseren Lifestyle aus. Wer weißes, geschnittenes Mother's Pride kauft anstatt Hovis Granary oder Tesco's Finest Ciabatta, erzählt damit die Geschichte seines sozialen Standes, seiner Erziehung und sei- ner Ziele im Leben. In vielen Fällen gilt: Wir sind, was wir kau- fen. Wer Produkte der günstigen »Spar«-Marke kauft, will oder kann nicht viel Geld für Brot ausgeben, vielleicht mag er auch einfach den Geschmack von billigem Brot, vielleicht ist er da- mit aufgewachsen. Die teurere und gesündere »Beste«-Marke spiegelt die Wahl eines Konsumenten wider, der in der Lage oder willens ist, den vierfachen Preis zu zahlen, der seine lang- fristige Gesundheit in den Mittelpunkt stellt und der gern »et- was Besonderes« schmeckt. Indem wir die »Beste«-Qualität der »Spar«-Qualität vorziehen, erklären wir unsere Zugehö- rigkeit zur Gemeinschaft der gebildeten und informierten Ver- braucher mit vernünftigem und gesundem Lebensstil. Wir es- sen organisches Vollkornbrot, die begnügen sich mit weißem Industriemehl. In den Zeiten, in denen Massenkonsum eine unbekannte Größe darstellte, war unsere Identität durch Familie, Arbeit und persönliche Erfolge definiert. Heute leben die meisten Menschen in dicht besiedelten Urbanen Räumen, arbeiten für unpersönliche Unternehmen und haben das Gefühl, von ano- nymen Organisationen regiert zu werden. Konsum in Hülle und Fülle eröffnet uns eine verwirrende Vielfalt von Wahlmög- lichkeiten, die unser Leben weniger starr erscheinen lassen.
- 128
- Wenn wir von der Masse verschluckt werden, verlieren wir un- sere individuelle Identität und werden eins mit der Menge. I )icse Situation bringt unser Selbstbild ins Wanken und führt y.u einer Persönlichkeitskrise. Mithilfe einer Marke können wir unser Ich wieder selbst bestimmen: Wir werden zu der Person, die eine spezifische Brotsorte bevorzugt. Unser Einkaufszettel legt den Stil unseres Lebens fest.
- - 7 8 Tage
- Ich muss anfangen, ernsthaft über mein Leben nach dem Feu- erprojekt nachzudenken. Zunächst einmal werde ich ein paar Kleidungsstücke brauchen. In der Stadt gibt es einen Vintage- Second-Hand-Laden (»Vintage« bedeutet in diesem Zusam- menhang Oxfam für den zehnfachen Preis), der markenlose Leinenturnschuhe anbietet - die gleichen, die meine Mutter mir früher kaufte, bevor ich selbst über meine Garderobe be- stimmen konnte, und die gleichen, für deren Tragen ich später andere Kinder hänselte. Die Schuhe sind aus einfachem wei- ßem Leinen, sie haben eine dünne Gummisohle und keinerlei Alarkenzeichen oder Logo, nicht einmal auf der Innensohle. Und sie kosten nur 4,99 Pfund. Vorher fand ich nichts dabei, 150 Pfund für ein neues Paar Turnschuhe auszugeben, ob ich es mir leisten konnte oder nicht. Jetzt schließt sich der Kreis. Als die gut gekleidete und mürrische Verkäuferin mein schlich- tes neues Schuhwerk einpackt, frage ich sie, wo diese Dinger herkommen. »Ich habe keine Ahnung, in welchem Land der Chef sie ein- gekauft hat«, sagt sie gedehnt. »Die kamen einfach als Rest- posten rein. Wahrscheinlich China.« Hier liegt die große Unbekannte meines No-Logo-Kreuz- zuges. Ohne eine Marke als Garantie für Fertigung oder Her- kunft bleiben Qualität und Ethik der Produktion ein Glücks- spiel, bei dem Ausbeuterbetriebe in Drittweltländern die größten
- 129
- Gewinnchancen haben. Am besten, ich denke momentan gar nicht darüber nach, zumindest nicht in der Zeit, in der ich Klei- dungsstücke ohne Markenlogo erwerbe.
- - 7 7 Tage
- Als ich ein Kind war, hatten alle meine Lieblings-Fernsehsen- dungen irgendwie mit Autos zu tun: Knight Rider, Ein Duke kommt selten allein, Magnuin, Inspektor Morse (das war sonntags die am wenigsten schlimme Alternative zu Songs ofPraise). Ich stellte mir immer vor, dass ich später ein cooles Auto besitzen würde, einen alten Aston Martin oder einen Mercedes 350 SL atis den Achtzigerjahren, sexy, aber nicht zu angeberisch, ein wenig Klasse macht eben einen großen Unterschied. Die Frage nach dem Preis spielte in meinen Überlegungen keine Rolle, schließlich war ich eines von Thatchers Kindern. Ich weiß gar nicht so genau, an welcher Stelle dieser Plan schiefging. Jedenfalls fahre ich im Alter von jetzt einunddreißig Jahren den 1995er Citroen AX meiner Freundin. Zugegeben, ich habe mich hinsichtlich der Verwendung meines verfügba- ren Einkommens weitgehend festgelegt, als ich eine mörde- rische Hypothek aufnahm, um Wohneigentum in der Londoner Innenstadt zu erwerben. Aber die ursprüngliche Vorstellung sah vor, dass ich mir beides würde leisten können. Und mehr als das. Diese Sache wird zu keiner Zeit schmerzhafter bewusst als in jenen Momenten, in denen man mit dem AX an der Ampel neben einem brandneuen Audi Cabrio mit einem männlichen Teenager am Steuer und einem hübschen Mädchen auf dem Beifahrersitz zum Stehen kommt. Der Vergleich ist nieder- schmetternd. Wenn ich bei Grün losfahre, tue ich mein Mög- lichstes, um mit den glänzenden Gelahrten mitzuhalten, die sich von rechts und .links vordrängein. Aber es hat keinen Zweck. Wem will ich denn etwas vormachen? Ich fahre eine alte Klap-
- 130
- perkiste, die von einer langweiligen französischen Firma her- gestellt wurde, und damit hat sich die Sache. Einen Citroën zu steuern ist gleichbedeutend mit einer Ach- terbahnfahrt der Gefühle. Ich setze mich hinein - der Innen- raum ist beengt und nichtssagend. Am Lenkrad begrüßt mich das Citroën-Logo. Bah. Citroen, was für eine blöde Marke, ge- sichtslos, ewig hinter Peugeot angesiedelt (und die sind schon nicht besonders). Solche Autos werden von Leuten gefahren, denen diese Vehikel egal sind. Aber das ist in Ordnung. Ich muss mich einfach nur daran erinnern, dass ich kein »Auto-Typ« mehr bin. Ich benutze die- ses Ding einzig, um von A nach B zu fahren, deshalb ist es die Aufregung nicht wert. Ich fädele mich in den Verkehr ein und verrenke mir fast den Hals beim Versuch, an einem Range Rover vorbei zusehen. Dämliche Geländewagenfahrer, ohne Zweifel die blödesten Autobesitzer der Welt. Eigentlich sollte man sie doppelt besteuern, einmal für das Auto und dann noch mal für ihre Dummheit. Ah, plötzlich fühle ich mich tugendhaft als AX-Fahrer. Der Wagen ist ökonomisch, zuverlässig, und wenn mich jemand fragen sollte, ob er mir gehören würde, kann ich sagen, dass er das Auto meiner Freundin ist. In der nächsten Minute werde ich von einem arroganten BMW-Fahrer ge- schnitten. Ich gebe Gas, fahre hinterher und stelle mich an der nächsten Ampel neben ihn. Immer bereit, mit Fremden ohne Manieren einen Streit anzufangen, kurbele ich meine Scheibe herunter, weil ich Air. BMW einmal tüchtig die Meinung gei- gen will. Er schaut aus seinem Luxuskokon mit Lederpolster und Klimaanlage zu mir herüber und wartet darauf, dass ich ex- plodiere. Ich aber mache mit einem plötzlichen Gefühl der Er- nüchterung den Mund wieder zu. Es ist völlig egal, was ich sage. Es ist egal, wer im Recht und wer im Unrecht ist. Einer von uns beiden fährt einen sexy Schlitten - und das hin ganz sicher nicht ich. Wer ist also der Sieger hier? Für den Rest der Tour kurve ich wrie ein achtzigjähriger Land- pfarrer durch die Gegend, erlaube jedem, mich zu überholen, während ich mich in meiner Markenschande suhle. Ich bin wü- tend auf mich selbst - wütend, weil ich nicht genug Geld ver-
- 131
- diene, um mir ein vernünftiges Auto z,u leisten, wütend, weil ich so oberflächlich bin, dass es mir etwas ausmacht, wütend auf alle anderen Verkehrsteilnehmer, weil sie diese Gefühle in mir wecken. Ich kann mich noch entsinnen, dass ich mir, jedes Mal, wenn ich mit diesem Auto zu meinen Eltern fuhr, vor- stellte, es sei ihnen peinlich, wenn ich es vor dem Haus parkte. (Die Nachbarn könnten hinter ihren Vorhängen tuscheln: »Was für ein Versager dieser Neil Boorman geworden ist!«) Wenn ich hin und wieder mit dem AX zur Arbeit komme, achte ich darauf, so weit weg vom Büro zu parken, dass meine Kollegen mich nicht in dem Gefährt sehen können. Doch wenn ich es recht bedenke, dann hat mich dieser Citroen im Lauf der Zeit verändert, auf die gleiche Weise, wie es auch seine Besitzerin getan hat. Als ich Juliet kennenlernte, konsumierte ich Marken ohne Wenn und Aber. Ich war über- zeugt, dass die Flipflops von Gucci, das Feuerzeug von Dun- hill, die Brieftasche von LV mich kultivierter, liebenswürdiger und mehr zu dem Menschen machten, der ich sein wollte. Dum- merweise zeigte sie sich von diesen Statussymbolen nicht sehr beeindruckt. Nach und nach wurde mir klar, dass sie diese Prestigemarken eigentlich eher geschmacklos fand, was dazu führte, dass ich mir insgeheim ziemlich blöd vorkam. Trotz- dem gab ich weiter mein Geld dafür aus, oft versteckte ich das Zeug dann im Gästezimmer, in dem sie nie nachschaute. Ich bewunderte sie immer dafür, dass sie relativ frei war von dem ständigen drängenden Bedürfnis, etwas zu kaufen - obwohl ich sie oft mit glitzerndem Markenkram beschenkte, um sie auf meine Seite zu ziehen. Für Juliet ist es keine Qual, mit dem alten AX zu fahren. Es ist ein Auto. Es bringt dich dahin, wo du hinmusst. Ende der Geschichte. In ein paar Monaten werde ich damit durch die Stadt fahren, nein: cruisen, damit es alle sehen können. Ja, das bin ich, hinter dem Lenkrad eines AX, hast du ein Problem da- mit, oder was?
- 132
- -79 Tage
- H & M haben publik gemacht, dass Viktor & Rolf eine neue Kollektion für sie kreieren werden. Das dürfte für einen neuen Kaufrausch in den Einkaufszentren sorgen. Letztes Jahr gab es bei Hennes & Mauritz eine Limited-Edition-Kollektion von Stella McCartney, und an dem Morgen, als sie in die Läden kam, schien sich die ganze Welt vor den Türen der Geschäfte zu versammeln. Jede Frau mit einem Fünkchen Modeverstand meldete sich bei ihrer Arbeitsstelle krank und stand stunden- lang auf der Straße Schlange für die Chance auf ein Schnäpp- chen, wie man es nur einmal im Leben machen kann. Bei die- ser Gelegenheit wurde auch Juliet von der Hysterie ergriffen, und sie schleppte mich um halb zehn mit zum Covent Garden, als die dortige Filiale ihre Türen öffnete. Ich fand mich inmit- ten eines unschönen Hauens und Stechen wieder - Hunderte von Frauen (viele von ihnen alt genug, um es eigentlich besser zu wissen) rissen wahllos Hände voll Klamotten von den Klei- derstangen und stürmten damit zu den Kassen. Keine Marken- kampagne hat die Macht, Konsumenten völlig gegen ihren Willen zu manipulieren, aber es gibt viele, die die Menschen dazu bringen können, ihre Arbeit sausen zu lassen, in der Kälte Schlange zu stehen, mit anderen Kunden zu rangeln und sich noch tiefer in Schulden zu stürzen, um neue Varianten von Dingen zu kaufen, die sie bereits besitzen. Douglas Atkin, der Director of Strategy bei Mercedes war, erklärt in seinem Buch The Cidttng of Brands, wie Marken diese Art von Hysterie wecken können. Er vergleicht die Techniken mit denen, die von der Mun-Sekte praktiziert werden:
- Selbst wenn ein Mensch nur ein leises Gefühl der Entfrem- dung von seiner Umwelt verspürt, sucht er oft nach einem Gemeinschaftsgefühl, am liebsten eine Gruppe von Leuten, die seine Andersartigkeit als eine Tugend betrachten. Mar- ken bedienen sich dieser Tendenzen bei den Verbrauchern, sie fördern die Offenheit für und das Zugehörigkeitsgefühl
- 133
- zu ihrem Kult und däinonisieren gleichzeitig konkurrierende Gruppen. Sie müssen die Macht des Individuums mytholo- gisieren, und sie treten mit jedem Mitglied über ein System des Glaubens in Verbindung. 22
- In den Neunzigerjahren entwickelte General Motors eine Strategie, die mit der Rückkehr alter Familienwerte ope- rierte, wie sie vielleicht noch in Kirchen und Schulen anzu- treffen waren. Mit anderen Worten: Amerika wartete gera- dezu auf eine fürsorgliche Autofirma. Und so wurde die Marke »Saturn« geschaffen. Die Markenidentität gründete auf einem gemeinschaftlichen Wertekodex. Die Besitzer ei- nes Saturns wurden eingeladen, übers Wochenende den Ge- burtsort ihres Autos in Spring Hill, Tennessee, zu besuchen - dort konnten sie das Unternehmen, seine Angestellten und gleichgesinnte Autobesitzer kennenlernen. Bekannte Olym- piasportler bis hin zu Rhythm-and-Blues-Sängern fungierten als Gastgeber dieser Wochenenden, die eine neue Lebensart feierten. Mitglieder der »Saturn-Familie« wurden durch die Fabrik geführt, der Disney-Konzern veranstaltete ein »Camp Saturn« für die Kinder, und ein Paar heiratete sogar dort, wo- bei der Präsident von Saturn als Trauzeuge fungierte. Saturn bot seinen Kunden einen ganzen Lebensstil, eine komplett fertige Identität - und mehr als 40 000 Autokäufer nahmen diese Einladung an. Das ist es, was Kevin Roberts, der CEO von Saatchi & Saat- chi, als »Loyalität, die das Rationale übersteigt« bezeichnet hat. Diese ganzen Markenhandbücher hinterfragen nie die mentale Gesundheit des Verbrauchers, wenn sie sich darüber auslassen, wie man am besten Wünsche entstehen lässt. Doch die Folgen dieser Manipulation können wir ständig in den Nachrichten lesen. Im Jahr 2001 blieb einer Fra u in Chicago eine Gefängnisstrafe erspart, obwohl sie bei ihrem früheren Arbeitgeber 250 000 Dollar unterschlagen hatte. Ihre Vertei- digung machte geltend, dass sie das Geld gebraucht hatte, um ihre Einkaufsorgien zu finanzieren - eine Art Selbstmedika- tion, mit der sie ihre Depressionen bekämpfte. Der Richter ak-
- 134
- zeptierte, dass sie das Unterschlagen von Finnengeldern nicht kontrollieren konnte, weil sie glaubte, dass das Einkaufen sie glücklich machen würde. 2 '
- - 7 4 Tag
- Ich verbringe Stunden auf dem Airport, weil ich auf einen ver- späteten Flug zu einem Job im Ausland warte. Mit seinen end- losen, von Luxusgeschäften gesäumten Gängen sieht Heath- row eher wie ein Einkaufszentrum der oberen Preiskategorie aus. Der Sitzbereich in der Abflughalle ist umringt von glän- zenden Gucci-, Dior- imd Burberry-Schildern. Tatsächlich kön- nen Reisende, die auf ihren Flieger warten, recht wenig tun - außer einkaufen. Ich stöbere pro forma durch die Läden, kann mich aber beherrschen, etwas zu kaufen - das Zeug würde oh- nehin in ein paar Wochen verbrannt werden. Es ist kein Wunder, dass sich an einem solchen Ort wie dem Flughafen die Luxusmarken versammeln. Reisen ins Ausland haben etwas Mondänes, weil wir der Monotonie unseres bana- len Alltagslebens entfliehen und zwei Wochen lang sein kön- nen, wer wir sein wollen. Die prestigeträchtige Ware, die hier angeboten wird, lässt diese Fantasie noch realer erscheinen. Designerkugelschreiber, diamantbesetzte Manschettenknöpfe und Deluxe-Terininkalender gehören zur unverzichtbaren Ausstattung des weitläufigen Managers, Trendsetter-Bikinis und Visor-Caps erfreuen den Nobelurlauber. Wen kümmert es da schon, dass zu Hause die Gasrechnung, die Hypothek und die Uberziehungszinsen abbezahlt werden müssen; ein über- teuertes Designerhandtuch sorgt dafür, dass wir uns am Strand ein bisschen mehr wie ein Filmstar fühlen können. Im Luxusgütermarkt wird dieser Tand als Entry Point-Produkt bezeichnet. Diese Erzeugnisse bieten eine Art Massenmarkt- Exklusivität, die einen hohen Preis hat, aber noch innerhalb der finanziellen Möglichkeiten des Durchschnittsverdieners
- 135
- liegt. Die 200-Pfund-Sonnenbrille ist eigentlich nur ein form- gepresstes Stück Plastik. Die Parfüms sind einfach Fläschchen mit duftendem Wasser. Uns ist klar, dass die Produkte überteu- ert sind, doch das führt lediglich dazu, dass die Dinge uns wert- voller erscheinen. Wer so viel Geld für etwas ausgibt, das of- fensichtlich so billig herzustellen ist, will die Werte dieser Marke für sich in Anspruch nehmen. Das Logo auf der Son- nenbrille ist der Beweis dafür, dass man diese Werte gekauft hat. Wenn wir es kaum erwarten können, das Urlaubsgeld end- lich auszugeben, dann ist es kein Wunder, dass der Flughafen darauf besteht, uns mindestens zwei Stunden vor Abflug vor Ort zu haben; das gibt uns mehr Zeit zum Shoppen. So wie die Horden von Urlaubern in dieser klaustrophobi- schen Umgebung zusammengepfercht sind, wären ein Platz zum Spielen und Toben und eine Kinderkrippe sicherlich von Nutzen. Ebenso könnten ein Internetcafe, ein Mini-Kino oder ein Leseraum dabei helfen, die Zeit zu vertreiben. Tatsächlich aber ist der einzige nicht konsumorientierte Bereich, den ich hier finden kann, ein schäbiger Andachtsraum, der hinter dem Luxus-Schreibwarenhändler Smythson versteckt ist. Doch diese Abflughalle unterscheidet sich gar nicht einmal so sehr von dem Urbanen Umfeld, in dem die meisten von uns leben. Alle öffentlichen Räume in unseren Städten werden vom Kon- sum dominiert. Die gemütlichsten Stätten, an denen wir au- ßerhalb unseres Heims die Zeit verbringen können, sind Ein- kaufszentren. Die einzigen Orte, an denen man frei umherstreifen kann - abgesehen von Straßen und Parks, die oft herunterge- kommen sind und in denen der Aufenthalt mitunter nicht un- gefährlich ist sind die des Konsums. Das Einkaufszentrum ist der Platz, zu dem wir gehen, um uns mit Freunden zu treffen, zu promenieren, uns unterhalten zu lassen, und in dem wir ei- nen Schaufensterbummel unternehmen. Nachdem ich drei Stunden lang Leute beobachtet habe, wird endlich das Boarding für meinen Flug aufgerufen. Doch damit ist die Verkaufsveranstaltung noch nicht zu Ende. Während des Fluges verbringen die Stewardessen mehr Zeit damit, ihre zollfreien Waren anzupreisen, als sich den Grundbedürfnissen
- 136
- der Passagiere zu widmen; sie wedeln mit goldenen Uhren durch die Gange und verkünden über die Bordsprechanlage spezielle Rabatte fürToblerone. Zwischendurch versprühen sie irgend- ein neues Gucci-Parfum, was die ohnehin schon stickige Luft in der Kabine noch schlechter werden lässt. Wenn Sie sich diese niedrigen Preise nicht entgehen lassen wollen, dann wenden Sie sich bitte an unser Flugpersonal, das alle Ihre Wünsche gern erßillen wird. Wir wünschen Ihnen einen an genehmen Flug!
- - 7 1 Tage
- Das markenfreie Leben nach dem Feuer wird, um es vorsich- tig auszudrücken, eine ziemliche Herausforderung werden. Seit zwei Wochen suche ich schon im Internet nach einem Lie- feranten für markenlose Zahnpasta. Eine Firma in Russland beliefert Hotelketten mit unbedruckten Zahnpastatuben, aber das Zeug sieht eher aus wie Hüttenkäse mit Pfefferminzge- schmack. Ich hatte gleich befürchtet, dass Körperpflegeartikel schwer zu ersetzen sein würden. Also entschließe ich mich, statt- dessen ein paar Selfmade-Rezepte auszuprobieren; schließlich gab es auch vor Colgate schon Zahnpflege, oder?
- Zahnpasta-Rezept für empfindliche Zähne Pflanzliches Glyzerin, eine halbe Tasse Porzellanerde (auch Kaolin genannt), eine halbe Tasse Myirhentinktur, 35-40 Tropfen (verhindert Zahnfleisch- entzündungen) Pfefferminze oder grüne Minze oder Pudin Hara 7-8 Tropfen (frischer Atem) 7-8 Tropfen eines milden Betäubungsmittels (gegen Zahnschmerzen)
- Alle Zutaten gründlich vermischen. Eventuell weiteres Gly- zerin zugeben, um die richtige Konsistenz zu erreichen. In einer Flasche mit weitem Hals aufbewahren.
- 137
- Das sollte Juliet eigentlich gefallen: Sie liebt ihre Kiste Bioge- müse, die der Direktvermarkter jede Woche ins Haus bringt, und sie gibt manchmal ein Vermögen aus für teure chemiefreie Kosmetika von Aveda und anderen Herstellern. Kurz nachdem ich das Zahnpasta-Rezept entdeckt habe, kommt sie nach Hause, und ich erzähle ihr aufgeregt, dass wir auf selbst hergstellte or- ganische Kosmetika umsteigen. »Angesichts der Tatsache, dass du es hasst, zu kochen oder überhaupt irgendetwas in der Küche zu machen, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass du deine eigene Zahnpasta anrüh- ren willst, Neil. Treibst du es nicht ein bisschen zu weit?« »Marke ist Marke. Die Colgate muss weg. Und überhaupt enthalten die meisten dieser Markenzahncremes Chemikalien und Zusatzstoffe, Saccharin und Natriumsulfat-Dings bums. Im Grunde genommen das reine Gift.« »Deine Colgate muss vielleicht weg, meine bleibt. Und über- haupt ist Colgate kein Statussymbol, keine Trendmarke. Wa- rum machst du es dir so schwer?« »Ganz so einfach ist es eben nicht.« »In Ordnung, gut, es sind ja schließlich deine Zähne, die du aufs Spiel setzt.«
- - 6 5 Tage
- Ich humple zur Therapie, das völlige Fehlen eines Fußbetts in meinen markenlosen Billigturnschuhen hat meine Füße ziem- lich mitgenommen. »Warum glauben Sie, dass Sie so viele Marken sammeln, Neil?«, fragt Carol. »Haben Sie je das Gefühl, jetzt genug zu haben?« »Es kommt mir wie eine Sucht vor. Oft zieht es mich auf dem Weg zu einem Meeting in ein Geschäft hinein; ich erwa- che wie aus einer Betäubung und stehe in einem Laden, inmit- ten von Dingen, die ich unbedingt haben muss. Ich habe das
- 138
- Gefühl, dass ich mein Glückskonto aufstocke, wenn ich mir Dinge kaufe. Bloß hält das Glück nie lange vor.« »Sie kompensieren Ihre Ängste, indem Sie viele Dinge hor- ten, die Sie glücklich machen sollen. Doch Sie nehmen sich nie die Zeit zur Bestandsaufnahme Ihres Glücks. Das pausenlose Streben danach ist der sicherste Weg in eine Depression.« »Wünschen wir uns nicht alle Glück? Okay, ich gebe zu, dass ich vielleicht an den falschen Stellen danach gesucht habe. Aber es ist doch ganz sicher nichts falsch daran, danach Ausschau zu halten?« »Das Glück, nach dem Sie suchen, kann nicht von Dauer sein. Sie müssen sich damit abfinden, dass es für uns Alenschen kein permanentes Glück gibt. In jedem Leben gibt es Höhen und Tiefen, doch es ist der Bereich in der Mitte dieser beiden Extreme, der unser tägliches Dasein beschreibt. Das Beste, was wir uns erhoffen können, ist, einen Zustand der Zufriedenheit zu erreichen. Sie verbringen zu viel Zeit damit, sich auf den Zuckerguss zu konzentrieren; vielleicht sollten Sie Ihre Auf- merksamkeit ein wenig mehr dem Großteil des Kuchens zu- wenden.«
- - 6 2 Tage
- Nachdem ich in meinem Blog über meine Fußprobleme ge- jammert habe, hat ein anonymer Leser Mitleid und schickt mir ein Paar gepolsterter Einlegesohlen ins Büro. Ich wünschte nur, er oder sie hätte auch eine Tube Zahnpasta beigelegt. Mein selbstgemachter Versuch ist so grobkörnig, dass mein Zahn- fleisch wehtut, und außerdem habe ich den Eindruck, dass meine Zähne nicht mehr so weiß sind wie vorher.
- 139
- - 5 7 Tage
- Vielleicht war es ziemlich naiv zu erwarten, dass die Märkte hier in der Umgehung anständige Alternativen zu den Bou- tiquen bieten würden. Heute habe ich drei Märkte in der Lon- doner Innenstadt abgeklappert - Leather Lane, Chapel Mar- ket und Strutton Ground und keiner davon taugte besonders viel. Die Lebensmittelstände mögen eine Alternative zum Su- permarkt bieten, allerdings lassen die einheitlich geformten Apfel und die leuchtend roten Tomaten den Verdacht entste- hen, dass all diese Erzeugnisse gentechnisch optimiert wurden. Als ich einen Standbesitzer fragte, wo seine Apfel herkommen, zuckte er nur mit den Schultern und sagte: »Aus dem Lager.« Das ist nicht ganz das gleiche Einkaufserlebnis wie bei Selfrid- ges oder selbst bei Tesco. Auf den Märkten kann man jede Menge Kleidung kaufen, aber es sind keineswegs die markenlosen einfachen Qualitäts- artikel, wie ich es mir vorgestellt hatte. Bei dem meisten, was hier verkauft wird, handelt es sich um a) echte Markenware, die irgendwo von einem Lastwagen gefallen ist, b) gefälschte Markenprodukte, die in irgendwelchen Sweatshops mit einem schlechten Auge für Details gefertigt wurden (Boxershorts von Kalvin C l i n e , Taschen von »Louise Vittone«), oder c) mar- kenfreie Kleidungsstücke, die aus fadenscheinigem, nicht at- mungsaktivem und kratzigem Viskose- oder Polyesterstoff be- stehen. Kein Wunder, dass diese Märkte aussterben. Meine jaeger und sammlerinstinktc bleiben unbefriedigt, meine Beute
- beläuft sich auf grademal vier unterhemden einen brokkoli und einen organischen deostein von einem stand fuer bioprodukte
- 139
- - 54Tage
- Die einfachen Plastiktüten, die ich im Tante-Emma-Laden an der Ecke erhalte, scheinen das perfekte Anti-Marken-State- inent zu sein, und ich verabschiede mich endgültig von meinem North-Face-Rucksack. Doch die Tüten sind extrem dünn und neigen dazu, in den ungünstigsten Momenten zu reißen. Als ich zu meiner Therapiestunde erscheine, stelle ich fest, dass die Tasche ein Loch hat und dass irgendwo in der U-Bahn mein Diktafon und mein Notizblock herumliegen müssen. Am sta- bilsten waren immer die Tragetaschen von John Lewis. Ich ver- misse sie. »Vielleicht sollten Sie das mit dem Leben ohne Mar- ken etwas langsamer angehen lassen, Neil«, schlägt Carol vor. »Gehen Sie einen Schritt nach dem anderen.«
- - 5 1 Tage
- Je mehr ich darüber nachdenke, umso klarer wird mir, dass Mar- ken mir dabei helfen, ein anderes Selbstgefühl zu bekommen. Für ein Meeting, bei dem ich Eindruck machen will, würde ich völlig andere Labels tragen als auf einer Party oder bei einem Besuch bei Juli ets Eltern. Die meisten Menschen tragen zu un- terschiedlichen Anlässen unterschiedliche Kleidung. In jeder der drei genannten Situationen könnte ich ein Poloshirt des gleichen Zuschnitts und der gleichen Farbe tragen - und doch wäre ich mit einem jeweils anderen Logo auf der Brust jedes Mal eine andere Person. Ich frage mich, ob Jean René Lacoste, als er das Krokodilmotiv auf seiner Tenniskleidung einführte, sich vorstellen konnte, dass die Lebenseinstellung eines Menschen durch ein paar Quadratzentimeter Stickwerk und grafisches Design auf den Punkt gebracht werden kann?
- 141
- LACOSTE Markenbotschaft: Glamour in Sport und Freizeit; europäi- sche Herkunft Soziale Bedeutung: Verbeugung der über Dreißigjährigen vor der Blütezeit des britischen Fußball-Rowdytums Klischee: nordenglischer »Scally« - grob und ungehobelt; Trendsetter aus dem Süden; kontinentaleuropäischer »Cheese Ball« - jemand, der retro ist, ohne es zu wissen
- RALPH LAUREN Markenbotschaft: amerikanische Herkunft, Hochhalten der Tradition, klar umrissener Lebensstil Soziale Bedeutung: Aufstiegshoffnung oder Behauptung einer Zugehörigkeit zur High Society Klischee: amerikanischer »Jock« - Sportskanone mit be- grenzten intellektuellen Fähigkeiten; englischer »Chav« - eben ein Prolet; ironische Anspielung darauf
- BURBERRY Markenbotschaft: englische Herkunft; Jagd und andere Freizeitbeschäftigungen der Oberschicht Soziale Bedeutung: wie Ralph Lauren, mit einem schalen Beigeschmack von Cool Britannia Klischee: Hooligan aus den Sozialsiedlungen; Fußballer- frau; Golfer im mittleren Alter
- YSL Markenbotschaft: klassischer europäischer Glamour Soziale Bedeutung: Verehrung der altmodischen Werte wie Schönheit und gesellschaftlicher (ilanz Klischee: reiche Großmütter; Arbeiterklasse-Kltern, die reich sein wollen
- NIKE Markenbotschaft koerperl. Hoechstleist quer durch alle kulturen
- m;
- Soziale Bedeutung: Glaube an Sport und Freizeit als (ame- rikanischer) Way of Life Klischee: Möchtegern-Gangsta; Teenager mit Kapuzenpul- lis; Fitness-Junkies
- ADIDAS Markenbotschaft: siehe Nike Soziale Bedeutung: siehe Nike, allerdings eher weiß und europäisch
- Klischee: Sportenthusiast; Einsteiger-Modefan
- FRED PERRY Markenbotschaft: englische Sporttradition, aber moderni- siert Soziale Bedeutung: nicht cool genug, um Lacoste zu tragen Klischee: alternder Mod; verkrampfter Versuch, in zu sein CALVIN KLEIN Markenbotschaft: der Geist des amerikanischen Erfolgs der Neunziger jähre Soziale Bedeutung: Mode ftir Leute, die nichts von Mode verstehen
- Klischee: uneinheitlich, aber in erster Linie unmodisch
- DIESEL Markenbotschaft: die Extravaganz der Jugend Soziale Bedeutung: nicht ganz so extravagant wie verspro- chen Klischee: »Eurokitsch«-Teenager; Mütter, die wieder jung sein wollen HACKETT Markenbotschaft: typische »John Bull«-Angelsachsen Soziale Bedeutung: mehr oder weniger offene Fremden- feindlichkeit und Klassenbewusstsein Klischee: Komasäufer aus der Unter- und Oberschicht
- 143
- H U G O BOSS Markenbotschaft: europäisches Statussymbol der Achtziger- jahre Soziale Bedeutung: schreckliche Erinnerung an die schlimms- ten Entgleisungen der Achtzigerjahre Klischee:Vorstandshengste; Leute, die Marken zwiespältig gegenüberstehen und nach dem Preis kaufen
- Spiegelt nun die Marke ihren Träger oder der Träger die Marke? Carol erinnert mich immer wieder daran, dass zu meinem Mar- kenentzug auch gehören muss, andere Menschen nicht mehr auf den ersten Blick nach den Labels zu beurteilen, die sie tra- gen. Ich glaube, das könnte am schwersten werden.
- -48Tage
- Die englische Soziologin Rachel Bowlby beschreibt den Schau- fensterbummel als »das grundlegende psychische Drama des 20. Jahrhunderts, es fängt mit dem Stöbern an und endet mit dem Kauf«. 24 Ein solcher Bummel weckt unseren Hunger auf ein erfüllenderes und dynamischeres Leben; durch das Betrach- ten der Produkte schaffen wir neue Bedürfnisse, die das nächste Mal, wenn wir einen Konsumgegenstand kaufen, befriedigt werden müssen. Ich kann für mich selbst sagen, dass ich un- glaublich viel Zeit in Geschäften, besonders in Kaufhäusern, verbrachte, um etwas, irgendetwas zu finden, das mein Selbst- wertgefühl steigern würde. Während ich durch den wohlge- ordneten Luxus der Boutiquen streifte, spielte ich in meinem Kopf Besitzläntasien durch. Sah ich einen Mantel in der Aus- lage, dann fragte ich eine Verkäuferin, oh ich ihn mir "ansehen--«, konnte. Ich stand vor dem Spiegel, trug das Ding zum ersten M a l und s t e l l t e mir vor, w e l c h e r Anzug dazu passen würde, in welchen gesellschaftl. S i t u a t i o n e n er angemessen wäre und w e l c h e n eindruck ich auf andere machen wuerde, wenn ich
- l'H
- T
- ! ihn anhatte. Da jedoch ein Schaufensterbummel etwas völlig I anderes ist als richtiges Shoppen, vertagte ich in solchen Fäl- len den Kauf auf ein anderes Mal. Es ist nicht das Besitzen sel- ber oder das Tragen des Mantels, das mich erregt, sondern die Vorfreude auf das Besitzen, eine gefühlslastige Angelegenheit, i die wenig mit Notwendigkeit zu tun hat. Sie beruht ausschließ- | lieh auf Verlangen und Fantasie. ! »Professionelle« Schaufensterbummler besuchen gern Kon- j sumtempel wie Selfridges, in denen man Stunden damit zu- 1 bringen kann, die opulenten Bestände zu durchstöbern, Pausen ! in den Bars und Restaurants einzulegen, sich eine halbstündige Rückenmassage oder Gesichtsmaske zu gönnen; es ist ein re- gelrechter Tagesausflug. Vor der Industriellen Revolution sah das durchschnittliche Einkaufserlebnis etwas anders aus. Im Kaufladen, der von den örtlichen Herstellern beliefert wurde, bediente der Besitzer die Kunden. Die Waren wurden norma- lerweise hinter der Theke in Schachteln und Schränken aufbe- wahrt, und der Käufer ließ sich die Sachen zeigen, bevor er sie erwarb. Das Wichtigste aber war, dass Kunden das Geschäft nur aus Notwendigkeit besuchten, wenn sie ihre Vorräte er- neuern mussten. Moderne Kaufhäuser sorgen dafür, dass der Lärm und das Gedränge der Außenwelt draußen bleiben. In ih- nen herrscht Ordnung. Als öffentliche Räume bieten sie ein Gemeinschaftsgefühl; Geschäft, Stadthalle und Klubraum, al- les unter einem Dach. Einkaufen ist heute eine Freizeitbeschäf- tigung und als gesunde und moralische Aktivität anerkannt. Ein völlig normaler Teil des modernen Lebens. Es steht außer Zweifel, dass Shopping, besonders wenn es um nutzlose Dinge geht, enorm viel Spaß macht. Auf meinem Nach- hauseweg von der Bibliothek gehe ich in ein Schuhgeschäft und sehe zu, wie sich die Freude im Gesicht der Kundinnen i ausbreitet, während sie neue Schuhe anprobieren und für sich selbst im Spiegel posieren. Schick gestylte Verkäuferinnen ! schweben durch die Gänge, stets mit einem Ausdruck leichter j Missbilligung im Gesicht, der sich im Moment des Kaufes in I Anerkennung verwandelt. Technisch klingende Tanzmusik pul- i siert aus den Lautsprechern. Die Innenausstattung und das helle Licht blenden die Augen.
- Fortsetzung in Part 2/2
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement