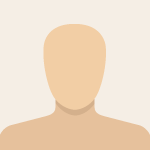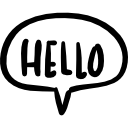Advertisement
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- Viktor Parma Machtgier Wer die Schweiz wirklich regiert
- Inhalt
- Vorwort_9
- I Die Konferenz der Machtelite - die Bosse unter sich 13
- Wo, wie, wozu und seit wann sich die Spitzen von Politik und Wirtschaft zu geheimen Sitzungen versammein und wer dabei den Heiligen Geist zu vertreten versucht_13
- II Die Regierung verlernt das Regieren
- Jeder gegen jeden - Wer im Bundesrat das eigene Ego über alles stellt und wer Gegensteuer geben möchte - Micheline Calmy-Rey, Moritz Leuenberger, Samuel Schmid_2i
- Einer gegen a l l e - W i e die Diskordanz im Kollegium die Oberhand gewinnt und wie die bürgerliche Mitte einstürzt-Christoph Blocher, PascalCouchepin, Hans-Rudolf Merz_29
- Alle gegen e i n e - W i e s o eine Bundesrätin frühmorgens auf dem Balkon steht, das Land der ewigen Konkordanz mit der Seele suchend - Doris Leuthard_39
- III Die Konzernchefs auf dem Weg zur globalen Macht_51
- Wie Marcel Ospel mit Kollegen die alte Garde entmachtet, die finanzielle Weltrevolution vorantreibt, die Politik abschafft und die Risikogesellschaft einführt_5i
- Wie Marcel Ospel als VR-Präsident im Sitzland wieder politisch Fuß fassen will und sich durch seine Wertvorstellungen zugleich selber ausbürgert_6i
- Wie sich Big Pharma zum Weltsystem spreizt, Franz Humer die Finanzer in die Schranken weist und DanielVasella dem Tod den Meisterzeigen möchte_70
- IV Das Parlament verliert die oberste Gewalt_83
- Warum die Räte nicht mehr sind, was sie waren, und wieso die freisinnige Staatspartei ihr Schicksal so zielstrebig erfüllt - Christine Egerszegi, Gerold Bührer, Fulvio Pelli_83
- Wie die Medien die Parteien überwältigen und wann die Mitte mit sich selber fusionieren wird - Christophe Darbellay, Filippo Leutenegger, Hans-Jürg Fehr_94
- Wo sich der alte Filz auflöst und welche Chancen robuste Einzelkämpfer dadurch erhalten - Peter Spuhler, Paul Rechsteiner, Johann Schneider- Ammann_105
- Die Mandarine springen in die Lücke_117
- Welche Chefbeamten den Service public am Laufen halten, wie sie einst den Ausbau der Staatsmacht planten und was sie davon abbrachte - Hans Werder, Ulrich Gygi_117
- Wie Technokraten für die Schweiz die globalen Risiken managen möchten und was sie dabei erleben-Jean-Pierre Roth, Thomas Zeltner, Michael Ambühl_125
- Wie Schweizer Mandarine mit der Großmacht China umspringen und welche Gewerkschafter die Finger von ihr lassen - Serge Gaillard, Uli Sigg_139 Wie die globalen Krisenmanager improvisieren_151
- Was das Rote Kreuz mit den Wirtschaftskapitänen zu schaffen h a t - u n d wieso Jakob Kellenberger und Klaus Schwab das Gleiche sagen und das Gegenteil voneinander meinen_151
- Wieso selbst die Manager vor der Globalisierung Angst bekommen und doch dem Machtstreben nicht entsagen können - Walter Kielholz, Peter Brabeck_161
- Vorwort
- «Der Kleinstaat ist vorhanden, damit ein Fleck auf der Welt sei, wo die größtmögliche Quote der Staatsangehörigen Bürger im vollen Sinne sind.»
- Jakob Burckhardt, 1868
- Ein Spuk geht um im Staate Schweiz - das ungute Gefühl, dass sich Globalisierung und Demokratie schlecht ver- tragen. Das Unbehagen hat, hundertfach abgewandelt, verkleidet, verkleistert, verschönert, auch den Wahl- kampf 2007 geprägt. Keine Partei sagt zur Globalisierung ja, keine sagt nein, alle lavieren. Jede behauptet, die rich- tige Formel dafür gefunden zu haben, keine überzeugt damit. Wenn aber ein Wahljahr die Stunde der Wahrheit wäre - was enthüllte sich? Eines spüren die Menschen genau: Die Globalisierung hat die Karten auch innerhalb der Schweiz neu gemischt und frisch verteilt; sie verändert alles. Das Zusammen- spiel zwischen Staat und Wirtschaft, zwischen den drei Staatsgewalten, dies alles ist ins Ungleichgewicht gera- ten. Macht und Verantwortung treten auseinander. Die reale Macht gleitet fürs Volk ins Ungreifbare. Die schlei- chende Krise untergräbt mehr als nur die Glaubwürdig- keit von Parteien. Worauf läuft sie jedoch hinaus? Eine Regierungskrise? Gar eine Systemkrise? Was die richtige Diagnose erschwert, ist die Geheim- niskrämerei der Machtelite in eigener Sache. Die Spitzen
- 9
- von Politik und Wirtschaft verschleiern mehr, als der schweizerischen Demokratie zuträglich ist. Sie arbeiten mitunter selbst an der Verfassungsordnung vorbei. Dass Bundesräte und Parteipräsidenten dabei mitspielen, macht das Versteckspiel nicht besser, sondern gefährli- cher. Mit ihrer Beihilfe umgehen Topmanager nicht nur den ungeliebten, vielgeschmähten Staat, sondern letz- ten Endes den Souverän. Dieses Buch will das durcheinandergeratene Schwei- zer Machtsystem untersuchen. Es möchte - mit jour- nalistischen Mitteln - Ursachen der Krise orten und mögliche Folgen erwägen. Daraus ergibt sich die Kon- zeption des Buches von selbst. Es mustert die Macht- elite scheibchenweise durch, am Beispiel prägender oder exemplarischer Persönlichkeiten. Es besucht die Macht- träger selbst an ihren Wirkungsstätten in Zürich, Bern, Basel, Vevey und Genf. So gleicht es streckenweise auch einem Rundgang durch die politische und wirtschaft- liche Landschaft Schweiz. Es porträtiert und analysiert Personal und Mechanik des Systems Schweiz in sechs Schritten:
- KAPITEL EINS berichtet über die geheime Jahreskonfe- renz der Machtelite beim Weltkonzern Nestle, die Voll- versammlung der Schweizer Verantwortungsträger, die so erstaunlich lange Zeit geheim bleiben konnte. Die These: Wie das Land wirklich gesteuert wird, ist der Öf- fentlichkeit unbekannt.
- 10
- KAPITEL ZWEI untersucht die Ohnmacht einer Kollegial- regierung, die keine mehr ist. Im Bundesrat hat die Dis- kordanz inzwischen System. Die These: Die Schweiz hat sieben Minister und keine Regierung.
- KAPITEL DREI porträtiert Topmanager und ihre Motive bei der Globalisierung. Die These: Konzernchefs, die zum Teil zu den Urhebern der Risikogesellschaft zählen, haben sich aus der politischen Schweiz, ihrem Her- kunfts- und Sitzland, selber ausgebürgert. Sie sind die neuen Staatenlosen.
- KAPITEL VIER beschreibt das Parlament, die verfas- sungsmäßig oberste Gewalt, die so viel Mühe hat, ihrem hohen Anspruch zu genügen. Die These: Die Räte wer- den zur Schaubühne umfunktioniert. Die Parteienland- schaft spiegelt überholte Konstellationen. Die Lobby atomisiert sich.
- KAPITEL FÜNF analysiert Spitzenbeamte und Technokra- ten, wie sie als Risikomanager für die überforderte Politik in die Lücke springen und wie weit sie damit kommen. Die These: Sie meistern die Risiken nur notdürftig, weil ihnen die politische Legitimation fehlt.
- KAPITEL SECHS beschäftigt sich mit der Immunschwä- che der Schweiz und ihren tieferen Gründen. Globale Krisenmanager und Netzwerker arbeiten an Lösungen, die einander ausschließen. Die These: Die Schwäche ist, wird sie richtig diagnostiziert, korrigierbar.
- ii
- Auf dem Spiel steht mit der Schweiz mehr als nur sie selbst. Sie ist - freilich oft selbstvergessene - Weltbürge- rin. So muss auch dieses Buch häufig ihre Rolle im glo- balen Kontext, mit Blick in Richtung Europa, USA und China, beleuchten. Die alte Musterdemokratie, während Generationen hochberühmt, ein mehrsprachiges, fried- liches Idyll in einer umkämpften Welt, ein Menschheits- traum, ist ein Staatsmodell von globaler Ausstrahlung. Ob und wieweit gerade sie Demokratie und Globalisie- rung miteinander verbinden kann, wird über ihre Lan- desgrenzen hinaus von Belang sein. Die Schweiz hätte eine Chance, sich als Versuchslabor der Weltgeschichte zu bewähren.
- I Die Konferenz der Machtelite - die Bosse unter sich
- WO, WIE, WOZU und seit wann sich die Spitzen von Politik und Wirtschaft zu geheimen Sitzungen ver- sammeln und wer dabei den Heiligen Geist zu vertre- ten versucht
- Es lächelt der See, doch er ladet nicht zum Bade: Das Wasser ist zu kalt, 6,4 Grad heute, am 5. Februar 2007, und Peter Brabeck ist in Eile. Der Nestlé-Chef springt, leicht verspätet, im Gebäude des Konzernsitzes in Vevey in den sechsten Stock hinauf. Oben angekommen, am Eingang zum großen Mehrzwecksaal, bei herrlicher Aus- sicht auf Genfersee und Savoyer Alpen, muss er die Schweizer Machtelite zu ihrer jährlichen Geheimkonfe- renz empfangen. Erste Gäste tun sich an Brötchen güt- lich, nippen Fruchtsaft, schlürfen Nespresso. Jeden Februar strömen hier auf leisen Sohlen ganz verstohlen die Spitzen von Politik und Wirtschaft des Landes zusammen. Zu den Geladenen der letzten Jahre gehören zum Beispiel Marcel Ospel (UBS), Daniel Vasella (Novartis), Franz Humer (Roche), Walter Kielholz (CS) und weitere Spitzenverdiener, Christoph Blocher (SVP), Doris Leuthard (CVP), Hans-Rudolf Merz (FDP), Pascal Couchepin (FDP) und andere Bundesräte, Rolf Dörig (Swiss Life), Peter Forstmoser (Swiss Re), Ulrich Gygi (Post) und weitere Konzernchefs, nicht zuletzt Rainer E. Gut (CS-Ehrenpräsident), Gerold Bührer (Economie-
- ii
- suisse) sowie Jean-Pierre Roth (Nationalbank), ferner Fulvio Pelli (FDP), Hans-Jürg Fehr (SP) und die übrigen Spitzen der Regierungsparteien. 2007 stieß, kaum ge- wählt, der jüngste Parteichef natürlich auch sofort zur Runde, Christophe Darbellay (CVP). Wirtschaftsführer, Politiker und Mandarine nehmen sich für ihre große Jahreskonferenz zur Strategie der Schweiz in der Globalisierung jedes Mal anderthalb Tage Zeit. Sie fassen keine förmlichen Beschlüsse und stel- len dennoch Weichen. Sie definieren Konzepte für die Schweiz mit Blick auf Welthandel, Finanzmärkte, Gesell- schafts-, Bildungs- und Forschungspolitik, stets hinter verschlossenen Türen. Kaspar Villiger, Nestle-Verwal- tungsrat und Alt-Bundesrat, der die Treffen mit viel Auf- wand vorbereitet und leitet, formuliert das Programm in seiner vertraulichen Einladung an die Teilnehmer mit vornehmer Delikatesse: «Wir diskutieren langfristige Trends und Probleme, welche die Schweiz und ihre Wirt- schaft betreffen, und bleiben dabei so weit wie möglich praxis- und lösungsorientiert.» Der verschwiegene Kreis fand in diesem Sinn im Ver- lauf der letzten Jahre in strategischen Schlüsselfragen durchaus praxistaugliche Lösungen, etwa bei der Sanie- rung der Bundesfinanzen und der Steuerpolitik, der So- zial- und Arbeitsmarktpolitik (Näheres in einschlägigen Kapiteln dieses Buches). Auch im Powerplay der Schweiz mit der EU, gerade bei den Bilateralen Verträgen II, fie- len zentrale Entscheide an Rive-Reine-Tagungen. In die- ser Sache vertrat Marcel Ospel die Sonderinteressen der Banken mit aller Kraft. Öffentlich forderte er zu Beginn
- ii
- gar, das Zinsbesteuerungsabkommen Schweiz-EU aus dem Gesamtpaket herauszulösen und sofort zu unter- zeichnen - ehe auch die andern Abkommen zwischen der Schweiz und der EU unter Dach waren (Schengen, Betrugsbekämpfung). Erst an der Rive-Reine-Tagung kam Marcel Ospel von seiner Taktik ab und erklärte sich mit einer allgemeinen Strategie einverstanden, die auch die anderen Anliegen einbezog. Chefdiplomat Michael Ambühl konnte ihn überzeugen und setzte sich mit seinem Gesamtkonzept durch - zuerst an der Rive- Reine-Tagung, dann in Brüssel. Am Ergebnis änderten Parlament und Volk dann nichts mehr. Sie stimmten ihm zu - nach jahrelangen parteipolitischen Propaganda- schlachten pro und kontra. So funktioniert das Schweizer Machtkartell seit Jah- ren: an den verfassungsmäßigen und demokratischen Institutionen vorbei. Seine Früchte versetzten den soge- nannten Souverän schon mehrmals in Erstaunen. Doch ihre Herkunft wurde nie deklariert. Die Konferenz folgt präzisen Ritualen. Erst wird am Hauptsitz des Weltkonzerns in Vevey in einem Rückblick über die Ergebnisse der letztjährigen Tagung orientiert. Es folgen zweieinhalb Stunden Diskussion über das offi- zielle Thema der Tagung (zum Beispiel 2007 «Die zu- künftige Landwirtschaftspolitik für eine sich globalisie- rende Schweiz», 2006 «Die Schweiz im Spannungsfeld von globalen Finanzmärkten und heimischer Volkswirt- schaft»), Nach der ersten Diskussionsrunde - die Tische sind eigens für diesen Anlass kreisförmig angeordnet - werden alle Teilnehmer ins Nestle-Konferenz- und Schu-
- ii
- lungszentrum Rive-Reine in der Nachbargemeinde La Tour-de-Peilz gefahren, ein ehemaliges Luxushotel in spektakulär schöner Lage am Seeufer, dreißig Geh- minuten vom Konzernsitz entfernt. Hier wird getafelt, geplaudert, genächtigt. Treffen sich Spitzen persönlich, wird oft Unmögliches möglich; äußerst wichtig ist nur die Verschwiegenheit. Bundesrätin Doris Leuthard spricht beim Vier-Gänge- Dinner im Rive-Reine-Zentrum mit Daniel Vasella und Marcel Ospel über deren Konzernstrategien in den Wachstumsmärkten Brasilien, Indien, Russland und China. Vasella kämpft in einem heiklen Prozess für seine Patentrechte gegen Indien. Ospel hat sich soeben in Bra- silien nach möglichen Zukäufen umgesehen, und Leut- hard ist ihrerseits gerade auf dem Sprung dorthin. Gleich nach dem Dessert bricht sie Richtung Flughafen auf; sie darf den Abflug am späten Abend nicht verpassen, denn sie muss in Nordostbrasilien mit Peter Brabeck und Präsident Lula eine neue Nestle-Fabrik eröffnen. Ospel, Vasella & Co. bleiben mit allen andern im Rive-Reine- Zentrum zurück. Die Gespräche an der Bar dauern bis nach Mitternacht. Man ist in gehobener Stimmung, die Börsenkurse sind gerade auf einem neuen Allzeithoch - zwanzig Tage vor dem Shanghai-Schock. Fragt man die Manager, wie wichtig sie selber den Anlass nehmen, antwortet der eine so, der andere so. Ospel lächelt verschmitzt: «Man hört da Neues.» Natio- nalbank-Chef Roth schätzt die «wertvollen Kontakte». Einer sagt wörtlich: «Rive-Reine ist für die Schweiz das echte Davos!» Ein kritischer Kopf findet die Tagung
- ii
- «oft enttäuschend» - und kommt dennoch immer wie- der her. Keiner der fünfzig Top Shots jedoch ginge nach Mitter- nacht hinaus auf die Terrasse, obwohl selbst bei strenger Kälte lohnende Entdeckungen zu machen wären. Bei Mondschein enthüllt der Ort zur Geisterstunde sein wahres Wesen. Ins Auge springt zunächst eine Gedenk- tafel im Eingang zum 1994 eingeweihten Annexgebäude; sie rühmt Brabeck-Vorgänger Helmut O. Maucher als «Urheber der Vergrößerung dieses Zentrums und lei- denschaftlichen Förderer des Geistes von Rive-Reine». Dieser Geist ist allerdings nicht demokratisch. Ihn ver- körpert die steinerne Sphinx, die den Besitz von alters her bewacht. Die stolze Figur stellt Augusta dar, zweite Ehefrau von Friedrich Wilhelm III., König von Preußen (1770-1840). Auf sie geht auch der Namen des Anwesens zurück. Die Hochadlige erkor es zu ihrer Residenz, ehe es Nobelhotel wurde. 1969 ging das Haus in den Besitz des Nestlé-Konzerns über, der daraus sein Schulungs- und Konferenzzentrum machte. Der «Geist von Rive-Reine» indessen ist und bleibt das Gespenst aus vordemokrati- scher Zeit. Ins Leben rief Nestlé die Rive-Reine-Tagungen der Schweizer Elite aus Sorge um Umwelt und Menschheit. In den siebziger Jahren war Verwaltungsratspräsident Pierre Liotard-Vogt vom Bericht des Club of Rome über die «Grenzen des Wachstums» beeindruckt. 1974 stellte er Hugo Thiemann ein, Mitbegründer des Club of Rome. Thiemann lancierte die Tagungen über die langfristige Zukunft. Von Anbeginn dabei war Rainer E. Gut, CS- und
- ii
- Nestlé-Kapitân. Er verformte das Netzwerk im Lauf der Jahre zum persönlichen Machtinstrument. Nach dem Swissair-Grounding 2001 trotzte er den Rive-Reine-Kol- legen Riesensummen ab, um die Nachfolgegesellschaft Swiss aufzubauen. Noch heute sitzt der betagte Pate der Schweizer Wirtschaft neben Kaspar Villiger, dem nomi- nalen Rive-Reine-Gastgeber, mit am Ehrentisch. Für die Schweizer Machtelite sind die Geheimtreffen bei Nestlé nicht die einzigen von Bedeutung, doch die mit Abstand hochkarätigsten. Die Bundesräte waren fast alle schon dabei; sie erschienen in der Regel sogar zu zweit. Erstaunlich bleibt, wie lange die Konferenz der Prominenz inmitten der ach so transparenten Medien- gesellschaft verborgen bleiben konnte. Kaspar Villiger, Verwaltungsrat der Neuen Zürcher Zeitung und eine Art Generalsekretär des Politbüros des Zentralkomitees von Rive-Reine, besteht auf der vom Konzern vorgegebenen Null-Information, und zwar unmissverständlich: «Unser Gedankenaustausch findet ohne Publizität statt.» In der Tat, die NZZ, zusammen mit der Stiftung Avenir Suisse an Vorbereitung und Durchführung des Treffens durch führende Redaktoren seit vielen Jahren selbst beteiligt, verschweigt ihren werten Lesern in solchen Fällen ein- fach alles. Andere Journalisten und Multiplikatoren sind von der Konferenz ohnehin ausgeschlossen. Stehen die NZZ-Vertreter an der Versammlung für die sozusagen weltliche Seite des Heiligen Geistes ein, tun es die hohen Würdenträger beider Landeskirchen für die spirituelle. Die römisch-katholische Kirche wird repräsentiert durch Abt Martin Werlen vom Kloster Ein-
- ii
- siedeln, Mitglied der Schweizerischen Bischofskonfe- renz. Mit von der Partie ist auch Pfarrer Thomas Wipf, Präsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchen- bunds. Die Gottesmänner geben der Runde den nötigen höheren Beistand, und die Topmanager erhalten ihren heiligen Schein. Der Herr im Himmel dürfte staunen.
- Ii Die Regierung verlernt das Regieren
- JEDERGEGEN J E D E N - W e r i m Bundesrat das eigene Ego über ailes stellt und wer Gegensteuer geben möchte - Micheline Calmy-Rey, Moritz Leuenberger, Samuel Schmid
- Micheline Calmy-Rey strebt zur Sitzung des Kollegiums. Sie eilt geschäftig an der einzigen Büste vorbei, die die große Vorhalle des Bundesratszimmers ziert. Der Me- tallkopf stellt Gustave Ador dar, Bundesrat 1917-19, und hätte ihr viel zu sagen. Der letzte Genfer Außenminister bewirkte in kurzer Zeit viel: den Beitritt der Schweiz zum Völkerbund, Genfs Aufstieg zur diplomatischen Welt- stadt. Ruth Dreifuss, die Vorgängerin Calmy-Reys, ehrte sein Konterfei, pflegte ihn zu streicheln und zu begrü- ßen: «Bonjour, cher collègue, tu vas bien?» Der guss- eiserne Kollege erinnert beharrlich an Zeiten, in denen die Regierung noch richtig handlungsfähig war. Im Moment hat Calmy-Rey für den alten Hausgeist beim besten Willen keine Zeit. Die Bundespräsidentin sollte jetzt ihrerseits regieren. Sie leitet die Sitzungen des Kollegiums, so gut sie kann. Doch fragt natürlich auch sie sich, in eigenen Worten, «dauernd, ob der Mix in der Regierung funktioniert». Der Bundesrat, während Gene- rationen der Dreh- und Angelpunkt der Eidgenossen- schaft, ist in schlechter Verfassung. Zwar treten die sie- ben Minister noch immer Mittwoch für Mittwoch zur
- ii
- Sitzung zusammen, pflichtschuldigst. Doch ein Kolle- gium ist das kaum mehr: viel Dissens, wenig Autorität. Jedes Mitglied ist sich selbst das nächste. Die Damen und Herren belauern, ja befehden einander, greifen zu Tricks und Finten. Sie führen Wahlkampf in je eigener Sache. Die Schweiz hat sieben Minister und keine Regie- rung; die Vorsitzende möchte aber nicht klagen. «Ich habe als Präsidentin keine Handhabe, Ordnung zu be- fehlen.» Ihr fehlt die Richtlinienkompetenz einer Pre- mierministerin. Deshalb war «Bundespräsidentin nie das Ziel meines Lebens». Die Rolle der reinen Würden- trägerin reizte sie nie. Ihr Ehrgeiz zielte stets auf mehr: auf reale Macht. Dazu stand sie immer unumwunden: «Ich wollte ganz klar ein Stück politische Macht.» Und die steht den sieben Bundesräten zu gleichen Teilen zu; jedem ist von der Verfassung dasselbe Gewicht zuer- kannt, also auch der Präsidentin. In jungen Jahren erfuhr die Tochter eines Eisenbahners und SP-Vorkämpfers aus dem CVP-dominierten Wallis die Kehrseite der Macht: die Ohnmacht. In der Primarschule von Saint-Maurice begann sie dagegen aufzubegehren. Sie weigerte sich, «die Knie zu beugen, als dies eine der Schwestern von mir verlangte - aus reinem Widerspruchsgeist». Ihre Ohnmacht überwand sie nach und nach. Aus Trotz wurde die Walliserin Zug um Zug zur Gegenmacht. Micheline Rey emigrierte nach Genf, studierte die Poli- tikwissenschaft, heiratete den introvertierten Rumänen André Calmy und avancierte bei der Genfer SP zur Groß- rätin, Parteichefin und Staatsrätin. Der Dämonie der Macht entrann sie nirgends. «Die Macht spielt in allen
- 22
- menschlichen Beziehungen mit, ob Liebes-, Arbeits- oder Vereinsleben. Die ständig ändernden Machtverhält- nisse sind in der Gesellschaft tief verwurzelt und sind letztlich nur als unzählige Spiele zwischen Partnern zu betrachten», so die Magistratin. Not verlieh ihr unge- ahnte Kräfte. Ihr Mann litt an einer lebensgefährlichen Herzkrankheit. Sie ließ indes den Mut nicht sinken. «Ich funktioniere gut, wenn die Dinge schlechtgehen.» 2002 wurde sie Bundesrätin und ist dennoch für sich selber Gegenmacht geblieben. Die streitbare Linke braucht die Widerstände, die sie weckt. Streiten will sie nicht um des Streitens willen. Die feministische Kraft- natur und Intelligenzbestie kämpft, wie sie hofft, für eine gerechtere Welt. Dabei schont sie ihr Umfeld nicht. Mal entfährt ihr über Doris Leuthard im kleinen Kreis ein äußerst derbes Kraftwort, mal sagt sie über die CVP- Kollegin auch Nettes. Niemandem möchte Calmy-Rey weh tun und ist doch zu gewaltigen Wutausbrüchen fähig. «Manchmal gehe ich vielleicht zu weit.» Erst folgt sie ihrem Gefühl, dann will sie vor ihrem Verstand beste- hen. «Ich handle instinktiv und hole es nachher intellek- tuell nach.» Die Außenministerin bezahlt für ihre Lei- denschaft einen hohen Preis, wie sie sich eingesteht: «Ich nehme alles ernst. Ich kann über mich nicht lachen. Ich bin humorlos.» Sie treibt sich zum Äußersten und durch- schaut sich zugleich. «Ich bin mit mir grausam.» Häufig sitzt die Bundespräsidentin bis tief in die Nacht am Pult und hadert im Stillen mit sich selbst. In ihrem Innern wohnt ein Machtwillen, der seinesgleichen sucht. Erst im Bundesrat fand sie den ihr in diesem Punkt
- ii
- ebenbürtigen Partner, Justizminister Christoph Blocher. Mit ihm teilt sie nicht die politische Richtung, wohl aber den Machtinstinkt. Sie stimmt mit ihm darin überein, nicht übereinzustimmen, und gibt im gleichen Atem- zuge zu, dass er für ihren Machtpoker unentbehrlich ist: «Weil ich selber kämpferisch bin, brauche ich doch auch Gegenspieler.» Von Blocher wird sie dafür respektiert. Dies wiederum findet sie nicht selbstverständlich. Oft genug in ihrer Karriere hatten ihr Vorurteile von Männern zu schaffen gemacht. «Frauen in Führungspositionen», so Calmy- Rey, «laufen noch immer den gängigen Denkmustern zuwider, vor allem, wenn sie die Macht ungeschminkt und entschlossen ausüben.» In diesem Punkt versteht sie sich mit Blocher besser als mit Moritz Leuenberger. Ihr unverstellter Machtinstinkt ist für ihren SP-Kol- legen befremdlich. Der Theologensohn hatte gegen Ge- nossinnen ihres Schlages von jeher seine Vorbehalte. Schon die ersten Politikerinnen, denen der junge Prä- sident der SP Zürich und Anwalt der 68er Generation begegnete, waren in seinen Augen «meistens Macho- Typen». Er sei das genaue Gegenteil von ihnen, behaup- tete er - «ein feministischer Politiker». Er betonte seine Schwächen. Seine erste Frau war Psychiatriepflegerin, einer seiner engsten Freunde war Psychiater. «Ich habe», schwor Leuenberger, «an Machtausübung keine Lust.» Regieren bereite ihm weniger Spaß als Opponieren: «Ich trample nicht gern von oben, ich stichle lieber von un- ten.» So machte er für sich Reklame und - scheinbar widerstrebend - Karriere. Getrieben von für ihn selbst
- ii
- merkwürdigen «Ehrgeiz-Schüben», stieg der Machtkriti- ker zur Machtelite auf: Gemeinderat, Nationalrat, Regie- rungsrat, Bundesrat. Heute sitzt er ganz zuoberst und wirkt ratlos. Er leidet unter der für die Schweizer Politik typischen Symbiose von Macht und Gegenmacht, mit der er aller- dings anders umgeht als seine Parteikollegin. Das Dop- pelgesicht der SP als Regierungs- und Oppositionspartei belaste ihn, klagt er, psychisch. Er sucht sich der Dialek- tik von Macht und Gegenmacht zu entziehen, indem er zu den andern Menschen wie zu sich selbst in ironischer Distanz verbleibt. Dabei verfängt er sich stets erneut im Zirkel der Selbstbeobachtung. Nirgends ist er mit sich und der Welt zugleich im Einklang. Dies gibt ihm Witz und Selbstzweifel, macht ihn jedoch einsam und oft so traurig, wie nur Clowns sein können. Im Bundesrat hält er sich an Partner, die am Doppel- spiel ihrer Partei zwischen Regierung und Opposition genauso leiden oder sonst wie zwischen zwei Stühlen sitzen. Seine spektakulärste Unterstützungsaktion galt Kollege Samuel Schmid, der 2001 gegen den damaligen SVP-Oppositionsführer Christoph Blocher die Referen- dumsabstimmung für Auslandeinsätze von Schweizer Soldaten ganz knapp gewann: mit 51 Prozent Jastim- men. Zehn Tage vor dem Urnengang rügte der SP-Bun- despräsident den Stil von Blochers Neinkampagne als «menschenverachtend» - ein Tadel von höchster Warte, den Blocher niemals vergessen hat: «So viel sich meine Gegner in all den Jahren auch einfallen ließen, um mich kaputtzumachen - der absolute Höhepunkt ist und
- ii
- bleibt doch diese Erklärung des Bundespräsidenten von 2001, wer die Auslandeinsätze ablehne, sei verwerflich.» Bis hierher und nicht weiter - selbst Samuel Schmids Geduld kennt ihre Grenzen. Hartnäckig stellt er Interes- sen des Landes, wie er sie versteht, über jene der Partei, wie sie ihm vorbeikommt. Wiederholt ließ er die Partei- freunde im Stich - Uno, Gold, Asyl-, weshalb ihn Blocher auch als «halben SVP-Bundesrat» hinstellte. Micheline Calmy-Rey freilich gab als Bundesratskandidatin 2002 indirekt Blocher recht. «Wenn ich», sagte sie, «für die SP den Anspruch vertrete, dass das Parlament jemanden wählen müsse, der auch von der Partei getragen wird, dann sehe ich das für die SVP genau gleich. Man kann in einer Regierung nicht mit Leuten verhandeln, die in der eigenen Parlamentsfraktion keinen Rückhalt haben.» Nach ihrer Wahl musste sie mit Schmid natürlich doch verhandeln. Sie nickte lächelnd und blieb im Innern ernst, als ihr der Kriegsminister zu bedenken gab: «Ein Bundesrat hat doch eine Verantwortung, die sich mit den Bestrebungen einer Partei nicht deckt.» Er muss bei der Neuausrichtung der Armee auch kleine Schritte gegen die SVP-Fraktion, die ihn immer wieder desavouierte, regelrecht durchkämpfen. Im Grunde waren Partei und Regierung für Schmid einst deckungsgleich. Von klein auf sah er in der SVP «die Partei der Gemeindepräsidenten». Ihr trat Samuel Schmid, aufgewachsen als Sohn des Gemeindepräsiden- ten und Dorflehrers von Rüti bei Büren, mit 17 Jahren bei und wurde prompt mit 26 seinerseits zum Gemeinde- präsidenten gewählt. Schmid war und blieb eine orts-
- ii
- feste Anlage. Zwar hat er, seit er Tag für Tag nach Bern zur Arbeit fährt, mehr Personal und Budget unter sich als sei- nerzeit im Dorf, doch das abendliche Gespräch mit der Putzfrau über das Wetter lässt er sich auch im Bundes- haus nicht nehmen. Er ist der alte geblieben. Nur die Partei ist anders geworden. Sein Spielraum schrumpfte nach Blochers Wahl 2003 mit einem Schlag. Seitdem muss er - in Kerngeschäften der Partei - spuren. Werden seine Rüstungsprogramme von Blochers Synchronschwimmern im Nationalrat ver- rissen, darf Schmid nicht klagen. Er musste seiner Partei zustimmen, als sie mit Blick auf die Bundesratswahlen 2007 mit dem Gang in die Opposition drohte, sollte Blo- cher abgewählt werden. Schmid bejahte diese Taktik und ließ doch offen, ob dann auch er, wie gefordert, im Fall der Fälle wirklich ginge. Das Prinzip Verantwortung, wie er es versteht und ver- körpert, hat auf seiner Stufe ausgedient. Das verraten gerade seine rührenden Aufrufe zu mehr Gemeinsinn. Der Bundesrat bedürfe, so Schmid, «steter Betreuung, Pflege und Führung, aber auch Disziplin, damit unser System der kollegialen Konkordanz nicht zum System der kollegialen Konkurrenz mutiert». Ihm ist überhaupt die Verwilderung der Sitten zuwider: «Ohne Pflege der bürgerlichen Tugenden würde unsere Gesellschaft zu einem politischen Gerangel verschiedener Interessen- haufen verkommen.» Dabei hat auch er keine Wahl mehr. Samuel Schmid ist beim Gerangel der Magistraten um die Gunst der Medien an vorderster Front dabei. Mag er die Spaßgesellschaft
- ii
- auch kritisieren, so lässt er sich doch selber von PR-Pro- fis als - freilich antizyklisches und gerade deshalb erfolg- reiches - Medienprodukt vermarkten. «Bei der Hoch- wasserkatastrophe», erzählt VBS-Kommunikationschef Jean-Blaise Defago, «war er beispielsweise innert kürzes- ter Zeit vor Ort. Eine halbe Stunde nachdem ich ihn in- formiert hatte, stand er in Gummistiefeln im Büro. Den Helikopter hatte er bereits organisiert. Solche Begeben- heiten steigerten seine Popularität.» Heute sei Schmid «so etwas wie ein Landesvater». So wird alles, ob Katastrophe oder Staatsbesuch, zum Event; der branchenübliche Zynismus des Reputations- managements macht sich in den Vorzimmern sitten- strengster Bundesräte breit. Die Politik zerteilt sich auch in der Schweiz in eine Oberfläche fürs Publikum und eine Tiefenstruktur für Insider. Das Land wird von globa- len Trends eingeholt, die seiner direkten Demokratie di- rekt zuwiderlaufen. Dass dem Land, trotz sieben in der Regel guten, klugen Köpfen, die Regierung fehlt, kann nach allem nicht verwundern. Mit fiktiven Institutionen sind reale Probleme nicht zu lösen. Das Gesetz des Han- delns geht an Gremien über, die ohne politisches Man- dat arbeiten: Machtkartelle, Geheimklubs, Konzerne. Samuel Schmid ist der genaueste Beobachter der Schweizer Systemkrise und der beste Analytiker ihrer tie- feren Ursachen. Die Politik habe, sagt er, mit der übrigen Gesellschaft nicht Schritt gehalten - «auf der einen Seite das Fortschreiten der Globalisierung mit seinen Folgen in der Wirtschaft, auf der andern Seite die langsamere Entwicklung der Politik». Internet und Finanzströme
- ii
- «fast unvorstellbaren Ausmaßes» beeinflussten, «ohne dass sie demokratisch legitimiert wären, die Politik der Nationalstaaten». Er prophezeit: «Das wird uns in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen.» Die Ursachen der Krise liegen offen zutage, doch kommt ihnen die Regierung nicht bei. Dem Kollegium ist die Regierungsfähigkeit abhandengekommen. Seine Mitglieder leiden unter dem Phantomschmerz der ver- lorenen Macht.
- EINER GEGEN A L L E - W i e die Diskordanz im Kollegium die Oberhand gewinnt und wie die bürgerliche Mitte einstürzt-Christoph Blocher, Pascal Couchepin, Hans-Rudolf Merz
- Er will noch lange weitermachen, «bis 2026», sagt Chris- toph Blocher und bricht in sein wildes Kichern aus. Ro- bust gibt er sich daheim in Herrliberg schon bei Tages- anbruch. Der Volkstribun platscht magistral in seinen Swimmingpool. Er schafft sein Pensum in 25 Minuten: 500 Meter Brust, 100 Meter Rücken. Im Wahljahr 2007 lässt er sich beim Schwimmen zwar nicht mehr knipsen, anders als 2003, als er für den Pressefotografen jede Menge Runden drehte. Er verbot dann alle Bilder außer drei, die veröffentlicht werden durften. Auf den meisten Fotos sah er zu wenig staatsmännisch aus - nackte Brust, dunkle Brille, roter Bademantel, gelber Strohhut, ein Outfit für Las Vegas, nicht für Zürich und Umgebung. Heute geht das nicht mehr, man ist Bundesrat.
- ii
- Viel Pose ist bei ihm im Spiel. Der erfahrene Selbst- darsteller behält seine Bewunderer im Auge. Sie will er nicht enttäuschen. Vor ihnen gibt er sich keine Blößen. Ihnen muss er stark und unverwüstlich scheinen. Seine Freunde kennen ihn und seinen Zustand besser. Sie wis- sen, dass er auf sich achtgeben muss. Sein erster Kollaps liegt drei Jahrzehnte zurück. Im Bundesrat wundert man sich bisweilen über seine Konzentrationsschwächen. Trotzdem leistet der Mann die gewohnte Schwerarbeit - Christoph Blocher, wie er sich gibt und wie man ihn kennt. Er kennt keine Schonung, auch gegen sich selber nicht. Der Sechziger geht bis an die Grenzen seiner Kräfte und noch darüber hinaus. Seinen «Auftrag» erfüllt er mit - so weit hat er sich schon selbst durchschaut - «fast be- ängstigender Hingabe, zuweilen geradezu Besessen- heit». Nie lasse ihn sein Auftrag los, stets sei er «von der Sache angefressen», zu Recht, wie er sagt: Nur so ge- winne man doch «Kraft und Identität, erhält Durch- setzungsvermögen, weil man sicherer wird, hat Aus- strahlung, kann andere anstecken und begeistern». Ihm sind seine monomanen Züge bewusst. Er ist gewarnt und geht sich dennoch selber in die Falle. Überall sucht und findet er das einzig Wahre, das sich bei ihm zur fixen Idee verformt. In der Musik warf er sich auf Mozart - dessen Opern sah er schon in Hunderten von Aufführungen. In der Kunst auf Anker und Hodler - von ihnen besitzt er Hunderte von Ölbildern, Aquarellen, Zeichnungen und Skizzen. In der Literatur auf Karl Barth - dessen 700-Seiten-Buch Der Römerbrief verschlang er
- ii
- wieder und wieder. Was Blocher daran derart begeistert: «Barth übersetzte das Wort <Glauben> als <Zuspruch Got- tes). Wer sagt, <ich glaube>, empfängt also Gottes Zu- spruch.» Unter Berufung auf diese Barth-Stelle offen- barte der Justizminister einem seiner Direktoren eines späten Abends auf dem Berner Bundesplatz stehend wörtlich: «Ich bin in der Gnade.» Steht Blocher gar vor Publikum und sieht er die gläubigen Augen so vieler Menschen an seinen Lippen hangen, ist es um ihn ge- schehen. Ihm ist, als sei er einer für alle. Er ist Opfer einer Selbstberauschung. Birgt dies seine Gefahren, so hat es doch Methode, und zwar von Anfang an. Der ehrgeizige, doch mittellose Pfarrersohn musste, um gegen alle Wahrscheinlichkeit zu reüssieren, Scharfsinn und Wagemut beweisen. Blo- cher spekulierte erfolgreich mit der Hebelwirkung unter- schätzter Werte und Themen. Der angehende Jurist fand seine Bestimmung im Kampf gegen die aufmüpfigen Systemveränderer der eigenen Generation. Er bekämpfte die 68er, kopierte allerdings ihre Methoden: Tabus bre- chen, Polemik anheizen, ganz unzimperlich, wenn es der Sache dient. Er gründete und leitete eine konservative Gegenbewegung, den «Studentenring»; dabei schloss er Freundschaft mit Stephan Schmidheiny, Spross der be- rühmtesten Schweizer Industriellendynastie. Bis heute ist Blocher glühender Anti-68er geblieben. Sein Weltbild ist auch danach. Glaubten die 68er an Fortschritt, sieht Blocher «die Welt in Dekadenz», im Verfall. Er wurde konservativer Rebell, ein Paradox. Am liebsten hätte er jede geschichtliche Entwicklung aufgehalten, eine Uto-
- ii
- pie. Ihm passt die ganze Richtung nicht, angefangen bei der Französischen Revolution 1789 bis zu Europas Inte- gration und den Vereinten Nationen. Er widersetzt sich der Moderne, dem Lauf der Welt schlechthin. Seine Poli- tik ist der Versuch, die Schweiz auf der Weltbühne in eine Rolle zu bringen, die seiner ureigenen in der Gesell- schaft gleicht - das Gegen-den-Strom-Schwimmen als Staatsmaxime. Er bewährt sich als verkehrter 68er: Sys- temveränderung andersherum. Zur SVP ging er in den siebziger Jahren, als die Partei eine Niederlage nach der andern erlitt. Die Ems-Chemie kaufte der leitende Angestellte mit einem Bankkredit 1983, als das Unternehmen tief in den roten Zahlen steckte. Überall drängte er auf Sanierung und Kurswech- sel. Im Nationalrat blieb er lange Sonderling. Seine Volksinitiative für die Abschaffung der Sommerzeit ver- sandete 1984. Sein Referendum gegen das moderne Ehe- recht scheiterte 1985. Das Blatt wendete sich für Blocher erst durch die globale Expansion der Marktwirtschaft. Auf einmal war der Unzeitgemäße im Aufwind. In China baute er Dutzende von Synthesefaserfabriken. In der Schweiz eroberte er die durch die grenzüberschreitende Liberalisierung verängstigten Menschen, indem er gegen die Öffnung des Landes polemisierte. Die Europafrage war der lang ersehnte Hebel, mit dem er die Classe poli- tique herauszwängte. Nach dem EWR-Nein 1992 benö- tigte der Karajan der Neinsager elf Jahre, um Bundesrat zu werden. Seine Taktik war einfach. Er reizte die Linken ständig bis zur Weißglut, zielte dabei aber nicht primär auf sie,
- ii
- sondern auf die gemäßigten Rechten, die er durch Sei- tenhiebe als Anpasser bloßstellte. Hemmungslos schlug er Kapital aus der Orientierungskrise der Mitteparteien. Deren Wählerschaft, das liberale, staatstragende Bürger- tum, verlor durch die Globalisierung den Boden unter den Füßen; die alten Werte trugen nicht mehr. Bei der FDP fand Blocher seinen Meister nicht. Beide freisinnigen Bundesräte waren und blieben ihm unter- legen. Hans-Rudolf Merz und Pascal Couchepin spiegeln selber das Problem, dessen Lösung sie sein müssten. Beide wurden in gutbürgerliche Familien hineingeboren und erlebten durch Schicksalsschläge in jungen Jahren einen brutalen sozialen Abstieg. Sie verarbeiteten ihr Los jedoch gegensätzlich, ihren konträren Naturen folgend. Pascal Couchepin rebellierte. Der Sohn eines Anwalts, FDP-Großrats und Majors aus Martigny im SVP-Kan- ton Wallis wurde von seinem Verhängnis schon mit fünf Jahren ereilt: Sein Vater starb im Militär an einem Herz- infarkt. «Damit hörte meine Kindheit auf. Seitdem bin ich erwachsen.» Für ihn und seine Familie brach eine Welt zusammen. Sechs Monate nach Vaters Tod war alles weg: Auto, Geld, Ferien. Pascal reagierte «recht aufrühre- risch», wie er sich ausdrückt. Gott war tot. Daheim prü- gelte sich der Halbwaise mit dem älteren Bruder. In der Schule kämpfte er gegen die Lehrer. «Man muss», so Couchepin, «kein Meister der Psychoanalyse sein, um zu begreifen, dass dieses Verhalten mit dem Fehlen des Vaters zusammenhing.» Im Mannesalter erweiterte er seinen Aktionsradius in die Politik. Seine Lieblingsgegner waren CVPler. Mit
- ii
- 26 Jahren wurde er Mitglied der Stadtregierung, Anwalt und Ehemann, später Stadtpräsident, Nationalrat und Fraktionschef in Bern. Seit 1998 kennt man ihn als rauf- lustigen Landesvater, doch möchte er eher als Grund- satzpolitiker gelten. Der Titel seines Buches ist sein Vaterunser: Ich glaube an die Politik. In Wahrheit glaubt er an die Macht. Sein Lieblingsklassiker Niccolö Machia- velli (1469-1527) lehrte den Machterhalt mit allen Mit- teln. Hätte der Walliser Machtmensch den Glauben an die deklarierten Ziele der Politik noch ernster genom- men, dann hätte er sich der Frage aller Fragen stellen müssen: Wozu bei globaler Liberalisierung noch Frei- sinn? Couchepin, längst Doyen aller FDP-Spitzen, ver- säumte seine Hauptaufgabe. Er übersah, dass Macht in der Demokratie immer nur geliehen ist. Er ist ein star- ker Leser und Denker, doch sind seine Launen stärker. Der querulierende Regierende nervte vor und hinter den Kulissen mal diesen, mal jenen, über kurz oder lang fast alle, und wunderte sich anhaltend über sein nachhalti- ges Popularitätstief. Hans-Rudolf Merz tickt anders. Der geschmeidigere Außerrhoder mied, ehe es ihn mit 55 Jahren in die Politik verschlug, den Kampf um Macht. Er rebellierte nicht, er resignierte zunächst, als er in jungen Jahren den sozialen Abstieg erfuhr. Damals war der Sohn eines Herisauer Ge- meinderats und Textilfabrikanten knapp volljährig; das Familienunternehmen endete in einer Konkursliquida- tion; die Eltern beschlossen die Scheidung. Der Junior eines Gescheiterten hatte beim lokalen FDP-Filz keine Chance mehr. Als Ausläufer einer chemischen Reinigung
- ii
- verdiente er sich sein Studium an der Hochschule St. Gallen. Als Dr. rer. publ. blieb er in unselbständigen Funktionen: Uni-Assistent, FDP-Sekretär, Vizedirektor des UBS-Ausbildungszentrums Wolfsberg. Mit 35 Jahren holte ihn der autoritäre Wirtschaftsführer Max Schmid- heiny vom Wolfsberg weg, flachsend: «Das hier ist schade für Sie! Da unten werden Sie Frühstücksdirektor!» Fortan reiste der Berater für Max und Stephan Schmidheiny rund um den Erdball - 1,3 Millionen Flugkilometer in zwölf Jahren. Merz kehrte in die Schweiz zurück, als Ste- phan Schmidheiny 1989 die Eternit verkaufte und der Schmidheiny-Auftrag wegfiel. Der sesshaft gewordene Globetrotter kam ins Grü- beln. Merz schrieb eine 88-Seiten-Broschüre mit dem Titel Die außergewöhnliche Führungspersönlichkeit. Darin betonte der künftige politische Partner Blochers die «tief verwurzelte Sehnsucht des Menschen nach Autorität und Führung». Er erlag dem starken Mann wie in vorauseilendem Gehorsam - ohne Blocher schon zu kennen. Gute Führer, hob Merz hervor, seien «Menschen, die nie aufgeben» und «Rückschläge trotzig einstecken», sie könnten «Niederlagen in Siege verwandeln», Gefah- ren wehrten sie «heftig, oft brutal» ab, auf ihren Ent- scheid warte man «hingebungsvoll und aufmerksam», ihnen vertraue man sich in «unklaren oder ausweglosen Lagen blindlings» an, «man spürt die Aura». Merz nannte viele Beispiele, etwa Churchill und Dunant, aber auch Mao Tse-tung, dem «die Bildung der Volksrepublik China» gelungen, und Ho Chi Minh, dem «die Befreiung Indochinas» zu verdanken sei. So pries der selbständige
- ii
- Unternehmensberater aus Herisau die großen Führer und sprach kaum von ihren Opfern. Kein Wunder, war er später einer der ersten Schweizer Freisinnigen, die mit der autoritär geführten SVP ge- meinsame Sache machten: 1997 setzte sich Merz als Stän- deratskandidat in Außerrhoden mit Sukkurs der SVP ge- gen den offiziellen FDP-Bewerber, Landammann Hans Höhener, durch. 1999 gehörte Merz in Bern zu den weni- gen FDP-Ratsherren, die Blocher schon als Kandidaten gegen SP-Bundesrätin Ruth Dreifuss unterstützten. Und 2003 kam Blocher mitsamt Merz in den Bundesrat. Die erstarkte Rechte triumphierte. Im Regierungskollegium zog sie scheinbar neue Sai- ten auf. Blocher & Co. räumten mit der Kompromiss- politik alten Stils auf. Sie trieben die ehemaligen 68er und deren Weggefährten im Bundesrat in die Defensive. Die SVP- und FDP-Bundesräte, neu in der Mehrheit, su- chen nicht mehr endlos nach Konsens mit den Kollegen von SP und allenfalls CVP, sondern schreiten zügig zur Abstimmung. Das hat auf den ersten Blick seine Vorteile. Erstens zeigt die Regierung klares Profil. Zweitens dau- ern die Sitzungen weniger lang. Seit 2003 tagt der Bun- desrat nur noch 120 Stunden pro Jahr. In den 25 Vor- jahren hingegen saß er durchschnittlich 190 Stunden zusammen. Dissens sickert rascher durch als ehedem. Das nährt den Meinungsstreit in der Öffentlichkeit, was Blocher freut: «Die Konfliktfähigkeit wurde verbessert. Probleme werden diskutiert.» Dies zwar weniger im Bundesrat selbst. Unnötige Klausursitzungen entfallen. Umsonst
- ii
- schlug Moritz Leuenberger einmal vor, der Klimaerwär- mung eine Klausur zu widmen und zwei führende Ber- ner Wissenschafter, Thomas Stocker (Klimatologe) und Gunter Stephan (Ökonom), je eine Viertelstunde anzu- hören. Der Bundesrat verzichtete auf die Auftritte der Neunmalklugen. Das Kollegium arbeitet seit der rechten Wende spedi- tiver und doch letzten Endes weniger effizient, weil es für seinen Kurs die nötige Rückendeckung durch Parlament und Volk nicht erhält. Zu weniges ist deshalb geglückt. Zu vieles ist missraten: Steuerpaket, Swisscom-Privati- sierung, Avanti-Gegenvorschlag, Aktienoptionen für Mit- arbeiter, USA-Freihandelsabkommen und so weiter. Die rechte Mehrheit im Bundesrat kämpft in Rücklage. Sie kann sich gegen die totgesagte Schweizer Konkordanz oft nicht durchsetzen. Der Konsens ist merkwürdig zäh- lebig. Dass die Erfolgsbilanz der SVP/ FDP-Mehrheit nicht überzeugender ausfällt, ist kein Wunder, nur Logik. Sind nämlich die 68er bloß Auslaufmodelle, so gilt dies für die Anti-68er logischerweise genauso. Die Geschichte hat sich im Zuge der Globalisierung längst in neue Konflikt- zonen verschoben. Im Bundesrat liefern sich alte 68er und Anti-68er die Nachhutgefechte. Blochers Entzauberung bleibt nicht aus. Er ist zwar Meister in der Kunst, den Eindruck zu erwecken, er stehe über der Situation, in der er sich befindet. Eines aber hat der alte Kritiker der eidgenössischen Konkordanz zu wenig bedacht. Er hat deren historische Wurzeln ver- kannt. Die Konkordanz, also das gütliche Einverneh- men, ist in der Schweizer Geschichte mindestens so tief
- ii
- verankert wie die Neutralität, Blochers Mantra. Die Pro- portionalisierung des Bundesrats seit 1959 - im Grund- satz bis heute allseits unbestritten - ist Ergebnis jahr- hundertelanger Entwicklung. Schon die Bundesbriefe von 1291 und 1315 halten fest, dass bei Konflikten unter Eidgenossen die Erfahrensten und Klügsten den Streit schlichten und beilegen sollen. Auf der Tagsatzung war in wichtigen Fragen Einstimmigkeit erforderlich, was zu Kompromiss und Ausgleich nötigte. Heute zwingt die Referendumsdemokratie alle großen politischen Kräfte zum Zusammenwirken. Wer die Konkordanz zerstört, versündigt sich am Erbe der Väter. Die Geschichte schreitet auch über Blocher, 107. Bun- desrat seit 1848, hinweg. Schon findet er in seinen Reihen keinen Nachfolger, der ihm das Wasser reichen kann. Für ihn ist ungewiss, ob die Stoßkraft der SVP seinen Abgang überdauern wird. Die Partei, hebt er zwar hervor, sei kampferprobt, robust und in glänzender Verfassung. Ihm und seiner Bewegung sind auch in der Tat noch in der Spätphase kraftvolle Offensiven zuzutrauen. Sorge bereitet ihm indes bereits die Filzgefahr. Ihm sind Par- teifreunde suspekt, die auf Posten und Privilegien schie- len. Dies spricht Bände. Das Verantwortungsbewusst- sein ist in seinen Reihen offenkundig nicht abgestorben. Der lachenden SVP-Sonne im Strahlenkranz, von der Partei zum Sinnbild ihres Aufstiegs erwählt, läuft die Zeit davon. Der Tag neigt sich auch in Herrliberg einmal zum Ende. Ein letztes Mal für heute tritt der Hausherr mit Besuchern, diesmal SVP-Kameraden, mit denen er stun-
- ii
- denlang - über Blocher und wie er die Welt sieht - dis- kutiert hat, auf die Terrasse, um die Aussicht im Abend- glühn zu genießen, den Blick auf See und Bergwelt. Gewitternacht ist angesagt. Man lässt den Blick über die nahen Hügelketten schweifen, von Pfäffikon bis zum Albisgüetli. Christoph Blocher erklärt den Freunden die Landschaft und lenkt ihre Aufmerksamkeit zuletzt ins Unbestimmte. Bei guter Sicht wären dort hinten, versi- chert er und deutet Richtung Südwesten, sogar die Ber- ner Alpen zu sehen, Eiger, Mönch und Jungfrau nebst dem Rosenhorn, dem Gipfel oberhalb Schattenhalb, sei- ner Heimatgemeinde. Im Kreise der Getreuen den Blick unverwandt auf das längst im grauen Luftgebilde, in einem Wolkenmeer liegende Herkommen gerichtet, er- starrt er bei Sonnenuntergang nach und nach zum Denk- mal seiner selbst, im Geist der Nationalhymne. Der Bun- desrat erlebt in Herrliberg die Götterdämmerung.
- ALLE GEGEN E I N E - W i e s o eine Bundesrätin frühmorgens auf dem Balkon steht, das Land der ewigen Konkordanz mit der Seele suchend - Doris Leuthard
- Bern, 14. Juni 2006, 11.02 Uhr. Es ist so weit: Die neue Bundesrätin tritt nach Wahl, Amtseid, Glückwünschen und Küssen von wahren und falschen Freunden, Rempe- leien zwischen Leibwächtern und Reportern, geschätz- ten 25 Exklusivinterviews und gehetztem Stehempfang endlich und doch pünktlich aus dem Bundeshaus her-
- ii
- aus und winkt der jubelnden Menge lachend zu. Sprech- chöre erschallen, «Doris! Doris!». Doris Leuthard Hau- sin strahlt mit der Sonne um die Wette. Man feiert und bewundert sie, nur einer steht am Rand und wirkt be- drückt - ihr Mann. Er wendet sich fast flehend an eine Journalistin: «Ich teile gern, aber muss es unbedingt meine Doris sein?» Zu mir sagt er beklommen: «Sie gibt damit viel Freiheit auf. Die Frage ist, wie viel von der eigenen Seele sie dafür aufgibt.» Roland Hausin, promovierter Chemiker, kennt ihr Innenleben genau. Seine Sorgen wiegen schwer. Wer im Bundesrat sitzt, nimmt leicht genug Schaden an der Seele. Mürbe macht oft schon der stete Druck von allen Seiten - Wählern, Räten, Wirtschaft, Medien. Gift aber sind Ränke im Kollegium. Alt-Bundesrat Flavio Cotti, heute Präsident des Beirats von Credit Suisse, ist intimer Kenner der Intrigen in der Machtelite; er begleitet Doris Leuthard an ihrem Wahltag und speist beim Fest mit ihr am Ehrentisch. Eines sagt er erstaunlich exakt voraus: «Im Bundesrat werden zweieinhalb Mitglieder gegen sie sein.» Und zwar: «Calmy-Rey und Couchepin ganz, Blo- cher je nach Sachgeschäft.» Cotti hatte eine gute Nase. Die Kollegen, auf die er tippte, attackierten die Neue bei erster Gelegenheit. Mi- cheline Calmy-Rey machte ihr einen Sitz im Gouver- neursrat der Weltbank streitig und weigerte sich, ihr die Imageagentur «Präsenz Schweiz» abzutreten. Pascal Couchepin durchkreuzte ihren Wunsch, das Volkswirt- schafts- zum Bildungsdepartement umzubauen. Chris- toph Blocher bekämpfte ihren Plan, den Handel mit der
- ii
- EU weiter zu liberalisieren (Agrarfreihandel, Anerken- nung technischer Produktenormen). Das Kollegium pfiff sie zurück, als sie fünf Tage Vaterschaftsurlaub für das Personal ihres Departements ankündigte. Doris Leuthard fand alles halb so schlimm. Sie hatte nichts anderes erwartet. Ihr war klar, dass «der Parteien- wettbewerb groteske Züge angenommen» hat. «Bundes- räte», erklärte sie noch kurz vor ihrer Wahl, «mischen munter im Parteien- oder persönlich geprägten Hick- hack mit», auch im Kollegium politisiere man leider «nicht mehr zum Wohl der Schweiz». Heute darf sie, sel- ber Bundesrätin, vieles nicht mehr deutlich sagen. Wird die einzige Christdemokratin der Siebnerrunde trotz- dem darauf angesprochen, lacht sie vielsagend auswei- chend. Ihre Lage ist gefahrvoll. Die Vierzigerin denkt und empfindet vielfach anders als die sechs Sechziger, die sich mit ihr in Amt und Würden teilen. Die Mitregenten könnten ihre Eltern sein. Die Denkschablonen der rüsti- gen Kollegen sind ihr fremd; sie wird neue benötigen. Doris Leuthard vertritt eine Generation, der die Streite- reien alter 68er und Anti-68er nichts mehr sagen, ge- nauso wenig wie steriles Gezänk anderer überlebter Richtungen. Ihr fehlen die ideologischen Befangenhei- ten der Kollegen; sie wird sich eigene zulegen. Ihr er- scheint Konflikt, der dem Schwarzweißdenken früherer Epochen entspringt, generell sinnlos: Markt oder Staat? Freiheit oder Sozialismus? Erste oder Dritte Welt? Doris Leuthard spürt: Nach dem Entweder-oder-Schema ist die Komplexität des 21. Jahrhunderts nicht zu meistern.
- ii
- Altersvorsorge, Krankenversicherung, China, Sicherheit, Gen und Internet verlangen mehr als ein Ja oder Nein. Die wahren Fragen lauten anders, genauer. Doris Leuthard formuliert sie zum Beispiel so: «Welche Rolle können unsere Nation und unser Kontinent in Zukunft spielen, wenn über eine Milliarde Chinesen billiger und vielleicht auch besser produzieren als wir? Welches Wirt- schaftssystem wird unsere Bevölkerung dereinst mit- tragen, wenn große Teile der Bevölkerung den Eindruck haben, der Wert menschlicher Arbeit werde immer un- gleicher und immer ungerechter bemessen?» Ohne Zwei- fel Fragen von Gewicht - denn auch Leuthard selber kennt die Antworten nicht. Sie sucht ihren eigenen Re- formhorizont. Geschickt hat sie ihn für sich ins Jahr 2030 verlegt; sie ließ in der Partei breite Debatten über die «Vision Schweiz 2030» vom Stapel. Am Zahltag ist sie 67-jährig und, möglicherweise, Alt-Bundesrätin. Manches bleibt bei ihr in Schwebe. Freund und Feind irritiert, dass sie für ihre Partei so atypisch ist. Zwar entstammt sie einer eingesessenen CVP-Familie aus katholischen Stammlanden; sie ist Tochter eines christlichsozialen Ex-Gemeindeschreibers und -Groß- rats aus Merenschwanden. Doch gab es früh einen fei- nen Riss zwischen ihr und ihrem dörflichen Umfeld. Doris Leuthard entdeckte für sich die Globalisierung, als ihr Zukünftiger drei Jahre in Kanada studierte und Che- miemanager wurde. Die Jus-Studentin in Zürich war be- geistert. Sie schwärmte von Amerikas Optimismus und flog alle drei Monate zwischen Neuer und Alter Welt hin und her.
- ii
- So wurde sie Bürgerin zweier Welten - der lokalen ihres Herkommens, der globalen ihres Partners. Er stieg beim amerikanischen Konzern Dow Chemical mit europäischem Sitz in Horgen zum Chef der Labor- automatisation auf. Ohne Trauschein lebten beide während zwanzig Jahren im Freiamt problemlos zu- sammen - ihr katholisches Milieu war nicht mehr, was es einmal war. Sie heirateten 1999 nach Bekannt- werden der überraschenden Fusion der US-Chemie- riesen Dow und Union Carbide, schockiert von der Rücksichtslosigkeit amerikanischer Topmanager, wel- che die Streichung von weltweit 2000 Stellen ankün- digten. Doris Leuthard wurde «langsam ein bisschen antiamerikanisch». Sie ärgerte sich über Präsident George W. Bush und Amerikas Selbstherrlichkeit. Be- geistert war sie von der kundigen Kritik des früheren SPD-Bundeskanzlers Helmut Schmidt an der Globali- sierung. Sie verschlang sein Buch zum Thema gleich zweimal. Die Aargauerin gab auf ihre Weise Gegensteuer. Sie warf sich für die CVP kraftvoll ins politische Getümmel. Ihre Linie: Ja zur Liberalisierung, aber bitte sozial. Je mehr der konfessionelle Kitt indessen bröckelte und je rascher die Partei alterte und sich selbst überlebte, desto schneller erblühte Leuthard zu ihrem Superstar: 1999 Nationalrätin, 2001 Vizepräsidentin, 2004 Präsidentin, 2006 Bundesrätin. Alles ging der neuen Parteimutter selbst zu rasch. Die angenehme Erscheinung übernahm ein abgewirtschaftetes Unternehmen mit unübersehba- rem historischem Ballast. In ihren Augen ging es für die
- ii
- CVP um Sein oder Nichtsein. Leuthard stellte vor und hinter den Kulissen alles, aber auch alles in Frage. Sie er- wog ernsthaft eine Fusion mit der FDP. Seit dem Fiasko der Metzler-Abwahl durch FDP und SVP 2003 haben Leuthard und ihre Freunde nach eigener Meinung keine Wahl mehr. Die Partei will zunächst so viel Kraft zurück- gewinnen, «dass sich die Frage nach einem zweiten CVP-Sitz im Bundesrat stellt», wie Leuthard erklärte. Sie setzte ihrer Partei dafür auch schon die Frist: «bis 2011». Seitdem wird die schnelle Christdemokratin an allen Ecken von freisinnigen Angstbeißern angefallen. Der Lu- zerner Georges Theiler bellte, als sie 2006 für die Nach- folge von CVP-Bundesrat Joseph Deiss kandidierte und sich einem Hearing in der FDP-Fraktion stellte: «Sie wol- len der FDP doch einen Sitz stehlen!» Leuthard gab zu- rück: «Um Bundesratssitze müssen FDP und CVP ja nur im schlechteren Fall konkurrieren. Legen wir beide zu, geht es der Schweiz besser. Kämpfen wir doch beide da- für!» Es kam anders - nichts mit Minne in der Mitte. Kaum war Doris Leuthard gewählte Bundesrätin, hatte sie Pas- cal Couchepin im Genick. Rang er mit ihr um Bildungs- fragen oder Arzneimittelpreise, schwang beim freisinni- gen Walliser - mal leiser, mal lauter - ein Unterton mit. Sah er schwarz, dann sah er rot. Er muss die klerikale Arroganz immer nochmals brechen und - wie seine Ah- nen nach der Französischen Revolution - die Herrschaft der Oberwalliser Zehnden stets aufs Neue überwinden. Er ist in die Vergangenheit vernarrt. So nimmt er auf seine alten Tage den Journalisten mit
- ii
- hinauf in seine geschichtsträchtige Wohnung neben dem Berner Münster. Das Sechs-Zimmer-Appartement liegt im zweiten Stock des Von-Wattenwyl-Hauses, des offiziellen Gästehauses der Landesregierung. Tritt der Hundert-Kilo-Hüne mit der barocken Knollennase über die Schwelle seiner Wohnung, erwacht das Ancien Ré- gime zu neuem Leben. Der Magistrat passt ideal ins Patrizierpalais - ein alternder Junker, der seine Perücke nur gerade nicht aufhat. Kramt er aus einer alten Holz- truhe einen wertvollen handgeschriebenen Original- brief von Jean-Jacques Rousseau hervor, um ihn wie eine Reliquie mit scheuer Ehrfurcht und Kennermiene dem Gast vorzuzeigen, ist alles beisammen. Der frei- sinnige Landesvater möchte in den Spuren des Weg- bereiters der Französischen Revolution wandeln. War Rousseau aber für seinesgleichen beispielgebend, dann nicht durch seinen historischen Rang oder revolutionä- ren Geist, nur durch seine widersetzliche Natur. Der radikaldemokratische Feudalherr schwelgt am Berner Wohnsitz in der Aura großer Vergangenheit und merkt nicht, wie verwundert die gemalten gnädigen Her- ren in den güldenen Rahmen an den seidenen Tapeten auf sein in ihren Augen leeres Treiben herabblicken. Die früheren Hausbewohner schrieben fürwahr Geschichte. Auf Europas Schlachtfeldern verspritzten sie ihr Blut für eigene Ehre und fremde Mächte. Sie fochten 1521 in der Picardie, 1531 vor Kappel, 1712 bei Villmergen. Alexander von Wattenwyl bewährte sich 1750 als Oberstleutnant in Holland. Albrecht Rudolf von Wattenwyl fiel 1812 für Na- poleon bei Smolensk.
- ii
- Und Hans Schaffner kämpfte 1957 gegen Brüssel; der freisinnige Staatsmann, letzter berühmter Bewohner des Hauses, hielt das Land aus der damals entstehenden EU heraus. Er integrierte die Schweiz im Nachkriegs- europa nur wirtschaftlich, nicht politisch; dafür schaffte er den Beitritt zum Welthandelsverein Gatt (heute WTO). Der Von-Wattenwyl-Hausmieter (1948-82), Direk- tor der Handelsabteilung (1954-61) und FDP-Bundesrat (1961-69) machte den Kleinstaat zur liberalen Trutzburg im christlich-demokratisch-sozialistischen Europa. Er setzte industriellen Freihandel durch, ohne den weltweit einzigartigen Agrarprotektionismus preisgeben zu müs- sen. Damit hatte das Land, wie Schaffner glaubte, «den Fünfer und das Weggli». Schaffner konnte die Schweizer Extrawurst nur be- haupten, weil er auf Tuchfühlung mit Amerika blieb. Switzerland als liberale Insel inmitten der Alten Welt wurde von der liberalen Großmacht der Neuen Welt re- gelrecht verwöhnt. Schaffner durfte die wichtige Gatt- Ministerrunde präsidieren, welche die Kennedy-Runde aufgleiste. Später widerfuhr ihm die seltene Ehre, dass die einzige Rede, die er bei einem USA-Besuch gehalten hatte, auf Antrag von Senator Robert Kennedy ins Proto- koll des Senats aufgenommen ward; Robert Kennedy rühmte Schaffners «Schlüsselstellung» in der internatio- nalen Wirtschaftspolitik; er hob die Wertschätzung der amerikanischen Führungsrolle durch Schaffner hervor. Hinter den Kulissen verständigte sich Schaffner mit George Ball, der als US-Verbindungsmann die politische Einigung Westeuropas vorantrieb; Ball assistierte dem
- 46
- europäischen Gründervater Jean Monnet und riet dem Prinzen Bernhard der Niederlande, ein vertrauliches Treffen der westlichen Machtelite einzuberufen. Die damaligen Topmanager, Politiker und Meinungsmacher trafen sich erstmals 1954 im Hotel de Bilderberg in den Niederlanden; seither konferieren sie jährlich von neuem, stets in einem andern Land. In den diskreten Kreis der Bilderberger, der David Rockefeller und Henry Kissinger einschloss, sind später auch die Bundesräte Kurt Furgler und Flavio Cotti aufgenommen worden, Jean-Pascal Delamuraz und Pascal Couchepin. Speku- lationen schießen ins Kraut. Die Bilderberger stehen im Ruf einer Art Weltverschwörung. Sie sind unter sich aber durchaus nicht immer einig. Der einzige Schweizer der letzten Jahre, der an Bilder- berger, Rive-Reine- und Bundesratssitzungen zugleich teilnahm, Pascal Couchepin also, kann vergleichen. Am anregendsten waren für ihn die Bilderberger Treffen: originelle Ideen prominenter Figuren. Er bewundert Kissinger, seit er mit ihm bei den Bilderbergern am Früh- stückstisch ein langes Gespräch hatte. An den Rive- Reine-Tagungen in Vevey schätzt Couchepin die Kon- takte mit Schweizer Topmanagern: «Da höre ich, wie gewisse Leute denken - wenn sie denken.» Was Bundes- ratssitzungen für Couchepin wichtiger, aber oft schwie- riger machten, waren ihre inneren Zwänge. «Der Bun- desrat ist doch der letzte Sowjet der Welt - eine Kollegialregierung, wie es sie nirgends mehr gibt!» - Im Staate Schweiz ist tatsächlich etwas faul. Gremien und Organe, die die Verfassung mit keiner Silbe erwähnt,
- 47
- spielen eine Rolle. Im Zwang zur kollegialen Zusammen- arbeit im Bundesrat liegt womöglich doch mehr Weis- heit, als Couchepin vorzugeben beliebte: Ichbezogene Mitglieder haben es dadurch schwerer. Hart prallten schon Hans Schaffner und Kurt Purgier in Bern aufeinander. CVP-Nationalrat Furgler forderte 1968 auf lange Sicht einen EU-Beitritt mit Neutralitäts- vorbehalt. Bundesrat Schaffner blieb beim Nein zum Beitritt und zitierte aus dem Buch Disziplin der Macht des ehemaligen US-Unterstaatssekretärs und Bilder- berg-Inspirators Ball, der Europas Neutralen mit Zu- stimmung Schaffners eine Sonderstellung zuwies. «Ich war», so Ball, «in der Tat der Meinung, dass ein Beitritt neutraler Staaten auf rein wirtschaftlicher Grundlage den politischen Gehalt der gemeinschaftlichen Ziele ver- wässere und so dem Fortschritt zur Einheit hinderlich sein müsse. Diese Einstellung brachte mich in große Schwierigkeiten in den Hauptstädten einiger neutraler Staaten, so vor allem in Schweden und in der Schweiz. Ich bin aber nach wie vor überzeugt, dass meine Ansicht richtig war und immer noch richtig ist, und hoffe, dass unsere Regierung weiterhin diese Linie verfolgen wird.» Der Souverän wurde über die damaligen Weichenstel- lungen nie informiert, geschweige denn konsultiert, doch entfalten sie noch heute ihre Wirkung - durch die Macht des Faktischen. Das Land wurde wohlhabende Hochpreisinsel. Verlierer waren die Konsumenten, Ge- winner die Produzenten, freilich nicht alle. Bauernfami- lien machten sich langfristig unerfüllbare Hoffnungen. Dafür konnte die forschende Pharmaindustrie mit hohen
- 48
- Schweizer Referenzpreisen für ihre global produzierten Arzneimittel kalkulieren. Hans Schaffner wurde Verwal- tungsrat des Sandoz-Konzerns, doch seine Nachfolger im Volkswirtschaftsdepartement hatten und haben mit seinem Erbe ihre Mühe. Wie Kurt Furgler nahm noch Doris Leuthard anfangs das Ziel EU-Beitritt ins Visier. 1999 erklärte sie ohne Wenn und Aber: «Der Beitritt ist wirtschaftlich wie auch poli- tisch richtig.» Wie Furgler musste auch Leuthard zurück- buchstabieren, weil «die Schweiz auf dem bilateralen Weg einen Großteil dessen erreicht hat, was andere mit einem Beitritt viel teurer bezahlen mussten». Das Nicht- erreichte strebt sie über Ersatzlösungen an: Parallel- importe, Agrarfreihandel. Sie will die Hochpreisinsel schleifen, Kartelle kippen, Medikamentenkosten senken und die Einfuhr von EU-Gütern mit abweichenden tech- nischen Normen auch einseitig zulassen. Peanuts, gemessen an den Aufgaben, die sie für sich und die Schweiz vage vorausahnt. Das Land habe, weiß sie, «die Rezepte für die Bewältigung der kommenden Herausforderungen nicht einmal angedacht». Die Schwä- che der politischen Mitte ist für sie Alarmzeichen genug. Das Volk hat seinen Seelenfrieden nicht. Das gilt auch für die Bundesrätin selbst. Noch ist die Seele unverloren, um die ihr Mann so bangt. Vieles ist indessen nicht in Doris Leuthards Hand. Bern, 5- Januar 2007, bei Tagesanbruch. Erstmals im neuen Jahr geht die einsamer gewordene Magistratin bei «wunderschönem Morgenrot» ins Büro. Auf dem Balkon des Ostflügels des Bundeshauses genießt sie staunend
- 49
- den Sternenhimmel. Sie lässt die große Ruhe von oben auf sich wirken, und sie spürt: «Wir sind nicht allein.» In den Sternen steht zwar nicht geschrieben, wie die Politik wieder handlungsfähig und die Mitte erneut zur prägen- den Kraft des Landes zu machen ist. Doch liegt eine erste Antwort auf der Hand: Für den Bundesrat wäre es schon ein Fortschritt, bestünde er aus Kollegen, die miteinan- der zusammenarbeiten möchten. So wünscht sich Doris Leuthard höflich ein gutes neues Jahr und macht sich einfach einmal an die Arbeit.
- III Die Konzernchefs auf dem Weg zur globalen Macht WIE MARCEL OSPEL mit Kollegen die alte Garde entmachtet, die finanzielle Weltrevolution vorantreibt, die Politik abschafft und die Risikogesellschaft einführt
- Er beherrscht ein Weltreich, es geht ihm gut, danke, doch es könnte ihm besser gehen. Marcel Ospel, Kleinbasler Kleinbürgersohn und Oberhaupt der größten Bank der Schweiz sowie allergrößter Vermögensverwalter der gan- zen Welt, steckt sich die siebte Philip Morris an und gibt den ersten Fehler zu. Er hat sich in der Globalisierung getäuscht. Sie läuft anders, als er dachte: nicht so rasch, nicht so weit und nicht so rund. Um die Jahrtausendwende sah er für sich und seine Gilde keine Grenzen. In London verkün- dete er kurz und bündig: «The financial revolution is global.» Der UBS-Chef glaubte, die Geldbranche werde dereinst weltweit wie die Ölindustrie strukturiert sein: «einige sehr große elektronische Bankunternehmen, die am Rande von einer kompetitiven Gruppe kleinerer Ni- schenplayer herausgefordert werden». Inzwischen aber hat der Trend umgeschlagen. Die totgesagten Mittel- großen leben länger. Überall, klagt Ospel, handelten die staatlichen Regulatoren «zunehmend nationalistisch». Dies ändert für sein Business alles. Der UBS-Verwal- tungsratspräsident wollte im Investmentbanking bereits
- 51
- 2008 weltweit Nummer eins sein - eine Illusion. So viele Siege er auch erfocht, er überschätzte seine Kraft. Nun muss er umdenken, will aber nicht nachlassen. Der mo- netäre Athlet hat den Bogen überspannt, der wachsende Gegendruck zwingt ihn, seine Kräfte zu verdoppeln. Er drückt den Glimmstengel in halber Länge aus und strotzt vor Tatendrang. Im Innern der Bank treibt er seine Manager zum Äußersten. Ihnen sagt er ins Gesicht, er hasse es zu sehen, wie Goldman Sachs die UBS laufend aussteche oder wie andere Konkurrenten, von denen man dachte, sie lägen bereits auf ihren Totenbetten, etwa Credit Suisse und Morgan Stanley, plötzlich zu neuem Leben erwacht seien - und wie. Ospel fragt seine Top- kader spitz, ob die Konkurrenz denn einen Zaubertrank entdeckt habe oder ob man vielleicht selber nicht mehr am Ball sei. Er könnte den lieben Mitbewerber natürlich auch per- sönlich fragen. Brady Dougan, Credit-Suisse-Chef, arbei- tet in Zürich gleich um die Ecke, am Paradeplatz, wenige Schritte von Ospels Hauptsitz an der Bahnhofstraße ent- fernt. Auf so vertrautem Fuß aber stehen die beiden nicht. Ospel kennt den neuen Mann aus Amerika noch wenig. Dessen Denkrichtung freilich kennt er umso bes- ser. Mit Hilfe von Bankern dieses Typs aus dem Chicago der achtziger Jahre - Geburtsstätte der neuen Finanz- derivate - hatte auch Ospel den damaligen Bankverein unterwandert und erobert. Ospel bewunderte stets ihre Unternehmenskultur. Sie war für ihn «in ihrer intellek- tuellen Redlichkeit fast schmerzhaft». In Chicago gab es Firmen voll von jungen Leuten in Jeans, T-Shirts und
- 52
- Turnschuhen, doch mit einem «Können, das ich vorher nirgends gesehen hatte». Nun ist im Mai 2007 also einer dieser Sorte bei der CS sogar die Nummer eins geworden - das letzte starke Stück des alten Oswald Grübel, seines Vorgängers, der bei der CS noch heute ein und aus geht und einfach keine Ruhe geben will. Grübel ist es zuzuschreiben, dass die CS plötzlich wieder so lebendig ist. Noch ist die lokale Rivalin zwar mit Abstand kleiner als die UBS, aber genauso gefräßig und im Augenblick leider schnel- ler. Oswald Grübel verriet Ospel seine Pläne nie, auch nicht, als er zur Rive-Reine-Geheimkonferenz vom Fe- bruar 2007 am Nestle-Hauptsitz in Vevey zufällig im sel- ben Moment wie sein Rivale eintraf. Die beiden Super- banker fuhren mit dem Lift gemeinsam in den sechsten Stock, doch auch hier behielt Grübel alles für sich - sei- nen bereits feststehenden Abgang, den Namen seines Nachfolgers. Ospel und Grübel sind einander ein halbes Leben lang auf den Fersen geblieben und doch nicht nähergekom- men. Kalte Rechner großen Stils, waren sie einander von Beginn an zu ähnlich. Beide waren in engen Verhältnis- sen aufgewachsen und früh vom schnellen Geld geblen- det. Auf kürzestem Weg drängten sie in die Branche: ohne Uni, allein mit Banklehre. Sie blieben frei von den Denk- schablonen der studierten Kollegen und mussten, um zu avancieren, auch mehr riskieren. Bereits 1970 eilte jeder für sich nach London, mitten ins Herz der Weltfinanz - der 20-jährige Ospel noch als Sprachschüler, der 27-jäh- rige Grübel schon als Wertschriftenhändler. Sie fieberten
- 53
- mit den Freunden von der City nach Entfesselung des großen Geldes. Ihre gerissensten Kollegen waren längst am Werk; sie bedienten US-Konzerne, die über die Regierung in Washington verärgert waren. Die amerikanischen Ma- nager wehrten sich gegen eine Zinsausgleichsteuer, die Präsident John F. Kennedy 1963 eingeführt hatte, um den Abfluss von Dollars ins Ausland zu bremsen. Sie vermie- den die lästige Steuer, indem sie - nicht illegal, nur nicht patriotisch - für Dollaranleihen nach London auswichen. Hier sprangen ihnen findige Geldmänner bei, zu denen später auch Gräbel und Ospel gehörten. So entstanden in London die übernationalen Märkte, die den Erdball erobern sollten. Sie entzogen sich staatlicher Kontrolle. Sie schlugen den Aufsehern, Notenbankern und Steuer- beamten im Weltmaßstab ein Schnippchen. Ihr Treiben war folgenschwer. Sie unterliefen das System der festen Wechselkurse, das von den westlichen Alliierten 1944 in Bretton Woods (USA) errichtet worden war. Die alte Ord- nung brach zusammen. Die Freigabe der Wechselkurse 1973 besiegelte ihr Schicksal. Vordem hatten die Regie- rungen den Außenwert der Landeswährung beschlos- sen. Seitdem bestimmen Angebot und Nachfrage, was Dollar, Franken, Yen & Co. wert sind. Die Globalisierung hatte fortan freie Bahn. Was in der Geldbranche begann, erschüttert längst auch die übrige Wirtschaft. Die Revolutionäre siegten nicht kampflos. Gegen- kräfte traten auf den Plan. Macht- und Richtungskämpfe spalteten die Finanzer. Die Patriarchen wehrten sich fürs Alte. Ihnen war die Gier der Grünschnäbel zuwider. Her-
- 54
- mann J. Abs, Übervater der Deutschen Bank, warnte die Newcomer davor, mit ihrem «ungesunden» Treiben «das Zahlungsbilanzgeiüge der westlichen Welt durcheinan- derzubringen». Oswald Grübel, einer seiner abtrünnigen Mitarbeiter, pfiff darauf. Das Raubein, Jahrgang 1943, im untergehenden Hitlerdeutschland geboren, folgte immer seinem Kopf. Seine Eltern waren im Krieg ums Leben gekommen. Der Vollwaise wuchs bei Großeltern in der DDR auf. «Junge», riet ihm der Großvater, «du musst zur Bank, die haben immer Geld.» Seitdem hat Grübeis Leben eine Richtung. Er floh in den Westen zu den Banken. In Mannheim und Frankfurt arbeitete er bei der Deutschen Bank, in Zürich und London bei White Weld, einer amerikanischen Investmentbank, die von der Credit Suisse gekauft wurde, der ersten Schweizer Großbank, die in die neue Finanzwelt vorstieß. Die CS beförderte den schlauen Fuchs zu ihrem globa- len Wundertier. Mit ihm behielt sie in diesem Business lange Zeit die Nase vorn. Doch zögerte die CS, sich auch im Innern zur globalen Bank umzubauen. Sie blieb zu lang ein Zwitter. Interne Widersacher fielen Grübel in den Arm. Seine Karriere war steil, doch kurvenreich. Er und sein langjähriger Chef Hans-Jörg Rudioff, Pionier des globalen Investmentbanking, des glamourösen Finan- zierungsgeschäfts für Konzerne (Kapitalmarktemissio- nen, Fusionsberatung, Großfirmenkredite, Wertpapier- handel), blieben innerhalb des CS-Imperiums ein Fall für sich. So verspielte die CS ihren Vorsprung, und Grü- bel wurde vom UBS-Rivalen Marcel Ospel überholt und scheinbar deklassiert. Entnervt warf Grübel 2002 im
- 55
- Streit mit CS-Konzernchef Lukas Mühlemann das Hand- tuch. Nun geriet die CS in Schieflage, und Mühlemann musste gehen. Die schlingernde Großbank holte Grübel zurück, setzte ihn auf seine alten Tage an ihre Spitze und gewann mit ihm wieder Kraft und Schwung. Nur logisch, reichte er den Stab an einen Brady Dougan weiter: Die Banquiers sind tot, es leben die Banker. Heute zählt die CS wieder zu den zwanzig wreltgrößten Finanzriesen, die UBS freilich sogar zu den ersten zehn. Ospel begann das Rennen später als Grübel, lief aber schneller und war früher am Ziel. Ihn beflügelte das Sprichwort «Schuster, bleib bei deinen Leisten». Es ist der Rat, den ihm der Vater gab, mit Grund. Der preisge- krönte Zuckerbäcker machte einmal einen Fehler. Lange handelte er erfolgreich mit Pudding- und Glaceformen, leitete Kurse für Hausfrauen in der ganzen Deutsch- schweiz und schrieb Kochbücher, etwa Ospels Creme- und Süßspeisenküchc («das beste Handbuch für feine Desserts»). Dann aber sattelte er zum Elektroingenieur um; im Krieg erfand er eine Anlage, die Mauerwerke ent- feuchten konnte, und zwar mit perforierten Kupferroh- ren; das Geschäft lief schlecht, weil Kupfer Mangelware war. Der Vater haderte mit sich im Stillen. Seinem schul- müden Marcel wollte er ein Gleiches ersparen, vermit- telte ihm eine solide Banklehre und schärfte ihm seine Lebensregeln ein. Der Stift tat bei der Basler Brokerfirma Transvalor, wie ihm geheißen, doch die Börse ließ sein Herz sofort höher schlagen. Das Auf und Ab der Kurse hielt ihn tagein, tag- aus in Atem, anders als die andern Stifte. Im Saal hastete
- 56
- er mit Zetteln herum. Geschickt nutzte er Kursunter- schiede zwischen Börsen im In- und Ausland; damit ver- diente er «eine hübsche Stange Geld». An Börsen - das spürte er - war vieles, ja alles möglich. Dagegen fand er die Studentenbewegung und ihre Parolen belanglos. Kühl beobachtete er, wie Demonstranten 1969 in Basel die Tramschienen blockierten, um gegen höhere Billett- preise zu protestieren. Er wusste einen besseren Weg zur Selbstverwirklichung. Er strebte über das Banking nach Macht. Nicht dass ihn die Autoritäten der Branche überzeugt hätten. Sie waren ihm zu rückwärtsgewandt - auch die Präsidenten der UBS-Vorgängerbanken. So mahnte Alfred Schaefer (Grand Old Man der Bankgesellschaft): «Wir sind Treuhänder einer Volkswirtschaft», «ein Ban- kier sollte nie spekulieren». Samuel Schweizer (Bank- verein) warnte vor «abstraktem Gewinnstreben». Ospel dachte zum Teil anders, vermied jedoch - damals wie heute - überflüssige Grundsatzdebatten und fusionierte, Mann der Tat, nach zwei Jahrzehnten die beiden Banken. Auf dem Weg dahin musste er Schlachten schlagen, Widerstände brechen, Rivalen erledigen. Schwierig war schon der Einstieg. Marcel Ospel gab viele Jahre daran, überhaupt bei einer Großbank unterzukommen: Anlage- berater-Ausbildungskurs, Wirtschafts- und Verwaltungs- schule. 1977 hatte er endlich seinen Job beim Bankverein und baute für ihn das globale Geschäft auf. 1985 zerstritt er sich mit einem sturen Chef und wechselte zur US- Bank Merrill Lynch. Die Zeit arbeitete für ihn. Der Bankverein besann sich
- 57
- anders, richtete sich strategisch neu auf die globalen Märkte aus und holte Ospel nach zwei Jahren zurück - schon war er unentbehrlich. Mit Segen der Spitze krem- pelte er die Großbank um - von Kopf bis Fuß. 1996 stieg er zum CEO auf und heiratete das zweite Mal; seine Frau, Andrée Koechlin, war eine entfernte Verwandte des legendären Geigy-Chefs Carl Koechlin (1889-1969), eines Wirtschaftsführers von historischem Format. Die alte Ge- sellschaft fühlte sich vom jüngsten Großbankchef aller Zeiten herausgefordert. Er geriet alsbald zum Inbegriff des Global Players, Ikone und Hassobjekt in einem, an- scheinend bereit, alles dem Mammon zu opfern. Das Tempo irritierte. Nach der Fusion von Bankverein und -gesellschaft zur UBS 1997 folgte alsbald der nächste Streich: Durch den Kauf der New Yorker Finanzgruppe PaineWebber 2000 katapultierte Ospel die UBS und da- mit sich selber in die Weltliga. Er stieß in den boomen- den Markt reicher Privatkunden in Amerika vor. Der Schweizer Anteil schrumpfte in allen UBS-Bereichen: Kunden, Mitarbeiter, Manager, Aktionäre. Ospel erwarb übernationale Macht, doch unterschätzte er den Preis, den er dafür zahlen sollte - die schleichende Entfrem- dung vom Sitzland Switzerland. In seiner Stoßrichtung bestärkte ihn eine Doktoran- din, die für die UBS ein «wertorientiertes Entlöhnungs- modell» entwickelte. Sie forderte in ihrer Dissertation mit wissenschaftlicher Akribie mehr Lohn für gute Ma- nager und bat Ospel höflich, das Geleitwort zu schrei- ben. Um ihn war es geschehen. Begeistert schrieb er in ihre Doktorarbeit: «Ich bin überzeugt, dass der hier vor-
- 58
- liegende Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis sehr gut gelungen ist.» Ihre Theorie konnte er nicht schnell genug in seine Praxis umsetzen. Er ließ die Ma- nagerlöhne in die Höhe schießen und heiratete das dritte Mal - natürlich die brillante Ökonomin, die seine gehei- men Wünsche so gut verstand: Adriana Bodmer. Nun er- fährt die 25 Jahre jüngere Zürcher in an seiner Seite viel Luxus und ein bisschen Einsamkeit. In geselligen Run- den sagt ihr der Mann zum Trost, sie sei durch seinen Be- ruf ja oft allein, doch «wer viel fortgeht, kommt auch viel heim». Der Pendler zwischen Zürich, Basel, Wollerau, Chi- cago, London, Gstaad, New York und Singapur ist in Wahrheit überall und nirgends daheim - ein Wirtschafts- nomade der Sonderklasse. «Ach wissen Sie, ich merke sowieso bloß am Sonntagmittag, wo ich bin.» Marcel Ospel, abgründig einsam, ist oft ganz ehrlich. Den vier Kindern aus den zwei früheren Ehen war und ist der Bentley- und Ferrari-Fahrer, wie er gesteht, «kein Ideal- Papi». Einer der Söhne bestätigt: «Wir sind wie zwei Züge, die auf getrennten Gleisen aneinander vorbeifah- ren.» Im Grunde habe man sich wohl «nie kennenge- lernt». Die neue Ortlosigkeit der Weltgesellschaft prägt Ospels Alltagsleben längst. Er und die andern Global Player ließen festen Boden hinter sich, auch in ihrer Symbolsprache: Sie gingen mit ihren Konzernen offshore, also «weg von der Küste» - Schlüsselbegriff der Globalisierung. Sie umschifften Re- geln, die sich die Staaten des Festlands geben. Die T.JBS erkor, wie die CS, das Segeln zu ihrem liebsten Marken-
- 59
- zeichen, dabei läuft Ospels Bank heute «eher Gefahr, wie ein Öltanker auszusehen». Auf hoher See drohen dem Großadmiral des Weltkapitals nun Risiken, die er kaum abschätzen kann, Strömungen, die selbst seinen Riesen- tanker ins Trudeln bringen könnten. Er sieht sich vor, so gut er kann. Er weiß: Liefe sein Tanker auf Grund, erschiene da- neben selbst die Exxon-Valdez-Katastrophe «wie ein kleiner Autounfall». Er fürchtet unbekannte Gefahren, die durch die weitgehend unkontrollierten Hedgefunds drohen. Manager solcher Beteiligungsgesellschaften sammeln Milliarden und schlucken damit immer mehr Firmen, nur um sie in Windeseile zu sanieren und teu- er weiterzuverkaufen. Geriete ein großer Hedgefund in Schräglage, könnte er auch Banken mitreißen, mit schlimmen Folgen für den Rest der Wirtschaft. Die UBS, so Ospel, werde Abhängigkeit vermeiden müssen, sonst drohten ihr «immer mehr Risiken für immer weniger Ge- winn». Der Geldhai im eidgenössischen Karpfenteich setzt alles daran, das Risiko für die UBS zu begrenzen und vermehrt auf Dritte abzuwälzen. Muss gestorben werden, ist auf Marcel Ospel nicht zu zählen. Im pompösen Aschenbecher liegen am Ende des Ge- sprächs zehn sorgfältig ausgedrückte Glimmstengel wie kleine Leichen übereinander.
- 60
- WIE MARCEL OSPEL als VR-Präsident im Sitzland wieder politisch Fuß fassen will und sich durch seine Wertvorstellungen zugleich selber ausbürgert
- Wer den Schaden hat, braucht für Häme nicht zu sor- gen, am wenigsten der Bundesrat. Marcel Ospel war mit Neckereien zur Stelle, als die Regierung nach der «rech- ten Wende» 2003 ganz durcheinander war. Am Zürcher Sechseläuten produzierte sich Ospel als Tischredner und zog das Kollegium in gereimten Versen und bestem Ba- seldytsch stilvoll durch den Kakao: «D Wahl vom Chris- toph Blocher het doch ganz klaar beieggt, dass sich bis jetzt im Bundesroot z'wenig beweggt. Kuuin isch dr Christoph im Bundesroot, isch d SP nit nur - sy gseet au scho root.» Leuenberger sei «aimool mee bedroffe und baff», Schmid «hofft, dass er wenigschtens d Helfti vom Christoph schaff», bei Calmy-Rey wisse man «au nümm, öb si no lacht oder fescht uff d Zeen duet bysse». Keine Sache sei der Job für Merz, doch Couchepin sei «e ganz groosse, aimoolige Scherz». Ospels Späße bei der Zürcher Zunft zu Schmiden lie- ßen seinen innern Jubel ahnen. Endlich war die Classe politique auch im Inland so macht- und hilflos wie in weiten Teilen dieser Welt. Der Berner Kuddelmuddel dauert fort bis heute, und Ospel zieht nach vier Jahren Blocher im Bundesrat eine positive Bilanz. «Klar», so Ospel, «ist es um die Regierung etwas lärmiger gewor- den, doch muss das ja kein Schaden sein.» Ähnlich geht es im Ausland schon lange zu und her, und Ospel & Co. haben überall das Ihre dazu beigetragen. In sich gespal-
- 61
- tene Regierungen lassen sich besser manipulieren und, wenn nötig, ausmanövrieren. Das haben die globalen Finanzmärkte längst heraus. Sie trieben Staaten in die Enge, beschnitten ihre Spielräume und spielten sie als konkurrierende Standorte gegeneinander aus. Die Geld- branche bekämpfte, mit einem Wort, die Politik an sich. Auch Ospel hob in den neunziger Jahren hervor: «Ich liebe es nicht, in einem politischen Umfeld zu sein - wer tut das schon?» Er wolle, sagte er, «kein Saurier sein», kein Ewiggestriger. Er war als Geldprofi in seinem Ele- ment, solange er Vaters Ratschlag folgte und bei seinen unpolitischen Leisten blieb. Noch als CEO erklärte er sich entschlossen, «den politischen Virus» von seinem Umfeld fernzuhalten - ganz als spreche er von einer an- steckenden Krankheit. Der unpolitische Vollblutbanker blieb nicht mehr bei seinen Leisten, als er Alex Krauer 2001 ablöste und Ver- waltungsratspräsident wurde: Er traute sich nun doch eine Funktion zu, die auch ihre politische Dimension hat. Plötzlich sprach Ospel gewählter, gewitzter. Er be- herrschte das politische Handwerk nicht und hatte Mühe mit dem Volkszorn, der ihm nach dem Swissair-Groun- ding entgegenschlug. Das Dilemma der global ausgrei- fenden und lokal angefeindeten Bank ging Ospel unter die Haut. Er fraß Kreide, fuhr nach Bern und schmei- chelte den Parlamentariern der Gruppe Handel und In- dustrie plump: «Die Banken allein schaffen es nicht. Wir brauchen die Unterstützung der Politik.» Die Gewählten trauten ihren Ohren nicht. Ein neuer Ospel schien gebo- ren. Doch überlegte er wie eh und je strategisch.
- 62
- Der transkontinentale Hochseekapitän versicherte sich im Heimathafen nur seines Ankerplatzes. Er heuerte politische Lotsen an, zunächst CVP-Präsident Adalbert Durrer, den er an einer Rive-Reine-Tagung kennenge- lernt hatte. Der mundfertige Obwaldner hatte ihm in die- sem geschlossenen Kreis unumwunden widersprochen, als er, Ospel, wieder einmal über die Politik hergezogen hatte. Durrer sagte, das negative Bild, das Ospel von der Politik habe, sei verfehlt. Er, Durrer, erwarte von der Wirt- schaft nicht Ablehnung der Politik, sondern Engagement. Nachher wurde er von Ospel mehrmals konsultiert und in der Tat auch engagiert-als «Head Group Public Policy». Politisch versierte Köpfe holte Ospel sogar in die Kon- zernleitung. Zunächst Peter Wuffli, einen Wirtschafts- freisinnigen reinsten Wassers. «Die Wirtschaft«, forderte Wuffli, «sollte die Politik nicht vernachlässigen. Wir Ma- nager müssen bereit sein, einen Teil unserer Zeit in poli- tische Fragen zu investieren und versuchen, Einfluss zu nehmen. Sonst werden mit der Zeit nur noch die beiden politischen Extreme SP und SVP das Sagen haben.» Anders sah und sieht dies Ospel. Ihm bereiten schrille Töne in den Räten wenig Sorgen - Hauptsache, das Er- gebnis stimmt: «In allen Bundesratsparteien gibt es noch genügend Leute, die zur Mitte zählen. Aggregiert bilden sie in der Mitte einen starken Block.» Waren sich VR-Prä- sident Ospel und CEO Wuffli in der politischen Taktik uneins, so harmonierten sie doch persönlich während Jahren umso besser. Es schmerzten ähnlich tiefe Wun- den. Beide hatten je einen Bruder durch jähen Unfalltod verloren. Nach Ospels Auskunft ertrank sein Bruder ganz
- 63
- rätselhaft - er sei ein glänzender Schwimmer gewesen - im Meer. Wuffli war siebzehnjährig, als sein Bruder ums Leben kam. Drei Jahre später traf Wuffli noch ein zweiter Schlag. Aus nächster Nähe erlebte er mit, wie sein Vater bei der CS die Hauptverantwortung für den Chiasso- Fluchtgeldskandal 1977 zugeschoben bekam und über die Klinge springen musste. Der Wirtschaftsstudent litt unter der Demütigung des Vaters. Peter Wuffli bekam ei- nen Begriff von der Macht des Zufalls und der Willkür in der Wirtschaft, aber auch von der Bedeutung politisch korrekten Geschäftsgebarens. In seiner steilen Karriere (McKinsey, Bankverein und UBS) versuchte Peter Wuffli immer auch ethischen und staatsbürgerlichen Maßstäben zu genügen. Gerade des- halb musste er am Ende an den Widersprüchen zwi- schen Politik und Geschäft scheitern. Schuf er einen Wirtschaftsbeirat in der FDP, stärkte er ihr Filz-Image. Schloss er sich mit andern Managern zu bekennenden und zahlenden «Freunden der FDP» zusammen, ließ er den Freisinn vollends als Abzockerlobby erschei- nen. Gründete der UBS-Konzernchef mit zwanzig Mil- lionen Franken eine private Stiftung, die eine «ethische Ausrichtung in der Globalisierung fördern» sollte, mä- kelten Medien an der «nebulösen» Zweckbestimmung. Sein ethisches Sensorium verlieh dem erfolgreichen CEO zwar den Nimbus, der ihn zum logischen Anwärter auf die Ospel-Nachfolge im VR-Präsidium werden ließ. Kaum aber lieferte Wuffli im Geschäft schlechtere Resul- tate, wurde er von Ospel ausmanövriert und im Juli 2007 als Konzernchef durch Marcel Rohner ersetzt.
- 64
- Rohners Profil ist jenem Wufflis nicht unähnlich. Auch Marcel Rohner, studierter Volkswirtschafter und boden- ständiger Familienvater, entstammt dem staatstragen- den Bürgertum. Er kommt aus einer aargauischen CVP- Familie. Noch als UBS-Kronprinz nahm er 2006 in Aarau an der Wahlfeier für die frischgebackene CVP-Bundes- rätin Doris Leuthard teil; beim Apero im Schlossgarten trat Marcel Rohner dem grassierenden Unmut über die hohen Managerlöhne entgegen. Um Volksnähe bemüht, formulierte er nonchalant: «Das ist doch alles viel nor- mäler.» Nun kämpft Rohner als UBS-Konzernchef an vorders- ter Front mit den Widersprüchen, die der ganzen Gilde zu schaffen machen. Die Manager können argumentie- ren, wie sie wollen. Verteidigen sie ihre eigenen Löhne in offener Rede, haben sie schon verloren - als seien sie dazu verurteilt, ihren Gegnern in die Hände zu arbei- ten. Die Herrschaften haben ihren Kredit beim Volk ver- spielt. Sie bestehen auf Bezügen, die sie nach Meinung der meisten nicht verdienen. Ihre Löhne erzeugen immer neue Wellen der Empörung. Durch ihren Erwerbssinn in eigener Sache haben sie sich ihre politische Glaubwür- digkeit verscherzt. Daraus hat Marcel Ospel seine Folgerungen längst gezogen. Er meidet öffentliche Debatten, so gut er kann. Als Anbieter auf dem politischen Meinungsmarkt war er ein Underperformer. Seine Argumente fanden zu wenig Abnehmer. So führte er die Diskussion zuneh- mend defensiv - für ihn fatal, weil er dadurch das Ge- setz des Handelns verlor - und zog sich für reale poli-
- 65
- tische Weichensteillingen hinter verschlossene Türen zurück. Einmal, während der UBS-gesponserten Ausstellung «Tutenchamun - Das goldene Jenseits» im Jahr 2004 in Basel, widersprach er launig dem im Daig umlaufenden Bonmot, er, Ospel, habe sich im Gegensatz zum Pharao schon zu Lebzeiten mit seiner Gage vergolden lassen; der Pharao habe - erwiderte Ospel - erstens «viel mehr als ich bekommen» und zweitens «keinen einzigen Rappen an die AHV zahlen müssen». In diesem Punkt täuschte sich Ospel freilich. Des Pharaos Traum von den sieben fetten und sieben mageren Kühen zeigte doch Ägyptens Herrscher, wie wichtig eine gute Vorsorge fürs Volk ist. Darum ließ er Joseph in den Jahren der Fülle so viele Vor- räte für die Hungerjahre anlegen. Kurz, der Pharao fand Geiz nicht geil, sonst hätten er und die Seinen auch nicht jahrtausendelang regiert. Der letzte der Schweizer Pharaonen war Alex Krauer. Der Präsident von Giba-Geigy (1987-95), Novartis (1996- 99) und UBS (1998-2001) wollte die Globalisierung mit den Menschen gemeinsam bewältigen. Der blasiert wir- kende Grandseigneur - helle Augen, weiße Haare, dünne Stimme - meinte, es sollten, «wenn es dem Unterneh- men gutgeht, auch alle profitieren». Zwei seiner jungen Kollegen, Marcel Ospel und Daniel Vasella, sahen die Prioritäten anders und setzten sich gegen ihn durch: stagnierende Reallöhne für die meisten Arbeitnehmer und langfristig s teigende Kurse für Aktionäre, aber schon kurzfristig explodierende Gehälter für Manager. Gegen diesen Trend hatte Alex Krauer, Enkel eines
- 66
- Ciba-Fabrikarbeiters und Sohn eines Ciba-Chemikers, von Beginn an seine Bedenken. Dezidiert gab er bereits 1994 Gegensteuer. An Rive-Reine-Tagungen bremste er Wirtschaftskapitäne, die das später berüchtigte Weiß- buch für die radikale Marktöffnung der Schweiz vor- bereiteten. Er erwog mit Gewerkschaftern eine Liberali- sierung ohne Sozialabbau - das Modell, das später von nordischen Ländern mit Erfolg umgesetzt wurde. Durch Krauers Sukkurs erzielten die Sozialpartner auf dieser Linie einen konkreten Durchbruch: die Reform der Arbeitslosenversicherung (keine Kürzung von Tag- geldern und Bezugsdauer, aber Pflicht der Erwerbslosen zur aktiven Stellensuche). Christoph Blocher kämpfte im Nationalrat heftig dagegen; er prophezeite den Unter- gang durch «nicht bezahlbare Defizite» und bekam un- recht. Der von Krauer angebahnte Kompromiss erlaubte dem Land, die Sockelarbeitslosigkeit tiefer als anderswo zu halten. Die Arbeitslosenversicherung blieb indes die Aus- nahme. Die Topmanager stoppten weitere Reform- schritte auf derselben Linie in andern Bereichen; mit Kompromissen zwischen Sozialpartnern wären explo- dierende Managerlöhne nicht zu haben gewesen. Die Wirtschaftskapitäne veröffentlichten ihr provokantes Weißbuch und paktierten mit Blocher. Krauer lernte seine Pappenheimer in den Chefetagen kennen. Beim Fusionskonzern Novartis zog er als Präsident gegen CEO Daniel Vasella den Kürzern, nahm den Hut und erklärte 1999 in seiner Abschiedsrede: «Wir dürfen uns nicht ein- bilden, der unternehmerische Auftrag sei mit der Erzie-
- 67
- lung von Gewinn erfüllt.» Nach seinem Abgang schössen Vasellas Bezüge von ein- in zweistellige Millionenhöhe. Bei der Fusionsbank UBS schlug Präsident Krauer seine letzte Schlacht. Sein Kontrahent, CEO Ospel, er- klärte die Maximierung des Aktienkurses zum allein seligmachenden Glauben fürs ganze Personal: «Das Be- kenntnis zu Shareholder-Value soll nicht ausschließlich vom Topmanagement vordemonstriert werden, sondern hat auf einer tiefen Überzeugung aller Mitarbeiter eines Unternehmens zu basieren.» Alle in der Firma taten wie befohlen, nur der alte Pharao verweigerte dem neuen Gott den Dienst. Trotzig warnte Krauer vor der «engen Auslegung des Shareholder-Value» - umsonst. Der müde Herrscher dankte alsbald ab, ein Jahr vor der Zeit. In der Abschiedsrede bei der UBS 2001 wiederholte er ein allerletztes Mal, alle - Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und Öffentlichkeit -, «sie alle zusammen sitzen im glei- chen Boot und haben letztlich alle das gleiche Interesse». Kaum war er gegangen, sprangen auch Ospels Bezüge auf zweistellige Millionenhöhe. Noch im selben Jahr nahm ihn Daniel Vasella zur Welt- elite der Bilderberger mit, die diesmal auf der kleinen, der Westküste Schwedens vorgelagerten Insel Stenung- sund zusammenkam. Marcel Ospel fand die hier ver- sammelten potentiellen Kundinnen und Kunden beacht- lich, ihre Debatten aber teilweise überflüssig. So erklärte Prinzessin Anne von England, die Korruption in Ent- wicklungsländern wäre weniger schlimm, wenn die Be- stechungsgelder nicht auch noch auf ausländische Bank- konten abflössen, sondern zu 80 Prozent im eigenen
- 68
- Land investiert würden. Marcel Ospel, in einer Kleinbas- ler Genossenschaftswohnung aufgewachsen und zum weltgrößten Vermögensverwalter aufgestiegen, kann mit gutgemeinten Höhenflügen wenig anfangen; er ist, an- ders als Vasella, kein Bilderberger Stammgast geworden. Seine tieferen Motive kommen zum Vorschein, wenn er mit Vasella gemeinsam auf die Jagd geht. Auch hier ist ihm der Pharmariese, der seit 2002 den Jagdschein besitzt, einen Schritt voraus. Marcel Ospel, patentierter Jäger seit 2006, obliegt dem Waidwerk am liebsten in England, Spanien, Frankreich, den USA und natürlich auch in Österreich, wo Kampfgefährte Vasella neuer- dings über ein eigenes Revier von 5000 Hektaren ver- fügt. Die Konzernherren sind Jäger und Sammler der besonderen Art. Schon in der Steinzeit zeigten zwar jagdlich erfolgreiche Höhlenbewohner ihre Trophäen voll Stolz den andern. In Mittelalter und Neuzeit wur- den Geweihe, Tierköpfe und Stoßzähne in Trophäenzim- mern zur Schau gestellt. Heutige Topmanager lassen sich von Instinkten leiten, die in ökonomischen Lehrbüchern nicht vorgesehen sind. Sie verfahren allerdings anders als Jäger früherer Zeiten. Sie müssen, um ihre Bezüge zu begründen, die Erfolge ihrer Firmen - Früchte der Arbeit auch vieler anderer - wie ganz persönliche Tro- phäen präsentieren. Frisch brechen sie auf zum fröh- lichen Jagen und freveln gegen den Gemeinsinn in der eigenen Firma und weit darüber hinaus.
- 69
- WIESICH BIG PHARMA zum Weltsystem spreizt, Franz Humer die Finanzer in die Schranken weist und Daniel Vasella dem Tod den Meister zeigen möchte
- Wer ein Imperium regiert, verfährt mit Menschen seines Ranges meistens höflich, doch direkt. So fragte Daniel Vasella am Weltwirtschaftsforum in Davos über Video- schaltung die Amerikanerin Condoleezza Rice, warum die USA ihren globalen Kampf für Demokratie und Rechtsstaat so oft mit Mitteln führten, die ihren eigenen Werten zuwiderliefen. Die Außenministerin dankte dem Schweizer für seine «prägnante Frage»; sie gab «unent- schuldbare Ereignisse wie in Abu Ghraib» zu, betonte aber, die dafür Schuldigen seien doch längst bestraft. Dem Novartis-Chef genügte Rices Antwort freilich nicht. Er ergriff das Wort erneut und insistierte auf seinem «persönlichen Wunsch» an die Adresse der USA, ihre Glaubwürdigkeit völlig wiederherzustellen. Daniel Vasella ist gern richtig wichtig. Super-Dan, Großanleger auch in Amerika, zeigt auf der Weltbühne, dass überall mit ihm zu rechnen ist. Mal charmant, mal arrogant, riskiert er für seine Zwecke eine Lippe. Er mar- kiert den Wohltäter der Menschheit, jederzeit und über- all, in Davos und Basel, Boston und Shanghai. Er hat zwar, seit er die Firma führt, ihren Umsatz um die Hälfte erhöht, ihren Reingewinn verdoppelt, ihren Börsenwert verdreifacht und seinen Lohn verzwanzigfacht. Doch geht es ihm, sagt er, nicht ums Geld allein. Der globale Pillendreher möchte mit Hilfe seiner Genforscher - seine
- 70
- Worte - «so weit kommen, dass die Leute gesund ster- ben». Die Menschen sollen von ihm Großes erhoffen: lebenslanges Wohlbefinden für alle, Sieg über Siechtum und Schmerz, über Fehler und Gebresten der Gattung. Den amtsältesten Konzernchef der Pharmaindustrie be- seelt die Vision eines neuen Menschen. Wer so hohen Zielen dient, soll dafür auch Macht und Mittel haben. Folgerichtig hat Super-Dan Superlohn, Doppelmandat und die Tendenz zu Allmachtsphantasien. Nun macht sich zu viel Ichbezogenheit schlecht. Uto- pien kleiden den Willen zur Macht besser. Der ehemalige 68er wandelt da auf vertrauten Pfaden. Früher, am Kolle- gium St-Michel in Freiburg, rebellierte Daniel Vasella gegen das repressive Gesellschaftssystem und stritt ge- meinsam mit Genossen des «Gerde Gracchus», eines Ablegers der Revolutionären Marxistischen Liga, für die Utopie einer besseren Welt - für seine Person erfolgreich, denn er lernte dabei seine bessere Hälfte kennen, Anne- Laurence; ihr Onkel war Marc Moret, Sandoz-Manager. Das erste, zufällige Treffen der zwei künftigen Konzern- chefs, 1974 in Freiburg, ging zwar schief. Der autoritäre Fünfziger musterte den Freund der Nichte scharf, disku- tierte mit ihm fünf Minuten und beendete das Gespräch abrupt: «Sie verstehen davon nichts.» Lange lahre hielt sich der gestrenge Herr den kecken Besserwisser vom Leib. Vorderhand erlitt Vasella harte Schicksalsschläge. Er verlor zwei Schwestern durch Krebstod und Autounfall, den Vater - Professor für Schweizer Geschichte an der Uni Freiburg - durch einen ärztlichen Kunstfehler. Her-
- 71
- ausgefordert durch die Macht des Todes, studierte Va- sella Medizin, wurde Arzt am Berner Inselspital und Fa- milienvater. Entschlossen, den unbarmherzigen Tod in die Schranken zu weisen, musste er einen weiteren, viel- leicht den härtesten Schlag verkraften, als sein zwei- tes Kind bei der Geburt starb. «Das», sagte er einmal am Radio, «war wirklich schlimm.» Er hängte den Arztberuf, in den er schon fünfzehn Jahre Studium und Arbeit investiert hatte, an den Nagel. Sein neuer Job: Jungmanager bei Sandoz. Der Onkel sei- ner Frau war inzwischen Chef der Firma; er formte San- doz zu einem der schlagkräftigsten Pharmakonzerne der Welt. Durch den Berufswechsel änderte Vasella in sei- nem stillen Ringen mit dem Tod die Taktik, er steigerte seinen Einsatz gegen ihn ins Globale. Der Sandoz-Neu- ling war Ärztebesucher in den USA, ehe er am Basler Hauptsitz in die Chefetagen aufstieg. Er kannte Morets extremes Misstrauen genügend und machte bei ihm jetzt keine Fehler mehr. Der Alleinherrscher, inzwischen Siebziger, suchte für sich den würdigsten Nachfolger. Fähigste Anwärter mit größter Erfahrung in der Branche fielen samt und sonders durch. Keiner war ihm fügsam genug. Die nötige Loyalität traute er am Ende einzig dem jun- gen Verwandten zu, der erst wenige Jahre in der Branche tätig war. «On a besoin de toi» (du wirst gebraucht), sagte der Sandoz-Patron zu Vasella und erhob ihn 1994 zum Chef der Pharmadivision, 1996 zu seinem Nachfolger und CEO des Fusionskonzerns Novartis. Bald nach dem Stab- wechsel fühlte sich Moret vom Günstling bereits verletzt;
- 72
- die näheren Gründe behielt er für sich. Zwischen den beiden kehrte neues, eisiges Schweigen ein. Erst gegen Lebensende sprach der Novartis-Gründervater wieder mit Vasella. Der langjährige Herrscher starb 2006 in selbstgewählter Einsamkeit. Zur Bestattung in Morges fanden sich hundert Trauernde ein. Sie erlebten im Kirchlein eine erschütternde Vasella-Rede, die stellen- weise an den Basler Totentanz gemahnte. Vasella: «Marc erzählte mir, er habe den Papst besucht und ihm gesagt, es sei oft schwer, Patron und Christ zugleich zu sein. Der Papst habe erwidert: <Darum ist Jesus am Kreuz ge- storben.» Marc wusste nicht, was er darauf sagen sollte; er fand beim besten Willen keine Antwort.» Moret konnte des Papstes Spruch nicht deuten und blieb mit seiner Not allein. Der betagte Wirtschaftsfüh- rer bangte um sein Seelenheil, weil er gegen viele Men- schen hart gewesen war, oft schroff. Der mit sich selbst genauso strenge Sünder spürte früher als die meisten, was die Globalisierung der Finanz für die Industrie be- deutete: ein entfesselter Weltmarkt, Kosten- und Mar- gendruck, Um- und Abbau in großem Stil. Der San- doz-Befehlshaber führte 1981 als erster Konzernherr in Europa nach McKinsey-Manier eine Gemeinkosten- Wertanalyse durch, der 900 Stellen zum Opfer fielen. Er unterwarf sich der Finanz mit Haut und Haar. Seinem Ratgeber Lukas Mühlemann (damals McKinsey, später CS-Chef) schwor Moret: «Moi, je fais ça comme Napo- léon» (ich mache das wie Napoleon). Sein eiserner Wille, die Vorgaben der Finanzer gegen alle Widerstände um- zusetzen, war in der Tat bahnbrechend. Nach und nach
- 73
- wurden weite Teile der Industrie von den monetären Strategen eingenommen und in ihrem Sinn saniert. Ein- gekreist von den globalen Kapitalmärkten, gaben selbst so liquide Industriekonzerne wie Roche und Nestlé die reine Selbstfinanzierung auf. Beim Sprung über den Atlantik brachen sie mit ihrem seit alters geheiligten Grundsatz, nichts mit fremdem Geld zu kaufen: Roche beim Kauf von Genentech, Nestlé bei der Übernahme von Carnation. Macht ging vom Industrie- zum Finanz- kapital über. Der Kaiser von Sandoz blieb Speerspitze des indus- triellen Strukturwandels. Moret zog Investmentbanker nicht nur zu Rate, er nahm sie selbst in seine Generalität auf. Hans-Jörg Rudioff, Pionier der transnationalen Fi- nanzmärkte, wurde Vizepräsident des Sandoz-Verwal- tungsrats, ein Amt, das er beim Fusionskonzern Novartis noch heute versieht; er ist als Chef des Vergütungsaus- schusses auch für Vasellas Lohn verantwortlich. Vasella schmeichelte ihm immer: «Er hat Ideen. Er liebt Wandel. Er ist schnell. Und wir lachen viel.» Der Novartis-Chef rühmte auch viele andere Banker, am meisten aber den CS-Chef Lukas Mühlemann - bis zu dessen Water- loo. «Ich schätze sein Urteil hoch», schwärmte Vasella noch im Boomjahr 2000, in dem Mühlemann seinen für die CS folgenschwersten Fehlentscheid traf - den überbezahlten Kauf des US-Finanzhauses DLJ - und zugleich 15 Millionen Franken Jahreslohn einstrich, damals Schweizer Rekord. Vasella, der in CS-Verwal- tungsrat und -Vergütungsausschuss saß, tat es alsbald seinem Superbanker gleich: mehr Amerika, mehr Lohn.
- 74
- Der Novartis-Chef ging an die New Yorker Börse und verlegte die Forschungszentrale von Basel nach Boston, für den Standort Schweiz fatal. Alex Krauer, inzwischen Novartis-Ehrenpräsident, erhob dagegen «grundsätz- liche» Einwände. Vasella ließ sich aber nicht beirren. Als CEO und Präsident in einer Person hatte er in der Firma nun leichtes Spiel - nicht allerdings in der Branche. Wollte er das amerikanische Börsenpublikum begeis- tern, musste er in hohem Tempo wachsen, sprunghaft. Der frisch patentierte Freizeitjäger ging auch im Busi- ness auf die Pirsch. Er stellte Konzernen nach, und ihm war klar, was er seinesgleichen schuldig war. «Wenn ich», sagte Vasella am Radio, «mit einem Kollegen einer an- dern Firma verkehre, sind wir sehr freundlich, ich mag ihn vielleicht sogar gut - aber bei Gott freut es mich, wenn wir ihm eins ans Bein geben können und besser sind als er! Ich will, dass die Konkurrenz verliert, und kann sogar hämische Freude daran haben, wenn denen was nicht gelingt.» So näherte er sich eines Tages ganz freundlich seiner lieben Basler Nachbarin Roche. Er witterte leichte Beute. Franz Humer, Roche-Chef und Sohn eines Oberkellners aus der Mozart-Stadt Salz- burg, war bereits angeschlagen. Seine Frau, eine Schwei- zerin, derentwillen er einst zugezogen, war 1999 nach jahrelangem Leiden einem Brustkrebs erlegen. Seit ih- rem Tod schuftete Humer zur Ablenkung zwar mehr denn je, Tag und Nacht und Wochenende: «Ich dachte, ich reiße die Welt aus den Angeln.» Doch die Börse spielte ihm einen bösen Streich. Nach dem Crash 2001 beklagte Humer ein Fünf-Milliarden-Loch. Vasella, der
- 75
- Glanzresultate vorwies, war entschlossen, dem serbeln- den Papageno den Rest zu geben und Roche zu überneh- men. Er demütigte den Gegner nach Strich und Faden. Ein Novartis-Anwalt prangerte Humers Millionenbezüge öffentlich an, mit dem Unterton: Nichts gegen hohe Be- züge, aber dieser Mann ist sein Geld nicht wert. Humer entpuppte sich im Nahkampf jedoch als schwieriger Gegner. Er konnte, wenn er wollte, genauso freundlich wie Vasella sein. Der eingebürgerte Schwei- zer flötete: «Ich bin kein Freund von Fusionen.» Er fand den Kult der Größe falsch: «Die Zeit der Kolosse mit über looooo Mitarbeitern ist vorbei.» Er sprach nonchalant: «In einem Dorf ist es besser, wenn man zwei Läden hat als einen.» Er obsiegte, weil er auf die Erben der Gründer bauen konnte. Die Festung Roche blieb wegen des Ak- tienpool-Vertrags der alten Besitzerfamilien (Hoffmann, Oeri) uneinnehmbar; die Erben verkaufen einzelne Ak- tienpakete nur - und geben damit die Mehrheit preis wenn sie sich darin alle einig sind. Externe Geldprofis finden dieses Regime unzeitgemäß - es verwehrt ihnen die Übernahme. So erging es auch Vasella, als er auf Humer losging. Der kleine Napoleon hatte ein leichtes Opfer gesucht und seinen Metternich gefunden. Vasella hatte den Gegenspieler unterschätzt. Humer war zwar, wie er, vom Ärztebesucher zum Konzernchef aufgestiegen, aber im Schneckentempo, nach 25 Jahren Plackerei. Der Österreicher arbeitete für die amerikani- sche Schering Plough und die britische Glaxo, ehe er zu Roche kam. Er kannte die Branche nicht nur länger als Vasella, sondern auch besser, genauer, profunder. Seine
- 76
- Welt war die Industrie, nicht das schnelle Geld. Humer widersetzte sich Börsianern, sobald sie ihm ins Hand- werk pfuschten. Er wollte «stetiges Wachstum, kein Feu- erwerk - ein Geschäft mit 70 000 Leuten kann man so nicht führen». Humer wies Spekulanten die Tür. Sie wa- ren ihm in ihrer Geldgier zu ungeduldig; sie konnten ihm, bekamen sie das Sagen, zu viel zerstören. Er vereitelte die Wahl des Börsenbankers Martin Ebner in den Roche-Ver- waltungsrat. Humer richtete sich «nicht auf das kurzfris- tige Shareholder-Value-Denken aus, sondern auf das In- teresse aller». Er stoppte die Arroganz der Finanz auch intern. Er hatte genug von Buchhaltern, die einst, unter Finanzchef Henri B. Meier, mit fetten Renditen geprahlt, beim Crash 2001 aber geträumt und das Milliardenloch verursacht hatten. Humer dekretierte ein für alle Mal: «Roche ist ein Pharma- und kein Bankgeschäft.» Er sträubte sich gegen die Börse, und er bekam damit recht - nach und nach selbst von der Börse. Roche stieg zur teuersten Firma der Schweiz auf: 200 Milliarden Franken Börsenwert. Zu Humers Boom trug bei, dass seine Biotech-Forscher begannen, Krebs von einer töd- lichen in eine chronische Krankheit umzuwandeln. Ob ihre Mittel auch seiner Frau geholfen hätten, steht für ihn dahin. Er rechtet mit dem Tod nicht, genießt seinen zweiten Frühling, seine zweite Frau und seinen ersten Triumph mit der Firma. Mister Roche ist die Restaura- tion der legitimen Herrschaft alten Industrieadels glän- zend geglückt. Mister Novartis freilich hatte eine Schlacht verloren, nicht den Krieg. Er sammelte seine Kräfte und fasste
- 77
- neue Angriffsziele ins Auge. Von nun an hatte er Gegen- wind. Er übernahm von Ebner das Roche-Aktienpaket, aber er hat bei der lokalen Rivalin trotzdem nichts zu sagen. Er buhlte um die französische Aventis, erfolglos. So wurde er zum expansiven Großverteiler und setzte auf Größe und Marktmacht. Er erweiterte die Produkt- palette und stellte nicht mehr nur Originalpräparate her, sondern auch billige Kopien, sogenannte Generika (Nachahmerprodukte) - eine Doppelstrategie, die an- dere Konzerne aus Prinzip vermeiden. Humer will vom Generikageschäft nichts wissen. Der Roche-Chef lehnt es ab, «einerseits Patente zu verteidigen und anderseits diese anzugreifen». Er sieht in Vasellas Doppelstrategie eher ein Doppelspiel. Vasella gerät in immer neuen Zwiespalt. So sprach er am Weltwirtschaftsforum 2006 in Davos wieder einmal freundlich mit Mitbewerbern, diesmal mit Indiens Ge- nerikaherstellern, den größten Anbietern preisgünstiger Medikamente für Menschen armer Länder. Der glut- äugige Bart- und Turbanträger Malvinder M. Singh (Prä- sident von Ranbaxy) pries Vasella nach dem Gespräch gegenüber der Schweizer Fernsehjournalistin Susanne Wille in den wärmsten Farben: «Ich habe viel Respekt und Achtung für das, was er ist und in der Branche tut.» Mehr noch: «Ich hoffe, wir können in Zukunft zu- sammenarbeiten.» Der Pillen-Maharadscha kannte den netten Schweizer schlecht. Derliebe Kollege erklärte ihm und den andern Indern hundert Tage später in aller Form den Unternehmenskrieg. Der Mann aus Basel zog die Konkurrenten in ihrem
- 78
- eigenen Land vor Gericht und beschuldigte sie, sein Krebsmittel Glivec rechtswidrig zu kopieren. In einer ersten Klage ging er auf ihr Patentamt los, in einer zwei- ten sogar auf ihr Parlament. Dem Gesetzgeber der größ- ten Demokratie der Welt warf Vasella vor, den Patent- schutz nicht streng genug geregelt zu haben. Er berief sich dabei auf Regeln der Welthandelsorganisation (WTC), doch stach er in ein Wespennest. Überall warfen ihm Nichtregierungsorganisationen vor, er wolle die in- dische Generikaherstellung mutwillig zerstören. Setzt er sich gegen Indien durch, die «Weltapotheke der Armen», dann stehen Millionen Menschen des Südens ohne be- zahlbare medizinische Hilfe da. Er schadet einem der wichtigsten Entwicklungsziele, das die Staats- und Regierungschefs am Uno-Millenni- umsgipfel 2000 in New York mit bombastischer Feier- lichkeit beschworen: Die Weltgemeinschaft wollte bis 2015 allen Entwicklungsländern «in Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie lebenswichtige Medikamente zu erschwinglichen Preisen» besorgen. Die Pharma- branche selber versprach hoch und heilig, das Ihre dazu beizutragen. Seitdem hat sich die Lage kranker Men- schen im Süden zum Teil sogar verschlechtert: mehr HIV, mehr Krebs, mehr Diabetes. 30 Prozent der Welt- bevölkerung haben keinen regelmäßigen Zugang zu lebensnotwendigen Medikamenten. Aids, Malaria und Tuberkulose raffen Jahr für Jahr sechs Millionen Men- schen dahin, Tendenz steigend. Zwei Millionen sterben an Krankheiten, die durch Impfung vermeidbar wären (etwa an Masern oder Hepatitis B).
- 79
- Nicht dass Daniel Vasella das Schicksal der Menschen kaltließe. Er bemühte sich seit der Novartis-Fusion 1996 mit viel Kraft und Geld auch in armen Erdteilen um Re- putation. Er nahm das humanitäre Engagement für kranke Menschen im Süden ernst, von Beginn an. We- nige Wochen nach der Fusion saß er in einer Crossair- Maschine von Zürich nach Basel zufällig neben Klaus Leisinger, der unter Alex Krauer die Ciba-Geigy-Stiftung für Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern geleitet hatte und jetzt in Sorge war. Leisinger nutzte die drei- ßig Minuten Flugzeit mit dem neuen Konzernchef und warb eifrig für seine Stiftung. Vasella hörte geduldig zu und meinte nach der Landung, dass er immer der An- sicht gewesen sei, ein solches Werk habe Sandoz gefehlt. Leisinger war der glücklichste Mensch der Welt. Ex-San- doz-Mann Vasella war auf seiner Seite. Das war nicht selbstverständlich, denn damit brach Vasella mit der alten Sandoz-Linie. Marc Moret war an Engagements dieser Art nie gelegen. Alt-Bundesrat Hans Schaffner kämpfte als Sandoz-Verwaltungsrat (1970-84) sogar auf Weltebene, in Uno-Gremien, frontal gegen Verhaltens- richtlinien an die Adresse der Konzerne. Ganz anders Vasella. Er trat im Jahr 2000 als einer der ersten Konzernchefs überhaupt dem Global Compact bei, dem Ergebnis einer Idee, die Uno-Generalsekretär Kofi Annan im Vorjahr am Davoser WEF lanciert hatte. Seitdem sind dem Global Compact - einer freiwilligen Selbstverpflichtung zur Einhaltung von Menschenrech- ten, fairen Arbeitsnormen und zum Schutz der Umwelt - 3000 Unternehmen beigetreten. Leisinger, der im Haupt-
- 80
- beruf die Novartis-Stiftung leitet, wurde von Kofi Annan 2006 zum Global-Compact-Sonderberater ernannt. Hier war Vasella bereit, auch ungeschriebene Gesetze zu befolgen. Was nicht direkt Profit versprach, war bei ihm nicht schon deshalb auch des Teufels. Er entschied früh, alle Lepramedikamente bis zur Eliminierung der Krankheit gratis zu verteilen. Er machte sich für das Ma- lariamedikament Coartem stark. Er gründete in Singa- pur ein Forschungsinstitut zur Erforschung tropischer Krankheiten. In alledem bewies er mehr Sensibilität als die meisten Branchenkollegen, welche die Forschung völlig auf «rentable» Krankheiten konzentrieren. Goodwill war ihm wichtig, doch Superlohn und Dop- pelmandat waren ihm weit wichtiger. Verlockt von Macht und Reichtum, brachte er das Unternehmen um die Früchte langjähriger PR-Arbeit. Nicht dass er sich Illusionen in eigener Sache machen würde. Er präsidierte 2004 bis 2006 den Weltdachverband der Pharmaindus- trie und zog am Ende erstaunlich schonungslos Bilanz: «Unsere Industrie leidet immer noch unter schlechter Reputation. Nach der Gallup-Umfrage 2005 erreichte die Pharmaindustrie ein Allzeittief. Wir spüren einen Man- gel an Vertrauen sogar unter denen, denen wir helfen wollen.» Er beschönigte nichts. «Aus meiner Sicht gibt es für die relativ schlechte Reputation fünf Hauptgründe: Wahrnehmung von Raffgier, fehlender Transparenz, ag- gressivem Marketing, Gleichgültigkeit für die Grund- versorgung der Armen, Unkenntnis.» Vasella sprach als freimütiger Weltpräsident der Branche, doch ist ihm be- wusst: Einige der Kritikpunkte treffen auf ihn selber zu.
- 81
- Er ließ sein Sensorium erkennen, als er einmal - ein scheinbar entlegenes Thema - die Memoiren Albert Speers, des Rüstungsministers von Hitler, las. Vasella fand sie, wie er in einem Interview sagte, deshalb «span- nend, weil sie beschreiben, wie sich ein scheinbar ver- nünftiger Mann in ein mörderisches Regime verstrickte und einer der Technokraten wurde, die durch ihre Fähig- keiten das Leiden von Millionen Menschen verlängerten. (...) Ich lese es als Mahnung, nie den Blick für die Folgen eigenen Handelns zu verlieren. Man muss aus der Ge- schichte lernen.» Bisweilen ist Mister Novartis - 50 Milli- arden Franken Umsatz, 100000 Mitarbeiter - die eigene Macht unheimlich.
- IV Das Parlament verliert die oberste Gewalt WARUM DIE RÄTE nicht mehr sind, was sie waren, und wieso die freisinnige Staatspartei ihr Schicksal so zielstrebig erfüllt - Christine Egerszegi, Gerold Bührer, Fulvio Pelli
- Die da oben muss es wissen. Würdig thront sie auf dem höchsten Stuhl. Stolz und doch schalkhaft blickt Chris- tine Egerszegi auf den Rat herab. Mit einem Anflug geho- bener Langeweile folgt die Vorsitzende der nach Artikel 148 der Verfassung «obersten Gewalt im Bund» dem Pala- ver der Votanten. Dass jede Menge leeres Stroh gedro- schen wird, macht der Nationalratspräsidentin wenig aus. Mal lobt sie die Versammlung: «Ich bin mit Ihnen zufrieden.» Mal tadelt sie: «Die Präsenz ist so, dass ich jede Einzelne und jeden Einzelnen begrüßen könnte.» Der Rat ist für sie wie ein großes Kind, nicht perfekt, doch unendlich wichtig. Das Parlament trage, sagt sie, «eine Riesenverantwortung». Die gemütvolle Matrone ist vom Pathos der Verfassung eingenommen. An sich hat sie ganz recht. Im Prinzip besitzt ihr Hohes Haus fast unumschränkte Befugnisse. Es darf Krieg er- klären, Frieden schließen, Bundesrat und -gericht nebst General wählen, Handel und Wandel des Landes ordnen und formen, überhaupt die gesamte Gesellschaft gesetz- lich gestalten, bleiben dabei nur die Rechte von Volk und Ständen gewahrt. De jure ist das Parlament fast allmäch-
- 83
- tig, es tritt im Morgenrot daher und glüht im Strahlen- meer. De facto schwindet die Bedeutung nationaler Poli- tik durch die Globalisierung der Wirtschaft. Das will Christine Egerszegi allerdings nicht wahrhaben. Die ge- lernte Sprachlehrerin und Sängerin aus dem aargaui- schen Mellingen gibt symbolisch Gegensteuer. Sie federt die Globalisierung durch flankierende Maßnahmen im Sozialen ab. Ist der Rat auch ohne Macht, so ist er unter ihr doch nicht ohne Würde. Die kernige Landesmutter ist der Abglanz des liberalen Volksstaats des 19. Jahrhun- derts. Auf sie blickte ihr Parteipräsident, Fulvio Pelli, im Wahljahr voll Hoffnung. Er wollte die FDP vom «fal- schen Bild der kalten Wirtschaftspartei» reinigen und als «menschliche Partei mit Herz» positionieren. Das frei- sinnige Herz war im Moment höchste Schweizerin, für die FDP ein glücklicher Zufall. Immer wollte Egerszegi, Wahlen hin, Freisinn her, mit allen Menschen gerecht sein. Guten Landeskindern zeigte sie ihre Huld. Schlechte nahm sie tadelnd in die Pflicht. So brachte die bürgerliche Sozialpolitikerin die mächtigsten Männer der Geldzunft gegen sich auf. Den Versicherern warf sie vor, sich an Renten zu vergreifen. Sie reizte UBS-Präsident Marcel Ospel persönlich zum Unwillen. Eines Tages hatte der Banker von ihrem gan- zen sozialen Gehabe die Nase voll und schrieb ihr frisch- weg einen gepfefferten Brief, im Ton einer Mängelrüge des Zahlmeisters: «In der Samstagsrundschau von Radio DRS haben Sie, zur Begründung Ihrer strikten und kon- sequenten Haltung gegenüber allen Bestrebungen, bei den AHV-Renten Konzessionen nach oben zu machen,
- K'l
- ausgeführt, solche Schritte würden ja dazu führen, dass auch ein Marcel Ospel eine höhere Rente erhielte. Ich wollte dies als eine populistische Aussage <überhören>, wurde aber darauf aufmerksam gemacht, dass Sie eine ähnliche Äußerung auch in der <Arena> gemacht haben. Lassen Sie mich Ihnen deshalb nur eine einzige Zahl nennen: ich selber und meine Arbeitgeberin UBS haben auf meinen Bezügen der drei letzten Jahre insgesamt rund 3.9 Millionen Franken AHV und Arbeitslosenversi- cherung abgeliefert. Ich meine, das sei ein beträchtlicher Solidaritätsbeitrag. Vielleicht wäre es aus bürgerlicher Sicht sinnvoller, einmal auch auf diese Seite unseres So- zialversicherungssystems hinzuweisen, statt Stimmung zu machen gegen jene Leute, die ganz wesentlich dazu beitragen, dass unsere AHV nicht noch größere Pro- bleme hat.» Da geriet der solvente Volksfreund aber an die Falsche. «Zahlt er», ruft sie, «nur so viel, ist das nicht genug! Auf seinen Optionen muss er ja keine AIIV-Beiträge ent- richten!» Ospels Lohn sei überhaupt zu hoch. «So viel kann doch kein Mensch verdienen.» Und: «Ich begreife nicht, dass Peter Spuhler das nicht korrigiert.» Spuhler, Thurgauer SVP-Nationalrat und Unternehmer, könnte oder müsste als Mitglied von UBS-Verwaltungsrat und -Vergütungsausschuss zum Rechten sehen. Nur: Warum sollte er das tun? Er schnitte sich ins eigene Fleisch, selbst parteipolitisch. Die Managerlöhne schaden beim Wahlvolk nicht der SVP, sondern ihrer Konkurrenz, der «kalten Wirtschaftspartei» FDP, und Spuhler ist alles, nur nicht einfältig.
- 85
- Das Paradox ist perfekt. Christine Egerszegi stellt einen Freisinn dar, den es nicht mehr gibt. Selbst ihr ist die Par- tei zurzeit zu kalt: «Oft fehlt bei uns das Menschliche - eine Gefahr des Liberalismus.» Sie verkörpert Glanz und Elend des geschichtlichen Erbes lebensecht. Die volks- nahe Förstertochter erinnert an die Ursprünge der frei- sinnig-demokratischen Großfamilie. Der Freisinn schuf die moderne Schweiz - Freiheit von Bürgern und Wirt- schaft, Bundesstaat, direkte Demokratie, Volksschule, na- tionale Identität. Die damaligen Freisinnigen (die «Radi- kalen») errangen eine einzigartige Stellung, weil sie, so Politologe Erich Gruner, ihre historische Aufgabe nach 1848 lösten und «aus dem lockeren Bündel selbständi- ger Kantonalstaaten die schweizerische Nation» formten. Der Freisinn war, mit einem Wort, das Volk. Getragen von einer breiten Welle nationaler Begeisterung, überwand er den katholisch-konservativen Kantonalismus. Das Ausland fieberte und mischte mit, pro und kontra. Karl Marx ergriff 1848 für den Schweizer Freisinn Par- tei. «Die Kommunisten unterstützen überall jede revolu- tionäre Bewegung gegen die bestehenden gesellschaft- lichen und politischen Zustände», verkündete Marx im kommunistischen Manifest: «In der Schweiz unterstüt- zen sie die Radikalen, ohne zu verkennen, dass diese Par- tei aus widersprechenden Elementen besteht, teils aus demokratischen Sozialisten im französischen Sinn, teils aus radikalen Bourgeois.» Der revolutionäre Liberalismus, der im Ausland schei- terte, siegte in der Schweiz. Der 1848 erstmals gewählte Nationalrat zählte zu 90 Prozent Freisinnige, die aller-
- 86
- dings - Karl Marx sah da klar - schon damals uneins waren. Später zerteilte sich der Freisinn in konkurrie- rende Parteien. Die FDP bröckelte über Generationen zur Rumpfpartei von Besitzbürgern und Besserverdie- nenden; sie glich immer mehr ihren ausländischen Schwesterparteien mit 10 Prozent Wähleranteil. Dem historischen Freisinn entsprossen - mit Ausnahme der CVP - alle modernen Großparteien: die SP über den Grütliverein des 19. und die SVP über die Bauern-, Ge- werbe- und Bürgerpartei des 20. Jahrhunderts. Und jede will noch im 21. Jahrhundert die echt liberale sein. Das Berner Bundeshaus wimmelt, so gesehen, von Ex-Freisinnigen. Heutige Stars der Linken und Rech- ten liebäugelten in ihren Anfängen sogar persönlich mit der FDP. Sie erlagen einem Missverständnis. Moritz Leuenberger stieß im Basler Jugendparlament zur frei- sinnigen Fraktion: «Mich zog einfach die Bezeichnung <freisinnig> an - ich verstand eben noch nicht viel von Politik.» Christian Levrat, SP-Gewerkschaftsführer, grün- dete im freiburgischen Bulle die Junge FDP. Peter Spuh- ler, SVP-Vorderbänkler, war in Zürich jahrelang FDP- Stammwähler. Selbst Christoph Blocher konnte sich in schwachen Momenten einen FDP-Beitritt vorstellen. Die Aargauer SVP-Nationalräte Ulrich Giezendanner und Luzi Stamm sind abtrünnige Freisinnige. Was Pas- cale Bruderer, SP-Jungstar, einst vom FDP-Beitritt ab- hielt, war nicht das Programm, vielmehr der Rechtsdrall der Aargauer Sektion. Liberale Ideale sprießen allenthalben - selbst in der FDP. Liberale Taten hingegen verletzen leicht reale In-
- 87
- teressen und Besitzstände - gerade im FDP-Bürgertum. Deshalb klaffen Wort und Tat beim Freisinn so weit aus- einander. Das merken die einen früher, die andern später, manche nie. Konsumentenschützerin Simonetta Som- maruga (SP/BE) und Lucrezia Meier-Schatz (CVP/SG) wissen Bescheid. Fordern sie, wie oft, mehr Wettbewerb, haben sie nicht selten die FDP gegen sich. Wollen sie zum Beispiel mehr günstige Parallelimporte zulassen, um den Konkurrenzdruck auf inländische Anbieter zu erhöhen, sperrt sich die FDP-Fraktion mit Händen und Füßen da- gegen. Die Freisinnigen verraten ihre liberalen Grund- werte in diesem Fall an die Pharmakonzerne, die, koste es, was es wolle, hohe schweizerische Referenzpreise für ihr Auslandgeschäft benötigen. Oder andersherum: Kon- zern- und Volksliberalismus sind zweierlei. Heftig protestierte Unternehmer Otto Ineichen in der FDP-Fraktion. Ihn empörte, «dass wir der Pharma zu- liebe Parallelimporte generell über Jahre hinaus faktisch verbieten». Das sei für die FDP ein «klassischer Sünden- fall», mahnte er: «Betreiben wir reine Klientelpolitik, machen wir uns unglaubwürdig.» Ineichen warnte: «Wir dürfen die Augen nicht verschließen, nur weil es der lie- ben Pharma nicht gefällt.» Die Pharma müsse beim Pa- tentrecht endlich Fland bieten zu einem «vernünftigen Kompromiss», einer «sicheren gesetzlichen Ausnahme- klausel». Der impulsive und expansive Detailhändler (Otto's) donnerte: «Bei Blocher ist das Geschäft in den falschen Händen. Von ihm ist keine echte Lösung zu er- warten.» Überhaupt sei «Blochers einseitige Pharma- politik» gerade für die FDP «schlecht».
- 88
- Ineichen dämmerte, dass er jahrelang Trugbildern auf- gesessen war. Als neuer Nationalrat hatte er 2003 Blo- chers Wahl zum Bundesrat kräftig unterstützt; er sicherte sich dann im Nobelhotel Bellevue-Palace die stilvolle Suite mit Balkon und Aussicht auf die Berner Alpen, in der der SVP-Volkstribun jeweils genächtigt hatte. «Ich bin hier Blochers Nachfolger», erklärte er aufgeräumt, «und nebenan ist Spuhler einquartiert.» Der Beiklang war: Wir Unternehmer übernehmen. Ineichen glaubte zu schieben und wurde geschoben. Er hielt Blocher für seinesgleichen. Doch dem Ems-Chemie-Patron ging es, sosehr er sein Unternehmertum betonte, nie ums Unter- nehmertum an sich. Blocher verknüpfte Politik und Wirt- schaft auf seine Weise. Während seiner ganzen Amtsdauer als Nationalrat saß er auch im Vorstand der diskreten, doch höchst po- tenten SGCI, der Schweizerischen Gesellschaft für Che- mische Industrie mit Sitz an der Zürcher Nordstraße. Hier war er ebenfalls 24 Jahre lang mit Hochdruck am Ball, für seine Verhältnisse jedoch auffallend unauf- fällig. Wie global der Hase lief, sah er in der Pharma früh. Er arbeitete mit Marc Moret zusammen, dem kosten- bewussten Chef von Sandoz, der während Jahren auch die SGCI präsidierte. Blocher war neben den Basler Pharmariesen zwar ein Zwerg, doch konnte er aus ihren globalen ökonomischen Zwängen und Plänen sein eige- nes politisches Konzept ableiten: populistische Propa- ganda, bürgerliche Wende. Er arbeitete mit dem Zwie- spalt zwischen global mobilen Konzernen und dem Volk des immobilen Sitzlands. Er nutzte die Chancen, die
- 89
- sich daraus für eine rechtsnationale Politik ergaben, ent- schlossen aus. Moret, Blocher und die andern mussten, sollte ihre Rechnung aufgehen, nicht nur in ihren Firmen sparen, sondern auch im ganzen Umfeld. Alle sollten Federn lassen - die eigene Lobby aber zuerst. Lange kämpften die Sanierer mit Gegnern in den eigenen Reihen. Den Durchbruch schafften sie erst bei Alex Krauers Rück- zug aus der Branche. 1998 halbierte die SGCI ihr eigenes Budget und Personal. 2000 schlossen sich Handel, In- dustrie, Bankiers und Wirtschaftsförderung zum neuen Spitzenverband Economiesuisse zusammen. Zwar tra- ten Gegenkräfte auf den Plan. Der Arbeitgeberverband scherte aus. Die Maschinenindustrie trat auf die Bremse. Die rechte Offensive gelang nur halb. Doch ging sie wei- ter, auch in Bern. Gerold Biihrer, geborener Sparpolitiker, stieg jetzt beim Freisinn zum Spielmacher auf. Der Sohn eines Buchdruckers und Gewerkschafters hatte immer ge- wusst, worauf es im Leben ankommt: auf schwarze Zahlen, der Rest ist egal. So war der Schaffhauser nach dem Wirtschaftsstudium bei der UBS zum Spitzen- manager aufgestiegen, bei der FDP zum «Sparschwein der Nation». Im Wahljahr 1995 wurde er als landesweit einziger FDP-Nationalrat von Blocher öffentlich gelobt. Bührer liege, gab das SVP-Oberhaupt bekannt, wirt- schaftspolitisch «auf der richtigen Linie». Sechs Jahre danach wurde Bührer zum FDP-Präsidenten gewählt. Er gleiste an einer Rive-Reine-Tagung bei Nestlé das rechtsbürgerliche «Steuerpaket 2001» auf, das jedoch
- 90
- vom Parlament verschlimmbessert und vom Volk ver- worfen wurde. Parteichef Bührer stieß auf Widerstand, auch FDP-in- tern. Die Volksfreisinnigen der alten Schule wurden ihm lästig. Fulvio Pelli sagte Bührer ins Gesicht: «Du suchst Wähler anzusprechen, die nach rechts abwandern wol- len. Ich bin mit dieser Strategie nicht einverstanden.» Christine Egerszegi setzte Bührer beim Swiss-Life-Deba- kel 2002 unter Druck, bis er von der Parteispitze zurück- trat. Seitdem ist das präsidiale Karussell - Christiane Langenberger, Rolf Schweiger, Fulvio Pelli - nicht mehr zum Stillstand gekommen: äußeres Zeichen der immer tieferen FDP-Orientierungskrise. Die Partei folgt ihrer seit 1848 nicht enden wollenden Schrumpflogik. Nun lancierte zwar Pelli den Versuch, den Freisinn zu alter Größe zurückzuführen, illusionslos. «Es müssen ja nicht gleich 90 Prozent sein», meint er lächelnd, «aber in der politischen Mitte wäre für eine Partei von 20 Pro- zent durchaus Platz.» Der Melancholiker tat für seine Partei, als sei er von Natur aus ein Optimist und als sei das historische Konzept der liberalen, breit abgestützten Landespartei auch im Zeitalter der Globalisierung noch tragfähig. Er tat, als wolle er das Rad der Geschichte zu- rückdrehen. Der «Pelli-Freisinn» besitzt modernes De- sign, wurzelt aber in Traditionen des 19. Jahrhunderts. Eine FDP ohne Regierungsverantwortung kann sich der Tessiner nur schwer vorstellen: «Wir Freisinnigen sind doch die eigentliche Regierungspartei.» In der Schweizer Sonnenstube behauptete die FDP die Stellung einer Volkspartei mit mehr als 35 Prozent
- 91
- Wähleranteil am längsten, und Pelli ist Spross einer ur- alten urfreisinnigen Tessiner Großfamilie. Antiklerikal bis auf die Knochen, zählt er zur «vierten Generation, die aus der katholischen Kirche aus- und in keine an- dere eingetreten ist». Schon der Ururgroßvater weigerte sich, Kirchensteuern zu zahlen, und ging dafür bis vor das Bundesgericht. Die Großmutter, Vorkämpferin des Frauenstimmrechts, ließ sich mit 77 Jahren noch ins Kantonsparlament wählen. Der Vater war Rechtsanwalt und während 16 Jahren populärer Stadtpräsident von Lugano. Papa baute Spitäler und Staudämme, beaufsich- tigte Elektrizitätswerke und präsidierte die Kantonal- bank. In Lugano hatte die FDP damals 55 Prozent der Wähler hinter sich. So machte das Regieren natürlich noch richtig Spaß. Freisinn und Volk gingen ineinander über. Der Vater ging im Gemeinwesen auf. Fulvio Pelli wäre fürs Regieren wie geboren, nur ka- men ihm leider die nötigen Wähler abhanden. Zwar trat er in Vaters Fußstapfen und wurde ebenfalls Anwalt und Politiker, doch im Tessin störte Marina Masoni, und bei den Bundesratswahlen 2003 überholte ihn Hans-Rudolf Merz. So übernahm Pelli eben die Parteiführung, erst im Tessin, dann im Bund. Diese Rolle ist ihm inzwischen auf den Leib zugeschnitten. Der letzte Fackelträger des Volksfreisinns präsidiert seine schwindsüchtige Staats- partei mit melancholischer Grandezza. So gut er kann, widersetzt er sich jenen medialen Schaukämpfen, die, nach seiner Meinung, den Aufstieg des SVP-Populismus überhaupt erst möglich gemacht haben. Deshalb forderte Pelli auch die Abschaffung der
- 92
- Fernseh-Arena, schimpfend: «Die FDP des Präsidenten Pelli ist bereit, über alle Themen der Schweizer und der internationalen Politik zu sprechen, wird aber nie die Shows von Herrn Blocher mitspielen.» Tut nichts, Bundesrat Blocher kann auf andere FDP- Mitspieler zählen, etwa auf seinen Gerold Bührer, seit 2006 Präsident des Dachverbands Economiesuisse. Be- reits am Tag nach Bührers Nomination durch Marcel Ospel (UBS) und Rolf Dörig (Swiss Life), während der Herbstsession der Eidgenössischen Räte in Flims, stieg im Bündnerland hinter dicken Mauern ein stimmungs- volles Fest. Der designierte Economiesuisse-Präsident Gerold Bührer besuchte mit 25 handverlesenen Ratskol- legen in aller Heimlichkeit Christoph und Silvia Blocher auf ihrem nahe gelegenen Schloss Rhäzüns. Die rech- ten Koryphäen verbrachten einen - wie Bührer noch im Rückblick schwärmt - «tollen» Abend; man habe gemein- sam bis «weit über Mitternacht hinaus» Lieder gesungen und Witze gerissen. Die hohen Herren, gutgelaunt und tatenfroh, haben unverkennbar Großes vor. Sie sind jedoch noch lange nicht am Ziel. Die Zerstörung des Freisinns alten Zu- schnitts ist noch nicht vollendet.
- 93
- WIE DIE MEDIEN die Parteien überwältigen und wann die Mitte mit sich selber fusionieren wird-Christophe Darbellay, Filippo Leutenegger, Hans-jürg Fehr
- Der Frühaufsteher ist tagein, tagaus der Zeit voraus. CVP-Präsident Christophe Darbellay hüpft oft schon um 4.30 Uhr aus den Federn und hat prompt Erfolg. Meist ist er besser als die andern, schneller oder jünger. Er über- schätzt sich, doch ist dies bei ihm verständlich. Ihm ge- lang zu lang zu viel. Kaum war er des Redens mächtig, rief er-vierjährig-Passanten und Nachbarn im Walliser Bergdorf Charrat zu: «Kumuliert Darbellay!» Damit warb er für Onkel Vital, der für den Nationalrat kandidierte (und die Wahl, wenn auch vier Jahre später, wirklich schaffte). Mit 32 Jahren wurde Christophe Darbellay sel- ber Nationalrat. Mit 35 war er bereits der jüngste Par- teichef der Schweiz - und Kollege von Koryphäen, die samt und sonders seine Väter sein könnten. Die «grauen Mäuse der andern Parteien» - so sprach er von Hans-Jürg Fehr (SP), Ueli Maurer (SVP) und Fulvio Pelli (FDP) - wollte er allein durch seine Jugendlichkeit deklassieren, er, Christophe Darbellay, das beste Beispiel jener «neuen Generation Politiker, die in der heutigen Medienwelt mit ihren Stars und Events geboren und aufgewachsen ist». Ohne Fernsehen, das scheint ihm klar, ist alles nichts. Anders als seine altersgrauen Mitbewerber ist Monsieur le Président von der entscheidenden Rolle der Télévision restlos überzeugt. Folgerichtig ist der frühreife Partei- christ immer auf Sendung. In der Fernseh-Arena appel-
- 94
- lierte er einmal allen Ernstes an alle Medien, «nicht im- mer nur schwarzzumalen», sondern in Zukunft «wenigs- tens 50 Prozent positive Nachrichten zu bringen». Sein Argument: «Das würde die Stimmung im Land wesent- lich verändern.» Die Medien folgten ihm natürlich nicht, sondern machten nach ihrer Manier weiter. Seitdem ist Darbellay förmlich genötigt, selbst das Positive zu sein. Zwar führt der jüngste aller Präsidenten die ideell älteste aller Parteien, in geschichtlicher Perspektive ein verselb- ständigter Wurmfortsatz des politischen Katholizismus. Doch für diese Partei strahlt der Spontifex maximus mit seiner Bundesrätin Doris Leuthard umso fröhlicher ins Land hinaus. Der Star erglänzt in medialen Räumen, die von der un- heiligen Konkurrenz ausgemessen und abgesteckt wor- den sind. Die Sendegefäße, denen Darbellay so viel Be- deutung gibt, hat sein Zürcher FDP-Ratskollege Filippo Leutenegger geschaffen und geprägt, als er noch Star- moderator und Chefredaktor des Schweizer Fernsehens war. Auf den emeritierten Halbgott des TV gehen Arena, Elefantenrunde und ähnliche Einrichtungen zurück, in denen die Darbellays auf- und untergehen. Nun beurteilt Leutenegger die Fernsehtauglichkeit des CVP-Präsiden- ten aus kühler Distanz: «Er fällt in der Elefantenrunde leider ab.» Das Hauptproblem Darbellays liege, so Leu- tenegger, nicht etwa in Sprache oder Ausdruck, sondern darin, dass er keine Strategie habe. Im Übrigen teile Dar- bellay seine Irrtümer mit vielen Politikern. Die meisten handelten, schmunzelt Leutenegger, nach dem «Motto: Bin ich im Fernsehen, existiere ich.» Ihn befremdet die
- 95
- nach seinem Eindruck allenthalben grassierende «Wei- gerung, erwachsen zu werden», ein Trend, auf den er durch den amerikanischen Bestseller Die kindliche Ge- sellschaft aufmerksam geworden ist. «Achten Sie hier im Bundeshaus nur einmal auf all die Politiker, die wie in einem Hamsterkäfig nach Auftritten haschen und atem- los von einem Termin zum andern hetzen, als käme es darauf in der Tat an. So fallen die realen Entscheide ja in Wahrheit nicht. Das alles hier ist ein Riesenleerlauf.» Solange er Starmoderator und Zampano des Arena- Zirkus war, umschwirrten ihn die Volksvertreter in der Wandelhalle wie die Motten das Licht. Heute sieht er, selbst Gewählter, die Rolle des Fernsehens im Bundes- haus nüchterner als Ratskollegen, die um Flaupt- und Nebenrollen in medialen Ersatzwirklichkeiten buhlen. Unter Einfluss des Leitmediums ändert sich der Stil des Hauses: mehr Zank, mehr Gags, mehr Show, Ankün- digung statt Leistung, Behauptung statt Beweisführung, permanente hektische Umwertung aller Inhalte; Umwelt ist mal Gähn-, mal Megathema, desgleichen Europa, Kampfhunde, Islam und Atom. Die gesetzgebende Ge- walt unterwirft sich Sehgewohnheiten eines zappenden Souveräns. Die Zerstörung politischer Kultur macht be- achtliche Fortschritte. Es fehlte nicht an Warnungen zur rechten Zeit. Gegen die Einführung des Fernsehens stemmte sich SVP-Bun- desrat und Justizminister Markus Feldmann (1952-58). Im Kollegium verurteilte er 1954 «die Züchtung» des «künstlichen Bedarfes nach Fernsehen». Resolut be- kämpfte er die Fernsehwerbung, weil «nach allen ameri-
- kanischen Erfahrungen jedenfalls kein Grund» bestehe, «eine Institution zu finanzieren, die in den Auswir- kungen in weitem Maße einem Nervenkrieg gegen das eigene Volk gleichkommt». Bundesrat Feldmann, ehe- dem £rmr/-Chefredaktor, verteidigte die gute alte Presse gegen die drohende Bilderflut mit allen ihren Folgen. Er dachte staatspolitisch: «Der Widerstand der Presse gegen die Reklame im Fernsehen ist verständlich; die Presse wehrt sich für die Erhaltung ihrer wirtschaft- lichen Substanz; es kann einem demokratischen Staate nicht gleichgültig sein, ob die politische Presse ihrer Aufgabe, das Volk aufzuklären, auf gesunden wirtschaft- lichen Grundlagen gerecht werden kann oder nicht.» Bundesrat Feldmann bewies Weitsicht, war aber chancenlos. Was er die politische Presse nannte - welt- anschaulich fundierte, parteipolitisch engagierte Blät- ter -, nach damaligem Sprachgebrauch der «Bannwald der Demokratie», ist fast verschwunden. An ihre Stelle sind Forums-, Boulevard- und Gratiszeitungen getre- ten, die veränderten Ansprüchen genügen möchten. Einst hatten Redaktion und Abonnent ihren gegebe- nen Standpunkt, der Tag für Tag schreibend und lesend fortentwickelt wurde - so zumindest das Ideal. Anders ist es heute: Anything goes. Die von Feldmann voraus- gesagten Folgen des Fernsehens stellen sich alle ein, nach und nach, doch ausnahmslos. Der «Nervenkrieg» eskaliert. Noch beherrscht der Markt nicht restlos alles. Da und dort überleben politisch gewollte Strukturen: starkes öffentlich-rechtliches Fernsehen und Radio, indirekte
- 97
- Presseförderung durch verbilligte Posttarife. Filippo Leutenegger, altbewährter Feldmarschall im medialen «Nervenkrieg», war 2003 entschlossen, auch diese letz- ten Widerstandsnester auszuheben. Der Ex-Fernseh- raann war inzwischen nicht nur Chef des Jean-Frey- Verlags (Weltwoche, Bilanz) und Nationalrat, darüber hinaus hätte er - bitte nicht weitersagen - ins zehnköp- fige Präsidium des Verbands Schweizer Presse gewählt werden sollen. Der Plan misslang - der passionierte Liberalisierer der Medienmärkte hatte zu viele Verleger gegen sich. In seinem Fach unterlag er deshalb auch im Rat. Der einst von Feldmann angeführte Widerstand der Presse ist doch noch nicht ganz abgestorben. Die globale Mediengesellschaft bricht sich freilich Bahn. Filippo Leutenegger erahnte ihren Fluchtpunkt früh. Der Schöpfer der Arena nahm in seinen jungen Jahren Maß am alten Rom. Nichts liebte der Sohn eines Schweizer Mitarbeiters der Welternährungsorganisation FAO in der Ewigen Stadt mehr, als «im Kolosseum auf einem Stein zu sitzen und sich vorzustellen, was die alten Römer alles trieben». In der berühmtesten Arena der Weltgeschichte bekämpften sich Gladiatoren auf Tod und Leben. Der am Boden liegende Verlierer wurde nach Laune des Publikums verschont oder durchbohrt. So weit ging Leutenegger nicht, als er 1993 seine Fern- seh-Arena einführte, doch bestand auch er auf Zwei- kampf, Gewinner, Verlierer und mitfieberndes Publikum. Seine besten Gladiatoren wurden Christoph Blocher und Peter Bodenmann. Beiden brachte Leutenegger mühelos die ihnen für seine Dramaturgie fehlenden Griffe und
- 98
- Kniffe bei. Blocher musste noch den schnellen Einstieg üben. Der Fernsehmann schärfte dem SVP-Volkstribun dringend ein: «Am Anfang nur kurz reden, nicht lang, sonst redet der Gegner nachher noch länger, und das Ganze versackt.» Bodenmann musste, laut Leutenegger, bloß aufhören, «zu kompliziert» zu argumentieren - das heißt, zu viel zur Sache zu reden -, schon steigerte er sich zum mitreißenden Streiter. Bodenmann war schon lang ein Mann vom Fach. Mit seinem Kampfblatt Rote Anneliese hatte der Sohn eines CVP-Ständerats die Walliser Notabein in Serie erledigt. Als Nationalrat und SP-Präsident übertrug er seinen Dreh - die Skandalisierung politischer Gegner - auf den Rest des Landes. So trieb er die Kopp-Affäre nach Kräften voran. Der Sturz der Bundesrätin brachte aber nicht die erhoffte Abschaffung jeder politischen Polizei. Boden- mann sah sein Dilemma klar. «Jeder Skandal», grübelte er, «will den Kopf. Ist aber der Kopf weg, so ist das Pro- blem scheinbar gelöst.» Er studierte Bücher zur Theorie von Skandalen. Er fand des Rätsels Lösung nie. Dennoch forderte er weiter Kopf um Kopf, umsonst. 1992 ging er gar auf den Kopf der Köpfe, Christoph Blocher, los. Der SP-Chef verteilte Flugblätter vor den Toren der Ems- Chemie («Herr Blocher, Sie sind ein Lohndrücker!»). Der SVP-Patron reagierte gekonnt. Er erkor den alten 68er zu seinem Lieblingsgegner. So fanden beide Gladiatoren ihre Rolle; sie waren für eine Arena reif, bevor die Fern- seh-Arena entstand. Filippo Leutenegger musste den Knoten nur noch schürzen. Der schärfere Ton der neuen Sendung erfüllte seine
- 99
- Zwecke: mehr Zuschauende für SF DRS, mehr Wäh- lende für SVP und SP. Die Zerstörung der Gesprächskul- tur hatte Methode, die Polarisierung nahm ihren Lauf. Bio eher-Partner Christoph Mörgeli führte die Methode ad absurdum, indem er sie häufig zur Beschimpfung ver- gröberte. Mörgelis Zielscheiben - ob Politiker, Unterneh- mer oder Intellektuelle - waren bei ihm oft genug Hass- oder Witzfiguren, meist Heuchler oder Günstlinge, kurz, Täter ohne achtbare Motive. Er ließ sich mit Bodenmann bemerkenswert fugenlos zum Duo kombinieren, erst im Gratisblatt Metropol, dann in der Weltwoche. Nach gän- giger Meinung trennt die Scharfmacher alles, doch eint sie die Geringschätzung von Mitte, Maß und Dialog. Die große Koalition der polaren Kräfte hat das Schwerfeld der politischen Mitte schrumpfen lassen. Per saldo re- sultieren Brot und Spiele, Spektakel in Permanenz. Die Gestaltung der Gesellschaft mit politischen Mitteln löst sich auf in Schall und Rauch. Hans-Jürg Fehr, wie Bodenmann vom linken Jour- nalisten zur Parteispitze aufgestiegen, ist, wie er selber sagt, «kein Mann der Spektakel». Er sei «das Gegenteil von Peter Bodenmann». Der Arbeitersohn vom thurgaui- schen Bauerndorf Rheinklingen hätte gern einen andern Ton angeschlagen. Er befürwortete Selbstdisziplin und verlangte sie auch von Genossen, selbst im Kampf gegen rechts. Er bestand auf «anständigem Umgang mit politi- schen Gegnern - das schließt einen kämpferischen, har- ten Ton nicht aus». Auf SVP-Provokationen wollte er «am besten gar nicht reagieren». Verlorene Liebesmüh, die reale Medienwelt gehorcht anderen Gesetzen. Sein Pro-
- 100
- blem: Beide Polparteien, SVP wie SP, sind an der Polari- sierung hochgradig interessiert. Der SP-Präsident schwamm gegen den Strom, solang es ging. Die Widersprüche, in die er dadurch geriet, hat- ten ihn schon seit Jahrzehnten in Atem gehalten. Er er- schrak bereits, als er beim Geschichtsstudium in Zürich Aufstieg und Niedergang der Arbeiterpresse untersuchte. Als Wissenschafter gelangte er zur These, der Verfall der Arbeiterpresse sei unvermeidlich. Als Sozialdemokrat weihte er sein Leben dem Versuch, seine These durch sei- nen Einsatz zu widerlegen. Seit 1979 schuftet und kämpft er fürs Überleben der Schaffliauser AZ, mitunter bis zum Umfallen. Für sie tat er alles. Sie schrumpfte dennoch. Er reduzierte sein AZ-Arbeitspensum notgedrungen. Er hatte Glück im Unglück, als er 1999 zum Nationalrat und 2004 gar zum Parteichef gewählt wurde. Sein Lokalblatt gab er trotzdem nicht auf. Ihm widmet er womöglich mehr Zeit und Kraft, als sich ein Parteipräsident leisten kann. Seine AZ, sagt er voll Arbeitsstolz, sei eine der letz- ten SP-nahen Zeitungen des ganzen Landes. In der Bundespolitik aber war damit für die Partei kein Blu- mentopf zu gewinnen. Im Wahljahr 2007 gab Fehr dem Druck der Genossen nach. Auch er musste mit mehr Pro- vokationen arbeiten. Er ist vom Markt, den er überlisten wollte, seinerseits überlistet worden, selbst er, wie Bo- denmann, nur anders. So fordert die mediale Polarisierung im Bundeshaus ihren Tribut von allen - genauer: fast allen. Wetzt Natio- nalrat Hans-Jürg Fehr hinüber in den stilvollen Stände- rat, so wundert er sich oft über die fremde Welt, die in
- 101
- der kleinen Kammer allem Zeitgeist trotzt - zu Fuß nur fünfzig Meter von der geräuschvollen Volkskammer entfernt, im Geist indessen meilenweit. Seine Genossin Simonetta Sommaruga beißt im Ständerat auf Granit, fordert sie von ihren stolzen Kollegen mehr Transparenz in eigener Sache. Die Bernerin hatte keine Chance, als sie ihnen einmal vorschlug, dem Beispiel des Nationalrats zu folgen und das elektronische Abstimmungsverfahren auch im Stöckli einzuführen; so könnten, argumentierte sie, die Wählenden die Gewählten besser kontrollieren. Aufbrausend widersprach Peter Bieri, Ständeratsprä- sident 2007. Der Zuger Christdemokrat brandmarkte den «Druck gewisser Medien auf das Parlament». Er gei- ßelte Ratings für Gewählte. Durch solche Listen und Tabellen würden «Ratsmitglieder einer Viehausstellung oder einem Miss- oder Mister-Wettbewerb gleich vor- geführt». Bieri verteidigte trotzig das Bestehende: «Was zugegebenermaßen mit einer geringeren Transparenz verbunden ist, machen wir in diesem Saale mit einer besseren zwischenmenschlichen Atmosphäre, einer of- feneren Gesprächskultur, einer unabhängigeren Ent- scheidfindung und weniger Partei-, dafür mehr Sach- politik wett.» Selbst CVP-Präsident Christophe Darbellay schüttelt den Kopf, wenn er Parteifreunde drüben im Ständerat so reden hört. Ihn störte die Intransparenz von Abstim- mungen der kleinen Kammer schon persönlich. So hätte er gern gewusst, wie das knappe Nein zu seiner Motion für die erleichterte Einreise chinesischer Touristen im Ständerat zustande kam (15 zu 14 Stimmen), nachdem
- 102
- der Nationalrat so klar zugestimmt hatte (150 zu 13). Auch CVF-Ständeräte müssen mit Nein gestimmt haben, doch will es keiner gewesen sein. Dass sich die Ständeräte weigern, ihr Abstimmungs- verhalten registrieren zu lassen, ist unzeitgemäß. Ihr Widerstand gegen die mediale Polarisierung jedoch hat tiefere Gründe, als Nationalräten - selbst Parteichefs - zumeist bewusst ist. Schon die Schaffung des Stände- rats als eine mit dem Nationalrat streng gleichberech- tigte Kammer 1848 war ein Zugeständnis des Freisinns an die besiegten katholischen Sonderbundskantone, ein Geschenk, das diese mit dem neuen Staat versöhnen sollte. Heute sind FDP und CVP im Ständerat noch im- mer die zwei größten, im Nationalrat hingegen längst die zwei kleinsten Regierungsparteien - das andere Wahl- verfahren macht's möglich. So ist das Stöckli zur Trutz- burg der Mitte geworden - und zur Bastion politischer Gesprächskultur. Rettet der Ständerat jetzt die ernst- gemeinte Auseinandersetzung über Inhalte, so verteidigt er auch den Lebensnerv der Demokratie. Das ist allerdings eine Aufgabe, die vom Ständerat alleine nicht zu lösen ist. Die Parteien der Mitte müs- sen selber wieder Tritt fassen. CVP und FDP handeln un- ter Druck der Polarisierung kopflos. Sie lassen sich von SVP und SP gängeln und gegeneinander ausspielen. Beide Mitteparteien ächzen unter ihrem enormen histo- rischen Ballast - ihren Konflikten vom Sonderbunds- krieg 1847/48 bis zur Metzler-Abwahl 2003. Sie versäum- ten ihre eigene Modernisierung. Ihre konfessionellen Gegensätze wirkten viel zu lange nach. Sie blieben in der
- 103
- Falle der Herkunft gefangen. Ihnen blieb eine Stunde null erspart, wie sie nach Kriegsende 1945 in Deutsch- land den Neustart der ganzen Parteipolitik nötig und die Gründung der überkonfessionellen CDU/CSU möglich machte. In der Schweiz gerieten CVP und FDP durch die Polarisierung der letzten 25 Jahre unter die Räder. Ihr Wähleranteil sank von 45 auf 30 Prozent. Darauf reagie- ren sie kurzsichtig. Wurden die Freisinnigen durch ihre Flügelkämpfe zerrieben, ergriffen die Parteichristen die Flucht nach vorn, verjüngten ihre Führung radikal und unterwarfen sich der Mediatisierung. Die Schweiz aber benötigt - um ihres inneren Gleichgewichts willen - eine Mitte, die ihrer historischen Aufgabe gewachsen ist. Konkret fällt CVP-Präsident Christophe Darbellay in dieser Lage eine Führungsaufgabe eigener Qualität zu. Er müsste den Zusammenschluss seiner Partei mit dem Freisinn zu einer neuen großen Landespartei der Mitte vorbereiten. Freilich verfügt Christophe Darbellay, auf die Medien fixiert, noch nicht bei allen Parteifreunden über die nötige Autorität. Seine Ständeratskollegen lie- ben ihn, aber mbH. Der CVP-Präsident ist durchaus ent- schlossen, seine Führungsrolle auszufüllen. Er schließt auf eine lange Sicht selbst eine Fusion der Mitteparteien nicht aus. Er betont jedoch: «Wir haben zurzeit andere Prioritäten.» In den kommenden Jahren müsse die Par- tei, sagt er, erst einmal aus eigener Kraft erstarken. Hier wie überhaupt gilt bei Christophe Darbellay: Was nicht ist, kann noch werden.
- 104
- WO SICH DER ALTE FILZ AUFLÖST und welche Chancen robuste Einzelkämpfer dadurch erhalten - Peter Spuhler, Paul Rechsteiner, Johann Schneider-Ammann
- Peter Spuhler saß im Nationalrat und ahnte nichts Böses. Plötzlich saß neben ihm Paul Rechsteiner, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB), und drohte ihm mit Konsequenzen. Seine Firma könne öf- fentliche Aufträge glatt vergessen, wenn er keine Ein- sicht zeige und sich weiter weigere, mit Gewerkschaften einen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) auszuhandeln. Der hünenhafte Schienenfahrzeugbauer lenkte am Ende ein, doch findet er beharrlich den giftigen Roten seitdem ge- wöhnungsbedürftig. Paul Rechsteiner macht die bockigsten Gegner gefü- gig, zeigt er ihnen nur das eine oder andere seiner Folter- werkzeuge: wenn nicht Ausschluss von öffentlichen Aus- schreibungen, dann Streik, Prozess, Flugblatt, Medien, Umzug, rote Fahnen, Trillerpfeifen, Motion, Referen- dum, Ja- oder Nein-Parole - egal, Flauptsache Wirkung. Der linke Rechtsanwalt liebt klare Fronten. Eines ist ihm nur zu gut bewusst: Recht haben und recht bekommen ist auf Erden zweierlei. Dazwischen liegen die Welten, die er laufend neu durcheilt, ständig außer Atem. Nie ist er bereits dort, wo er sein möchte. Er hat keine Zeit für Krimskrams. Paul Rechsteiner muss das Land verändern und ist doch schon Mitte fünfzig. Meist mit Siebenmeilenstiefeln und Laptop unter- wegs, geht er in seinen Mandaten auf. In Rats- und Ge-
- 105
- richtssälen schlägt er sich verbissen für Arbeiter, Rent- ner, Mieterinnen. Ihm fehlt die innere Ruhe. Er stammt aus einfachen Verhältnissen und ist ein komplizierter Charakter. Er kommt aus der sozialen Kälte, unter der St. Gallens ärmere Schichten litten. Der Vater hatte als Bahnarbeiter einen Unfall. Der Gramper musste Schotter unter Schwellen hämmern, dabei flog ihm ein Stein ins Auge. Seitdem halbblind, erhielt Vater Rechsteiner eine mickrige SUVA-Rente; er wurde Putzer und Packer in der Bank-, Buch-, Presse- und Textilbranche. Daheim gab es kein Bad, kein Fernsehen, dafür Religion. Im Gegensatz zu seinen sehr katholischen Eltern glaubt Paul Rechstei- ner an keinen Gott. Er hat genug damit zu tun, gegen das irdische Jammertal zu revoltieren, das rechtschaffenen Menschen in diesem Lande blühen kann. Durch seinen erbitterten Kampf für eine gerechtere Schweiz ist er höchster Gewerkschafter geworden. Im Bundeshaus macht er Spuhler & Co. nach Kräften die Hölle heiß. Bei der Altersvorsorge verhinderte er So- zialabbau. Bei den bilateralen Verträgen zwischen der Schweiz und der EU erstritt er, nach seinen Begriffen, gar Fortschritt: eine Art Staatsgarantie gegen Lohndum- ping. Listig stellte er in einer Arbeitsgruppe dafür die Weichen, ehe ein Rat oder auch nur eine Ratskommis- sion zum Zuge kam. Die SVP schäumte. Wütend zog Spuhler im Rat gegen Rechsteiners «flankierende Maß- nahmen» vom Leder: «Es kann nicht sein, dass zwi- schen Gewerkschaften, Arbeitgeberverband und auch dem Bundesrat bereits ein Päckli geschnürt wird, be- vor der politische Prozess beginnt! Das darf nicht sein
- 106
- und kann nicht sein!» Genau so war das alles aber eben doch. Rechsteiners Sieg durch Präventivkrieg im Hinterzim- mer zeigte deutlicher als sonst, was aus dem Rat in vielen Fällen geworden ist: eine Schaubühne schon geschlage- ner Schlachten. Was Spuhler derart empörte, war nicht, dass vom Dienstweg abgewichen wurde, sondern dass das Ding die Falschen drehten - ohne Spuhler oder einen seiner Freunde. Er selber ist Networker der Sonderklasse. Hoch geht es her, wenn er am Mittwoch der letzten Ses- sionswoche mit den Ratskollegen der Gruppe «Fun, Food & Politics» tafelt. Er lädt auch Linke gern zu Tisch. Der einnehmende Bilderbuchkapitalist hält sich ans Prinzip: «Ich gebe, damit du gibst.» Außerdem kann er weit über die Parteigrenzen hinaus mit rein persönli- chen Sympathien rechnen - so unterstützte ihn etwa der kämpferische Basler Sozialdemokrat Remo Gysin einmal ganz spontan, als der Großraum Basel neue Trams benö- tigte. Spuhler erhielt von den Basler Verkehrsbetrieben und der Baselland Transport AG den Auftrag, 2009 bis 2014 gleich sechzig Niederflurtrams zu liefern. Das sind, aufs gesamte Berner Beziehungsgeflecht ge- sehen, Petitessen. Die Öffentlichkeit hat vom Umfang des Treibens der Lobbys rund ums Bundeshaus keine Vorstellung. Das Tischlein deckt sich für National- und Ständeräte am laufenden Band. Manche Gewählte wan- dern von einem Anlass zum andern - Apero, Vortrag, Frühstück, Empfang, Mittag- oder Abendessen -, ja fut- tern sich gratis durch ganze Sessionen, dauernd um- worben, geladen, beraten und bewirtet von Lobbys und
- 107
- Firmen, Ämtern und Klubs, Verbänden und Foren, von Pharma, Banken, Strom, Sport, Fleisch, Swisscom, Wer- bung, Zement, Transport, Tourismus, Konsumenten und Handelskammern noch und noch. Es ist der altberühmte Filz, nur hat er sein Gesicht geändert. Selbst an ihm ging die Globalisierung nicht spurlos vorbei. Konzerne, die aufs weltweite Geschäft schauen müssen, haben mit den Räten nicht mehr allzu viel zu schaffen. Und sind ihre Interessen doch einmal berührt, sehen sie lieber gleich selbst nach dem Rech- ten - und nicht über ihre nationalen Branchen- oder Dachverbände. UBS, CS und Privatbankiers schicken eigene Lobbyisten in die Wandelhalle, obwohl dort für sie ja schon die netten Herren von Swiss Banking fleißig ihre Runden drehen. Die Atomisierung der Interessen hat im Bundeshaus spürbare Folgen. Fünfhundert be- zahlte Lobbyisten treten sich auf die Füße. Eine Szene, wie geschaffen für expansive Einzelkämpfer in den Rä- ten selber, beispielsweise für Peter Spuhler. Er imponiert schon durch die Körperpräsenz: 1,88 Me- ter groß, hundert Kilo schwer. Er bezwingt die Menschen durch das Exzessive seines Wesens. Bald großzügig bis zur Verschwendung, bald fortgerissen von eisiger Ent- schlossenheit, verweigert er sich dem Geist der Mäßi- gung, der einem arrivierten Thurgauer Unternehmer und SVP-Nationalrat nach alter Sitte anstehen würde. In seinem Innern brodeln Säfte, die ihn immer, ob als Ge- schäfts- oder Ratsherr, Fallschirmspringer oder Grena- dier, förmlich zwingen, seine «Grenzen auszuloten». Er muss allzeit «den Gegner spüren». Kampfsport war lange
- 108
- Zeit sein Element: «Ich wäre gern Star im Eishockey ge- worden.» Auf dem Glatteis hatte der GC-Spieler mit fünf- undzwanzig Jahren seinen schwersten Unfall. Dreimal musste er am Sprunggelenk operiert werden. Heute hebt der Vizepräsident der ZSC Lions, im Berner Fauteuil sit- zend, den rechten Fuß wie eine Trophäe auf Kopfhöhe und bewegt das lädierte Gelenk ganz langsam hin und her: «Hören Sie das leise Knacken?» Ist man gehörig be- eindruckt, senkt er den Fuß wieder, sichtlich befriedigt. Seine Schweiz ist ein Land der unbegrenzten Mög- lichkeiten. Der CEO aus Bussnang wuchs schneller als alle Rivalen. Er ist ein halber Milliardär geworden, ebenso vermögend wie der freisinnige Maschinenindus- trielle Johann Schneider-Ammann, der einzige andere der zweihundert Nationalräte, der wie Spuhler zu den zweihundert reichsten Schweizern zählt. Beide haben sich als Arbeitgeber auf schwierigen Märkten glänzend geschlagen: Der thurgauische Schienenfahrzeugbauer expandierte in anderthalb Jahrzehnten sensationell von 18 auf 2500 Beschäftigte, der bernische Bauzulieferer re- spektabel von 1000 auf 2600. Die Ausgangslage war nicht dieselbe. Johann Schnei- der, ETH-Ingenieur, heiratete in eine seit dem 19. Jahr- hundert in Langenthal etablierte Unternehmerfamilie ein. Der Sohn eines Emmentaler Tierarzts und SVP- Großrats vermählte sich mit seiner ehemaligen Mitschü- lerin und Mitstudentin Katharina Ammann. Nicht dass sein Aufstieg zum Chef der Firma schon geplant gewesen wäre. Anders als durch Heirat oder engen Anschluss an eine bereits etablierte Unternehmerfamilie allerdings
- 109
- haben in der Schweiz auch die Tüchtigsten geringe Chancen, noch zu Lebzeiten selbst zu Unternehmern dieser formidablen Größe aufzusteigen. Dies entgegen dem liberalen Grundsatz der Chancengleichheit, wie ihn die FDP Schweiz zum Beispiel in ihrer Wahlplattform 2007 salbungsvoll proklamierte: «In einer offenen, siche- ren und toleranten Schweiz haben alle Menschen die gleichen, guten Voraussetzungen zur Verwirklichung ihrer individuellen Lebenspläne.» Peter Spuhler, Sohn des Chefkochs des Grand Hotel Dolder in Zürich, glaubte am Anfang an den Freisinn und seine Slogans. Der FDP-Stammwähler wollte in die Geldbranche einsteigen. An der Hochschule St. Gallen büffelte er Bankwirtschaft. Er merkte erst während eines Praktikums bei der UBS, dass «die hierarchisch geglie- derte Welt der Banken für mich das Falsche» war. In ihm wehrten sich Instinkte, die ihn im Sport bereits be- herrschten. Der auf der Eisfläche dahinflitzende Macht- brocken imponierte der Tochter eines Lehrers und Enke- lin des 1981 gestorbenen Gründers des Fahrzeugwerks Stadler. Sie bat ihn im Fitnessstudio um ein Autogramm. Er gab ihr das Autogramm, verliebte sich in sie, heiratete sie und kaufte 1988 die Firma mit einem Sechs-Millio- nen-Kredit derThurgauer Kantonalbank. Sogar Spuhler begann als Unternehmer nicht ganz bei null. Der 18-Personen-Betrieb konnte, als er ihn erwarb, auf mehr als fünfundvierzig Jahre Geschichte zurück- blicken. Der ehrgeizige Draufgänger rollte die Krisen- branche von hinten auf. Er schlug die Großen um Län- gen. Der kleine Fahrzeugbauer war beweglicher als sie.
- 110
- Er arbeitete auch günstiger, weil er mit Gewerkschaften noch nicht kooperieren musste. Bei den Thurgauern war der Held der Arbeitsplätze populär. Er erzielte bei der Wahl zum Nationalrat 1999 neuen Thurgauer Rekord: 30407 Stimmen. Im Parlament wusste er sofort, mit wem er sich mes- sen musste. Johann Schneider-Ammann, ebenfalls Rats- neuling, stand seit kurzem an der Spitze von Swissmem, dem von Großfirmen dominierten Branchenverband (920 Firmen, 310 000 Beschäftigte). Jetzt hatte der Berner den Thurgauer im Nacken. Spuhler wurde Präsident des konkurrierenden Verbands Swissmechanic, der Ge- samtarbeitsverträge mit Gewerkschaften ablehnt (1300 kleinere und mittlere Firmen, 55000 Mitarbeiter). SVP- Spuhler warf FDP-Schneider vor, beim Einsatz für die Unternehmer «zuwenig Leidenschaft» zu zeigen. Der Ostschweizer unterschätzte des Berners Tempera- ment. Schneider-Ammann ist stets verständig und meist beherrscht, doch tief im Innern brodelt ein Vulkan. «Wir sitzen alle im gleichen Boot», mahnte er einmal in aller Ruhe auf einem Podium in Langenthal. André Daguet, Unia-Gewerkschafter und SP-Frontkämpfer, erwiderte hitzig: «Dann rudern wir aber in entgegengesetzter Rich- tung.» Schneider-Ammann erboste sich bereits. Daguet doppelte nach und zählte Namen unfähiger Arbeitgeber auf. Schneider-Ammann war außer sich. Die beiden zerstritten sich total. Noch Jahre später weigerte sich Schneider-Ammann, in der Arena mit Daguet auch nur zu diskutieren. Seine - sich nur selten zeigende - Begabung zur Un-
- 111
- Versöhnlichkeit kam Schneider-Ammann zugute, als er im Dachverband Economiesuisse den Kampf für den Werkplatz Schweiz aufnahm. Er überwarf sich mit Mar- cel Ospel. Der Industrielle wehrte sich auf dem Olymp der Wirtschaftskapitäne gegen die Dominanz der Fi- nanz. Schneider-Ammann verteidigte die stolze Tradi- tion seiner Branche. Über Generationen hinweg hatten sich Maschinen- und Chemieindustrie die Führung des Spitzenverbands geteilt. Jetzt wurden beide durch die Finanzbranche verdrängt. Dem Swissmem-Präsidenten war die Machtbasis abhanden gekommen. Seine Bran- che war im Inland durch globalen Kostendruck brutal dezimiert worden. Dennoch forderte er Ospel im Spitzenverband zum Machtkampf heraus. Der Konflikt eskalierte rasch zum Streit um Ospels Lohn. In dieser Sache war am Anfang auch für Peter Spuhler alles klar. Er übertraf noch Schneider-Ammann im Protest gegen die Absahner. 2002 schimpfte Spuhler im Nationalrat: «Die Abzockerei, über die in den letzten zwölf Monaten geschrieben worden ist, verurteile ich genau so wie zum Teil die linke Seite.» 2003 war er dann «völlig überrascht», als ihm Ospel bei einem Besuch in Bussnang das Du und einen Sitz im UBS-Verwaltungsrat antrug. Kaum gewählt, kam er auch in den Vergütungsausschuss. Seitdem muss er mit zwei Kollegen für die höchsten Löhne der größten Bank gera- destehen und äußert sich zum Thema ausweichend. Glo- bal Players spielten eben, sagt der gewiefte Taktiker im Jargon des Eishockeyfreunds, in einer andern Liga. Beweglichkeit ist das halbe Leben. Spuhler kann,
- 112
- wenn er will, scheinbar mühelos alle Gräben überbrü- cken. Er versteht sich auf Menschen. Mit der ersten Frau blieb er auch nach seiner zweiten Heirat in Kontakt. Er macht aus jeder Situation das Beste. Von Paul Rechstei- ner massiv unter Druck gesetzt, setzte sich Spuhler mit Unia-Gewerkschafter André Daguet an einen Tisch und handelte mit ihm einen individuellen Firmenvertrag aus, dies freilich unter Beibehaltung der 42-Stunden- Woche - entgegen dem Branchen-GAV, der die 40-Stun- den-Woche vorschreibt. Daguet akzeptierte, weil Spuh- lers Deal ansonsten großzügig war. So konnten beide auch ihrem gemeinsamen Kontrahenten und Kollegen Schneider-Ammann eins auswischen. Schmunzelnd errötet das linke Schlachtross Daguet, wenn ihn der hemdsärmlige UBS-Verwaltungsrat Spuh- ler in der Wandelhalle mit einem freundschaftlichen Boxhieb auf die Brust begrüßt: «So, du trümmlige Cheib!» So verknäueln sich im Nahkampf des Bundeshauses die ärgsten Gegner zu den lustigsten Paaren. Die ideologisch größten Widersacher bilden die ausgefallensten Bezie- hungskisten. Wahlverwandtschaften zeigen sich unver- hofft, überraschende Affinitäten treten zutage. Im Rat arbeiten Branchenkollegen Hand in Hand und bekämp- fen einander hintenherum, was das Zeug hält. Nicht an- ders springen Gewerkschafter im Nationalrat miteinan- der um. SGB-Präsident Paul Rechsteiner kommt nicht allzu weit, will er mit dem christlichsozialen Freiburger Hugo Fasel, Präsident des konkurrierenden Dachver- bandes Travail.Suisse, gemeinsame Sache machen: zu- viel versteckte Konkurrenz, zuwenig Solidarität.
- 113
- Fürs Volk schlagen die Gewerkschaftsführer zwar ähn- liche Töne an. Heftig prangert Hugo Fasel «die Manager der Großkonzerne» an, die schamlos «abgesahnt» und «den Anstand verloren» hätten: «Abkassieren und ein- sacken, lautet die Parole.» Der wehrhafte Bauernsohn vergisst nur zu erwähnen, dass er sich mit den Managern seit vielen Jahren regelmäßig zur geheimen Tour d'hori- zon trifft. Er wurde in die diskrete Rive-Reine-Runde aufgenommen, als er 1989 beim Christlichnationalen Gewerkschaftsbund (CNG) zum Präsidenten aufstieg. Heute ist er eins der amtsältesten Mitglieder des Ge- heimklubs. Als Mitwisser der Machtelite lernte Fasel die Welt mit andern Augen sehen. Der Gewerkschafter posi- tionierte den CNG «immer weniger als allgemeine Orga- nisation, die etwas Gutes will - wir wollen vermehrt ein Unternehmen sein». Er wurde zum geschmeidigen Gegenspieler Rech- steiners, der an der Rive-Reine-Tagung lediglich einmal teilnahm. 2002 fusionierte Fasel seinen CNG mit den Angestelltenverbänden zur Travail.Suisse. Einen Schul- terschluss mit Rechsteiners Gewerkschaftsbund lehnte er jedoch ab. Der rote St. Galler schlug Fasel 2002 an einer Sitzung hinter verschlossenen Türen im Berner Käfigturm ein schrittweises Zusammengehen der Dach- verbände vor; dies hätte eine historische Zäsur für die schweizerische Arbeiterbewegung bedeutet. Mit am Tisch saßen alles in allem zwanzig Spitzenfunktionäre, die stundenlang miteinander diskutierten. Der Hand- schlag nach hundert Jahren Einsamkeit scheiterte an Hugo Fasel. Der Christlichsoziale lehnte bereits die Bil-
- 114
- dung einer Arbeitsgruppe ab. Das Treffen endete im Zank. Nur in einem Punkt war man einer Meinung: Niemand durfte von der ganzen Blamage erfahren. Das geplatzte Zusammengehen blieb ein streng gehütetes Geheimnis. Mit Erfolg behauptete Hugo Fasel seinen eigenen Machtbezirk gegen den größeren Partner. Das war im- mer seine Stärke, von klein auf. Der zweitjüngste Sohn einer elfköpfigen Familie war mit seinen «Gedanken nie allein - immer gab es jemanden, der mir wider- sprach». Er verbündete sich mit den einen Geschwis- tern gegen die andern, in wechselnden Koalitionen. Der Wirtschaftsstudent verfeinerte seine Streitkunst philo- sophisch. Er verschlang alles von Nietzsche, um «den Gegner besser kennenzulernen». Seine Lektüre hat ihre unübersehbaren Spuren hinterlassen. Der imposante Schnauz wirkt beim Gewerkschaftsführer wie eine Nietz- sche-Reminiszenz- sein Wille zur Macht erst recht.
- V Die Mandarine springen in die Lücke
- WELCHE CHEFBEAMTEN den Service public am Laufen halten, wie sie einst den Ausbau der Staats- macht planten und was sie davon abbrachte - Hans Werder, Ulrich Gygi
- Nicht nur Bundesrat Hans-Rudolf Merz staunte über den Vorfall. Ständerat Philipp Stähelin erschrak. Christoph Blocher wünschte nähere Auskünfte. Die höchsten Poli- tiker wunderten sich über einen Chefbeamten, der Tho- mas Moser heißt und für die NeueZürcher Zeitung einen dreisten Artikel unter dem langweiligen Titel «Die poli- tische Rolle der Bundesverwaltung» geschrieben hatte. «Wer», fragte Moser, «ist in unserem Land in der Lage, echte Reformprogramme innert nützlicher Frist zu ver- wirklichen?» Seine Antwort war eine Provokation: «Die entscheidenden Weichenstellungen in der Politik wur- den und werden von der Verwaltung vorgenommen.» Aus «klassischer Sicht» sei die Beamtenschaft nur aus- führendes Organ in der Hand der Politik, ohne eigene Strategie und «ohne Eigensinn» - doch sehe «die Realität anders aus». Keck wies Moser, der Kolloquien des Personalamts lei- tete und Kadernetzwerke knüpfte, auf die «zunehmende Vernetzung der Verwaltungsspitzen untereinander und mit den Führungskräften aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft» hin. «Politische Steuerung» erfolge
- 117
- «immer weniger über Statuten und Erlasse, sondern zu- nehmend über Geld, Wissen und Kommunikation». Die «Bundesverwaltung in ihrer politischen Rolle» werde «die Reform des Staates maßgebend vorantreiben». Der «Staat, den die Schweiz braucht», sei «unter dem Deckel der Verwaltung bereits vorhanden». Es liege im «vitalen Interesse» des Landes, dass sich «die Macht des Fakti- schen entfaltet». Die Schweiz könne nicht «auf die Politik warten, bis sie Substantielleres zur Überwindung von Finanzkrise und helvetischem Malaise» beitrage. Moser sagte viel Wahres, doch seine Frechheit ging zu weit. Im Ständerat schlug CVP-Stähelin zurück, mit gedehnter Ironie: «Ich meine, vergessen wir doch die Rechtsetzung und unsere Legislativfunktion!» Der ima- ginäre Putsch der Verwaltung wurde im Keim erstickt. Der vorlaute Anstifter wechselte vom Personal- ins Kul- turamt. Die Posse warf ein Schlaglicht auf das Betriebsge- heimnis der Berner Mechanik. Ein Putsch beim Bund war gar nie nötig. Die Verwaltung kompensiert die Schwä- chen der Politiker auch so. Per saldo resultiert ein pein- liches Demokratiedefizit. Die Wahrheit tritt zutage, so- bald der Bundesrat unter echtem Zeitdruck schwierige Entscheide treffen muss. Dann reden Spitzenbeamte plötzlich selber an den Bundesratssitzungen mit - etwa Chefdiplomat Michael Ambühl bei Krisen in den bila- teralen Verhandlungen zwischen Bern und Brüssel, Gesundheitsdirektor Thomas Zeltner bei drohenden Pandemien, Finanzverwalter Peter Siegenthaler bei Spar- paketen und Swissair-Grounding. Von ihrem Input er-
- 118
- fährt das Land meistens nichts. Sie sind Musterexem- plare einer Gattung, die den Staat im Hintergrund am Laufen hält. Den Staatsmanagern ist eine Macht zuge- wachsen, die ihnen nach Verfassung nicht zusteht - Büro- statt Demokratie, Verwaltungs- statt Volksherr- schaft. Einem echten Bürokraten ist die Macht des Faktischen genug. Nie im Leben würde sich etwa Hans Werder ihrer auch noch in der Presse rühmen. Der Generalsekretär des Departements Leuenberger nimmt dem Chef viel Arbeil ab. Der SP-Bundesrat, Vorsteher des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek), bewegt sich in höheren Sphären. Moritz Leuenberger verlegt sich auf öffentliche Auftritte und aufs Mitreden im Kollegium. Sein tüchtiger Hausmeier erledigt den Rest. Das Uvek sei, schwärmt Werder, «das bei weitem interessanteste» der sieben Departemente. Die Markt- öffnung bei Post, Energie und Kommunikation machte das Uvek zu einem neuen Wirtschaftsministerium. Unter Druck der Märkte baute Werder die ganze Grundversorgung um. Swisscom, Post und SBB erhielten volle unternehmerische Autonomie, doch im Gegenzug stärkte er die «strategische Steuerung» der Ex-Mono- polisten durch den Staat, konkret durch Werder persön- lich: Er nimmt für den Bund die Eignerrolle selber wahr. Der Sohn eines aargauischen Chefbeamten hatte für all dies keine Vorbilder. Sein neuartiges Modell ersann er als kantonaler Kader für den Berner Regierungsrat und des- sen 150 öffentliche Unternehmen (wie etwa die BLS und die Kantonalbank). Von Leuenberger ins Uvek geholt,
- 119
- übertrug er sein Konzept auf den Bund. Er baute den Leistungsstaat jedoch nur um, er schaffte ihn nicht ab. Das ärgerte seine rechten Gegner. Sie möchten nur An- gebot und Nachfrage spielen lassen: den endgültig be- freiten Markt. An Werder bissen sich die Rechten, auf schnellere Pri- vatisierung erpicht, die Zähne aus. Seine Tatkraft frei- lich anerkannte auch sein Widersacher Christoph Blo- cher. Werder sei, sagte der SVP-Magistrat bedauernd, der «beste Generalsekretär». Die beiden kennen sich als poli- tische Gegner beiläufig schon seit 68er Zeiten. Werder war bereits in der Zürcher Studentenpoiitik ein Mitstrei- ter Leuenbergers. Die Rollen, die sie heute spielen, waren quasi schon verteilt. Jurist Werder betonte in seiner Zür- cher Dissertation: «Die Bundesverwaltung stellt das ei- gentliche Steuerungszentrum der politischen Entschei- dungsprozesse dar»; die Verwaltung habe das politische Ringen «so zu organisieren und zu beeinflussen, dass zwischen den divergierenden Interessen ein allseits ak- zeptabler und damit plebiszitär tragfähiger Kompromiss erreicht wird». In dieser Kunst, wie sie Werder vor drei- ßig Jahren beschrieb, ist er heute Berner Meister. Sein Problem: «Allseits akzeptable» Kompromisse sind im- mer weniger «tragfähig». Umso wichtiger ist ihm jetzt das Networking. Jeden Monat versammeln sich Werder und seine sechs Amtskollegen der andern Departemente - Müller, Seiler, Strupler & Co. - zu ihrem rituellen Schattenkabinett im Bernerhof, heute Sitz des Finanzministeriums, im 19. Jahrhundert eines der feinsten Schweizer Luxus-
- 120
- hotels. Hier soupierten und nächtigten in alten Zeiten die Majestäten und Industriellen, gingen die Herren der Welt ein und aus, etwa Kaiser Wilhelm II. von Deutsch- land, Monarchen aus Siam und Brasilien, die Barone Rothschild, Alfred Krupp, Garibaldi, General von Moltke, die Herzogin von Parma, Jacques Offenbach und Johann Strauß. In diesem noblen Ambiente wird noch heute vieles vorgekocht, was Regierung und Parlament später dem Volk als unvermeidlich servieren. Wie die Chefköche da- bei vorgehen, enthüllte Werder ebenfalls bereits in seiner Doktorarbeit: «Da die Entscheidungsprozesse in Regie- rung und Verwaltung stark verflochten sind und infor- mell verlaufen, ist es fast unmöglich, eine konkrete Ent- scheidung einer bestimmten Stelle zuzuordnen» - es sei ein «typisches Kennzeichen der schweizerischen Ver- waltungen», dass «wichtige Absprachen und Entschei- dungen am Telefon, vor oder nach Sitzungen oder auch an geselligen Zusammenkünften fallen und nirgends schriftlich festgehalten sind». Die Verwaltung werde zur «Blackbox», deren «Inputs» und «Outputs» man zwar kenne, «über deren innere Vorgänge man jedoch fast nichts weiß». Was den Bürokraten in der Blackbox Bernerhof heute die Laune trübt, ist freilich der Schuldenberg von 125 Mil- liarden Franken. Die drückenden Lasten engen ihren Spielraum ein. So tagen die Generalsekretäre denn auch öfter in der Altstadt, im Von-Wattenwyl-Haus, in wel- chem Bundesrat und Parteispitzen den Geist der Kon- kordanz seit Jahrzehnten beschwören, mit abnehmen-
- 121
- dem Erfolg. Versagt sich der Hausgeist den Regierenden, soll er nun aber doch ihre Mandarine inspirieren. Der Geist trägt einen berühmten, für Staatsdiener besonders ehrwürdigen Namen. Dicht an dicht neben dem Von- Wattenwyl-Haus lebte während Jahren Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), junger süddeutscher Haus- lehrer bei den von Steigerund später Philosoph von Welt- geltung. Er raunte: «Die Regierung ruht in der Beamten- welt.» Flegel, Haus- und Weltgeist in einer Person, sah das alte Ideal der Philosophen, die Herrschaft der Wis- senden, später im preußischen Beamtentum verwirk- licht. Er ahnte nicht das Wuchern moderner Bürokratien voraus, etwa des 1848 in Bern gegründeten Bundesstaats: Am Anfang gaben hier 50 Beamte 5 Millionen Franken aus, heute verbrauchen 30000 Beamte 50 Milliarden. Einst ein Kleinbetrieb, ist der Bund zum Großkonzern geworden, wenn nicht zum Moloch. Gepackt vom Vernunftglauben, der auf Aufklärung und Hegel zurückgeht, hielten linke Kopfarbeiter nach 1968 den sozialen Fortschritt für planbar. Sie wollten von Bern her die Gesellschaft zum Guten lenken. Hans Wer- der, an der ETH Zürich für die «politische Planung» ent- flammt, begann direkt bei der Bundeskanzlei. Ulrich Gygi, promovierter Ökonom der Universität Bern, stieg in die Finanzverwaltung ein und brachte es in Win- deseile zum Direktor. 1991, zur 700-Jahr-Feier der Eid- genossenschaft, tönte Gygi stark: «Die Schweiz der Zu- kunft als sozialer Lebensraum braucht einen leistungs- fähigen Staat und wrohl kaum <weniger Staat>.» Es kam anders. Die roten Zahlen änderten alles. Der Schulden-
- 122
- berg schwoll zu gespenstischer Größe. Gygi gab Gegen- steuer, schnürte emsig Sparpakete und führte die Schul- denbremse ein. Er und seine Genossen hatten keine Wahl. Sie mussten bei Bund, SBB und Post Tausende von Stellen opfern. Die SP-Staatsmanager waren Sanierer wider Willen. Sie hatten es sich anders vorgestellt. Ihm mache, seufzte Gygi, der «Umbau, so nötig er auch ist, keine Riesenfreude». Er lachte nur noch, wenn es sein musste. Der ehrgeizige Sohn eines Bauernknechts und Landarbeiters von Kappelen im bernischen Seeland hatte das vermeintliche Machtzentrum erobert - und jetzt plagten ihn Ohnmachtsgefühle. Er sei, meinte er, «Diener eines unheimlich schwerfälligen politischen Prozesses». Die Berner Mechanik erinnere ihn «an das Bedrohliche, ja Absurde von Kafkas verwalteter Welt - nur ohne die teuflische Bösartigkeit, die sie bei Kafka besitzt». Der rote Mandarin spürte, dass die für die Schweizer Volkswirtschaft wichtigsten Weichen anderswo gestellt wurden: nicht in der Schweiz, sondern im Ausland. Und wenn doch in der Schweiz, dann nicht im Bundeshaus, eher in der Nationalbank. Gygi träumte nun vom Auf- stieg ins Nationalbank-Direktorium, also in die Weltelite der Notenbanker. Doch konnte er für sich an keine Chan- cen glauben: Noch nie hatte ein Mitglied der SP Schweiz die Wahl in das erlauchte Gremium geschafft. So griff er im Jahr 2000 zu, als er Post-Chef werden konnte. Peter Siegenthaler, sein Nachfolger im Bernerhof, kämpfte in der Defensive weiter, so weit erfolgreich, wie er findet: «Es haben auf Bundesebene noch keine Kahl-
- 123
- schlage stattgefunden.» Doch ist auch Siegenthaler auf Moll gestimmt. Er und Gygi, alte Freunde und Genossen, hatten beide an der Brust derselben Alma Mater die glei- chen Theorien Keynes' für den modernen Sozialstaat eingesaugt, die so wenig taugten, als sie sie beim Bund mit vereinten Kräften auch umsetzen wollten. Den Leh- ren, für die sie sich an der Uni Bern begeisterten, wurde im gleichen Moment im realen Leben der Boden ent- zogen. Der Bund war in Währungsfragen längst entmachtet, als die beiden um 1980 in die Finanzverwaltung einstie- gen. Ihr erster Chef, Direktor Rudolf Bieri (1969-85). hatte ganze Arbeit geleistet. Der Freisinnige fädelte 1970 im Bernerhof eine Änderung des Münzgesetzes ein, die das Parlament aus der Währungspolitik ausschaltete. Die Macht in diesem Schlüsselbereich ging faktisch an die Nationalbank über. Die Räte selber nickten es ab. Sie sa- hen die Folgen freilich nicht voraus. Die Nationalbank konnte nun mit bundesrätlichem Segen den Franken nicht nur aufwerten (1971), sondern den Wechselkurs völ- lig freigeben (1973), ohne die Volksvertreter auch nur fra- gen zu müssen. Die Neuerung war deshalb von größter Tragweite (siehe Seite 128). Seit der Bieri-Revision hat das Parlament zur Wäh- rungspolitik - für Außenwert und Konjunkturverlauf je- der Volkswirtschaft und damit auch für die Staatsfinan- zen hochwichtig - nichts mehr zu sagen. Die Geldpolitik ist von National- und Ständerat völlig abgekoppelt. Frei- lich ist der folgenschwere Entscheid von der Öffentlich- keit so gut wie unbemerkt geblieben. Er wurde von den
- 124
- mächtigen Staatsdienern, die ihn ersannen und durch- zogen, auch nie besonders herausgestellt. Das ist durch- aus verständlich, denn er ist ein Paradebeispiel für die Macht der Technokratie und die Schwäche der Demo- kratie.
- WIE TECHNOKRATEN für die Schweiz die globalen Risiken managen möchten und was sie dabei erleben - jean-Pierre Roth, Thomas Zeltner, Michael Ambühl
- Selbst die höchsten Währungshüter durchschauen die globalen Finanzmärkte nicht ganz, doch geben sie sich alle Mühe. leden zweiten Monat ruft der Schweizer Jean- Pierre Roth die Kollegen sämtlicher Staaten zum mone- tären Weltgipfel nach Basel. Er berät mit ihnen die Risi- ken für die weltweite Finanzstabilität. Freilich gibt es nie Infos, null Fotos, keine Presse, no comment - nur die bloße Macht, Technokiatie Grand Cru. Die Spitzen aller Notenbanken treffen sich am Sitz der BIZ, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Hinter dicht verschlossenen Türen im gedrungen ge- bauten BIZ-Turm, in vier Minuten Gehdistanz vom Bahnhof Basel SBB, versucht Roth mit seinen zum Teil weltberühmten Kollegen die globalen Ungleichgewichte abzubauen. Der BIZ-Präsident, Sohn eines Unterwalliser Postschalterbeamten, baut auf die Kompetenz aller, doch hofft er auch auf Glück. «Das Wirtschaftsgesche- hen», gesteht Roth, «ist zu komplex, als dass wir je hof-
- 125
- fen können, es umfassend zu verstehen.» Notenbanken könnten, sagt er beispielhalber, kaum beurteilen, ob die Börse jeweils die reale Wirtschaft spiegle oder nicht. Sogar Basels vereinte Währungshüter sind mithin nicht imstande, die schwankenden Urteile des Börsenpubli- kums über den Wert von Firmen, Branchen und Staaten sinnvoll zu hinterfragen. Die Börse ist letzte Instanz. Die bestallten Steuermänner der Weltwirtschaft tappen bei Schlüsselfragen im Dunkeln. Eine Basler Szene aus dem Jahr 2007: Ben Bernanke (USA) und Jean-Claude Trichet (Europäische Zentral- bank) fragen Zhou Xiaochuan (China) nach geldpoliti- schen Einflussfaktoren seines Großreichs. Kollegen aus der ganzen Welt bestürmen den mächtigen Mandarin aus Peking mit einer Unmenge Zusatzfragen. Der Präsi- dent der Chinesischen Zentralbank, blitzgescheit, hört sich alles an, hellwach. Schließlich lächelt er mit ausge- suchter Höflichkeit und sagt in fließendem Englisch: «Sie haben mir viele interessante Fragen gestellt, auf die ich selber keine Antwort weiß.» Geld regiert die Welt, doch niemand regiert das Geld. Jean-Pierre Roth, Präsident der Schweizerischen Natio- nalbank und der BIZ in einem, ist nicht umsonst in an- dauernder Sorge. Er ist in eine globale Rechnung mit gefährlich vielen Unbekannten schicksalhaft einbezo- gen. «Nie kann ich abschalten», seufzt er, «dauernd bin ich auf dem Quivive.» Kummerfalten auf der Stirn, fährt er morgens um 6.30 Uhr im Bahnhof Bern ab, liest im Zug Le Monde und durchblättert Le Temps sowie Finan- cial Times, hastet am Zürcher Hauptsitz der National-
- 126
- bank an seinen Monitor und überfliegt das Neueste aus Tokio, Hongkong und Singapur. Sind Preise unerwartet stark gefallen oder gestiegen - sei es wegen einer Panik in Shanghai oder wegen eines Schocks beim Erdöl -, kommt auch Roth in Fahrt. Er trommelt Mitarbeiter zusammen, ruft Kollegen vom Direktorium an, tauscht Mails mit BIZ-Partnern in Ost und West. Droht dem Schweizer Franken eine Inflation, muss er handeln und - zum Beispiel - die Leitzinsen erhöhen. Tut er dies aber zu früh oder zu stark, würgt er womöglich die Konjunk- tur ab. Er ist nicht allwissend und darf sich doch nicht irren. Zu viel steht auf dem Spiel. Der verbindliche Frankenpfleger möchte nicht nach Willkür handeln, vielmehr für jedermann berechen- bar. So oder so indessen beeinflusst er Außenwert und Innenleben der Schweizer Wirtschaft stärker als alle Bundes-, National- und Ständeräte zusammen. Im Um- gang mit Gewählten respektiert er die Rituale. Jeden Dezember ist Roth in Bern an einer Bundesratssitzung dabei und teilt der Ministerrunde seine Lageanalyse mit. Weisungen nimmt er aber selbst von der Regie- rung, seiner Wahlbehörde, nicht entgegen. Seine Macht- fülle ist enorm. Gehorcht er freilich keinen Politikern, so folgt er doch den Vorgaben der Märkte - da hat er keine Wahl. Der nationalökonomische Gralshiiter mit Sitz an der Zürcher Börsenstraße behauptet sich in Rollenfächern, die für die Schweiz von Fritz Leutwiler (1924-97) er- schlossen worden sind, dem einzigen Nationalbankchef der Nachkriegszeit, der auch zum BIZ-Präsidenten auf-
- 127
- stieg. Fritz Leutwiler schöpfte den Spielraum aus, wel- cher der Nationalbank durch die ominöse Bieri-Revision zugewachsen war (siehe Seite 124). Am 23. Januar 1973 schrieb Leutwiler Geschichte. Bei der Nationalbank für Devisenoperationen zuständig, gab er dem Druck von Spekulanten nach, die den Fran- ken in die Höhe und den Dollar in die Tiefe trieben. Die Nationalbank stoppte, nach Rücksprache mit dem Bun- desrat, ihre Dollar-Stützungskäufe. Leutwiler stellte es den Märkten anheim, den Tauschwert der Landeswäh- rung zu bestimmen. Das änderte den Lauf der ganzen Weltmechanik. Die Schweiz war das erste Land der Erde, das den Wechselkurs freigab. Der zupackende Aargauer Freisinnige sprengte das System der festen Wechsel- kurse, das auf die internationale Konferenz von 1944 in Bretton Woods (USA) zurückging. Er versetzte der alten Währungsordnimg den Todesstoß: weniger Staat, global. Seinem Beispiel folgten die großen Staaten nach weni- gen Wochen. Die Finanzmärkte hatten fortan freie Bahn. Sie konnten den Globus nach ihrem Gusto neu vermes- sen und verteilen. Geld war jetzt grenzenlos mobil. Die Globalisierung kam in Schwung. In der Schweizer Wirtschaft kippte die Machtbalance. Der plötzlich erhöhte Frankenkurs stürzte die Industrie in Not. Sie produzierte jetzt fürs Ausland viel zu teuer. Sie musste auswandern. Dafür explodierten die Schweizer Banken. Sie scheffelten Devisen und wurden zu Riesen. Einige wurden übermütig. Die CS kam nach den Exzes- sen von Chiasso 1977 ins Trudeln. Fritz Leutwiler sprang ihr bei und trug ihr «spontan» und «für den Bedarfsfall»,
- 128
- wie er bekanntgab, Milliarden an, eine verkappte staat- liche Garantieerklärung. Der beherzte Notenbanker wurde zum Star der Fi- nanzwelt. Er winkte ab, bescheiden: «Ich bin ein Techno- krat - im guten Sinn des Wortes.» Mitten in die Feier zu seinem 60. Geburtstag, 1984, rief ihn Englands Premier- ministerin Margaret Thatcher an, gratulierte und dankte ihm für alles. Zu Recht, denn ohne Technokraten sei- nes Schlages wäre aus der neoliberalen Welle nichts ge- worden. Und die Schweiz wäre heute auch nicht Sitzland zweier der größten Finanzkonzerne der Welt. Im Inland beherrschen UBS und CS zwei Drittel des Marktes. Sie sind, so profitabel sie arbeiten, für den Kleinstaat ein Klumpenrisiko. Daniel Zuberbühler, Direktor der Eid- genössischen Bankenkommission (EBK), warnt: «Welt- weit einmalig ist die Konzentration an der Spitze mit zwei dominierenden und weltweit verflochtenen Mega- banken in Kombination mit einer relativ kleinen Volks- wirtschaft.» In Deutschland zum Beispiel komme die Deutsche Bank auf weniger als 10 Prozent Marktanteil. Das Horrorszenario: Geriete einer der beiden Schwei- zer Riesen in Schieflage, risse er leicht die ganze Volks- wirtschaft in den Abgrund. Das Klumpenrisiko ist im blinden Fleck des öffentlichen Bewusstseins, doch ist die Gefahr selbst durch das solideste Geschäftsgebaren nicht ganz zu bannen. Von Börsenkrisen ausgehende Schockwellen können rund um den Erdball laufen und ehrwürdigste Finanzhäuser erschüttern. Ein heißes Thema, doch Daniel Zuberbühler, SP-Mit-
- 129
- glied und Sohn eines Von-Roll-Werkdirektors, hat keine Angst vor großen Tieren. Er macht sich «nichts aus Lu- xus», fährt meist mit dem Velo ins Büro und fliegt nach Übersee immer in der Economyclass. Seit 1976 im EBK- Sekretariat tätig, hat der bärtige Pfeifenraucher den Boom der Branche aus nächster Nähe genau verfolgt, und er ist besorgt. Der Aufseher des Finanzplatzes Schweiz forderte auf Weltebene radikale Neuerungen. Sein Konzept: Die Glo- balisierung von Banken wie IJBS und CS muss auch die Globalisierung der Bankenaufsicht nach sich ziehen. Er tischte seine Idee in Basel an einer internationalen Kon- ferenz der Bankaufseher auf. Konkret schlug er für die fünfzig weltgrößten Bankkonzerne einen «supranatio- nalen Regulator» vor - zum Beispiel die BIZ. Erst eine solche Institution, sagte er, schaffe die nötige weltweite Übersicht und Überwachung globaler Firmen. Doch fand der Mann aus Bern bei den ausländischen Kollegen kein Gehör. Überall waren nationale Egoismen im Spiel, natürlich auch bei Zuberbühlers Vorschlag. Er musste einsehen: «Auch bei größtem persönlichen Einsatz und guten Argumenten lässt sich die fehlende Machtbasis nicht aufwiegen.» Sein Trost: «Es darf ja nicht erwartet werden, dass sich der internationale Mindeststandard am Maßstab des nationalen Systemrisikos eines Klein- staats ausrichtet.» So aber trägt das weltweit einzigartige Klumpenrisiko letzten Endes in vollem Umfang der Schweizer Steuerzahler. UBS-Präsident Marcel Ospel verneint das Problem nicht rundweg, möchte es aber auch nicht unnötig breit-
- 130
- schlagen. Generell verhalte er sich, sagt er, «eher risiko- avers». Die Bank erfülle die Eigenmittel-Standards be- kanntlich bestens. Und: «Es ist unsere Verantwortung, das Risiko so zu steuern, dass es unter allen Umständen verkraftbar ist.» Politiker meiden gern das heikle Thema. Als Parla- mentarier wurden einst Rudolf Strahm (SP) und Samuel Schmid (SVP) aktiv. In separaten Vorstößen wiesen sie auf die «Großrisiken der Großbanken» (Strahm) hin und forderten vom Bundesrat «vorbeugende Maßnahmen, um das Risiko einer faktischen Staatsgarantie für Groß- banken zu beschränken» (Schmid). Sie hatten wenig Erfolg. Das Klumpenrisiko belastet jetzt umso mehr die Staatsdiener, die für Finanzstabilität verantwortlich sind. EBK und Nationalbank versuchen die Gefahr auf allen Wegen zu begrenzen. Sie schufen für die Überwachung der Großbanken spezielle Dienstzweige. Hinter den Ku- lissen herrscht Betriebsamkeit. Offen bleibt, ob im Fall der Fälle außer der Schweiz auch andere Schwerpunkt- länder von UBS und CS mit Barem beispringen müssten. Laut Zuberbühler ist nichts vorgesehen. Andere Kenner behaupten jedoch sehr wohl hinter vorgehaltener Hand Absprachen zwischen Währungsbehörden von Schweiz, USA und Großbritannien. Ein Entscheidungsträger ver- rät: «Klar existieren Abmachungen, aber das ist hochge- heim.» So oder anders ist Finanzstabilität überall Chef- sache. Philipp Flildebrand, Nationalbank-Vizepräsident, kämpfte während Monaten mit Hochdruck für einen Schweizer Sitz im internationalen Forum für Finanzsta-
- 131
- bilität. Er drang durch. Die Schweiz darf, vertreten durch Jean-Pierre Roth, seit März 2007 regelmäßig an den Sit- zungen des hochkarätigen Forums teilnehmen. Notdürftig überbrücken Technokraten Probleme, die sich ohne Politik schwerlich lösen lassen. Die Globalisie- rung schuf eine «Weltrisikogesellschaft» (Ulrich Beck) und ringt mit den Folgen. Gefordert wäre globales Ri- sikomanagement auch im Interesse der Schweiz, dies nicht nur in der Geldbranche, auch anderswo, Beispiel Klima, Gesundheit, Arbeit. Der Problemdruck variiert. Was sich Zuberbühler für die Bankenaufsicht gewünscht hätte, steht Gesundheitsdirektor Thomas Zeltner für die Seuchenbekämpfung längst zur Verfügung: eine Welt- behörde, die globale Risiken global bekämpft und damit auch der Schweiz dient. Seinem Einsatz gegen Pandemien - Vogelgrippe, Lun- genseuche - opponiert nicht einmal die Blocher-Partei. Die Notwendigkeit dieses Kampfes sei «unbestritten», betonte im Nationalrat 2007 sogar der Zürcher SVPler Toni Bortoluzzi, der sonst keine Gelegenheit versäumt, Zeltners Kopf zu fordern. Kein Wunder: Globale Viren im- migrieren, vom interkontinentalen Flugverkehr beflü- gelt, womöglich massenweise ins Schweizerland und verschonen selbst Freunde des nationalen Alleingangs nicht. Der Gesundheitsdirektor und seine Kollegen im Ausland nehmen, für einmal mit SVP-Duldung, ein Stück Weltregierung vorweg - jenes globale Risikomanage- ment, das in andern Bereichen noch fehlt. Zeltner ist, so gesehen, das Muster eines Amtsdirek- tors neuen Typs. Er arbeitet unentwegt grenzüberschrei-
- 132
- tend, dies nicht nur bei Pandemien. Der parteilose Nichtraucher ist dadurch häufig angegriffen worden und lebt im Bundeshaus gefährlich. Doch bewährt er sich als Krisen- und Risikomanager auch in eigener Sache. Er überlebt alle und alles. In der Pubertät besiegte er eine schwere Gelbsucht (Hepatitis Non-A). An der Spitze des Bundesamts für Gesundheit überstand er Intrigen und Bazillen, Kampagnen und Affären, National- und Ständeräte sowie seine bundesrätlichen Vorgesetzten Pascal Couchepin (FDP), Ruth Dreifuss (SP) und Flavio Cotti (CVP). Die schärfsten Gegner kamen dem fixen Medikus nicht bei, weil sie seiner parteiübergreifenden Elastizität und Wendigkeit nicht gewachsen waren. So wurde er zum amtsältesten aller Direktoren des Bundes. Gesellig ist er und lebensfroh wie sein Vater, der in Bern eine private Handelsschule führte. Der Vater muss- te die Schule verkaufen, als er an bösartigem Bluthoch- druck erkrankte. Seinetwegen studierte Sohn Thomas Medizin; lieber wäre er Architekt oder Bauingenieur ge- worden, er wollte aber dem Vater beistehen können. Das Schicksal wollte es nochmals anders. Der 22-jährige Me- dizinstudent konnte den Vater, als er eine Hirnblutung hatte, nicht retten. Später war ihm eine Arztpraxis rasch langweilig. So warf er sich auf die öffentliche Gesund- heit. Seit Amtsantritt 1991 behauptet sich der schnelle Ber- ner auf internationalen Schlachtfeldern. Die Weltpresse spricht vom Mann, der die neue Drogenpolitik auf- gleiste: ärztliche Verschreibung von Heroin, Viersäulen- modell (Prävention, Therapie, Schadensminderung,
- 133
- Repression). So konnte er die Zahl der Süchtigen bei 30000 stabilisieren. Sein Problemhorizont blieb grenz- überschreitend. Sein Feldzug gegen das Rauchen machte ihn zum Lieblingsfeind der globalen Tabaklobby. Ziga- rettenmultis in den USA und England jubilierten, als das Schweizer Volk 1993 die «Zwillingsinitiativen» für ein Werbeverbot für Alkohol und Tabak verwarf. Sie freu- ten sich zu früh. Zeltner ging über die WHO zum Gegen- angriff über; er heckte mit Generaldirektorin Gro Harlem Brundtland (1998-2003) ein griffiges Rahmenüberein- kommen gegen Tabakkonsum aus. Erst dadurch gewann Zeltner auch den zögernden Bundesrat für eine bessere Nikotinprävention: mehr Geld, mehr Personal, schär- fere Gesetze, höhere Tabaksteuer. Seitdem vermehrt und vergrößert er überall die rauchfreien Zonen - ganz im Einklang mit seiner WHO-Rahmenkonvention. Sein Mit- streiter Felix Gutzwiller, Präventivmediziner und FDP- Politiker, treibt das Geschäft im Parlament voran; er möchte 2009 das landesweite Rauchverbot in öffent- lichen Räumen einführen. Alles in allem hat Thomas Zeltner die Tabaklobby in einem langen internationalen Krieg besiegt. Der Oberarzt der Nation spielt seine Rolle, doch er durchschaut das Spiel. Er kann vor Lachen fast purzeln und jäh eine Amtsmiene aufsetzen. Er ist immer zu allem fähig. Seine Stärke ist das Verhandeln - auch mit dem Ausland. Eines ist ihm restlos klar: Er darf, will er mit andern Staaten klarkommen, nicht nur nehmen, er muss auch geben. Das war der Punkt, der den Bankenaufse- her Daniel Zuberbühler scheitern ließ, als er seinen aus-
- 134
- ländischen Kollegen eine globale Bankenaufsicht vor- schlug: Die Schweiz hätte davon stärker als das Ausland profitiert. Zuberbühler aber hatte ihm dafür beim besten Willen nichts anzubieten. Die Schweiz wäre in diesem Fall besser gefahren, hätte sie dem Ausland dafür auf an- dern Gebieten entgegenkommen können. Nur war die Verknüpfung schon technisch schwierig: Die Banken- aufsicht operiert von der Regierung unabhängig, im In- und Ausland gleichermaßen. Da ist es gut, hat die Schweiz ihren Michael Ambühl. Der smarte Diplomat ist im Geben und Nehmen un- schlagbar. Das bewies er als Chefunterhändler für die bi- lateralen Verträge mit der EU. Ambühl pickte in Brüssel für die Schweiz Rosinen, von denen EU-Mitglieder nur träumen können. Sein Dreh: Er hat mehrere Dossiers raf- finiert kombiniert. Seine Hartnäckigkeit verwunderte alle. Sogar seine - nicht minder hartnäckige - Chefin Michel ine Calmy-Rey war erstaunt: «Sie insistieren aber sehr, Monsieur Ambühl! Vous insistez beaucoup!» Er konnte ihr nur recht geben: «Ich gelte als eine harte Nuss.» Prompt stieg der schlaue Taktiker 2005 zum Staatssekretär des Departements für auswärtige Angele- genheiten auf. Kaum saß er im Sattel, erklärte er sich bereit, die Amts- direktoren der übrigen Departemente im höheren Lan- desinteresse zu koordinieren. Die Schweiz, meinte er, müsse nach außen mit einer Stimme sprechen. Mit «Sololäufen einzelner Dienststellen» sei nun Schluss. Ambühls «koordinierte Außenpolitik» weckte in der Bun- desverwaltung gemischte Gefühle. Freudig reagierte je-
- 135
- doch Thomas Zeltner. Er war der allererste Amtsdirektor, der eine «Zielvereinbarung» mit Ambühl unterschrieb und eine veritable «Gesundheitsaußenpolitik» ausrief. Ambühl tritt als expansiver Chefkoordinator aller Außenbeziehungen der Schweiz in die Fußstapfen sei- nes Großcousins Hans Schaffner, des letzten Bundes - beamten überhaupt, der auch noch zum Bundesrat aufstieg. Schaffner brachte die Schweizer Handelsdiplo- maten in führende Stellung. Seine «Küken», wie er die besten Mitarbeiter nannte, wurden zu Vorläufern und Wegbereitern der Globalisierung. Als Generaldirektor des Gatt (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen) liberalisierte der Schweizer Olivier Long (1968-80) in Genf den Warenverkehr weltweit. Sein Nachfolger, der Schweizer Arthur Dunkel (1980-93), lancierte die Uru- guay-Runde, die zur Gründung der Welthandelsorgani- sation (WTC) führte. Der Wermutstropfen: Die Schwei- zer Globalisierer mussten nach vollbrachter Tat von der Weltbühne abtreten. Die liberalen Pioniere schafften sich selber ab. Einen quälenden Abstieg in Raten erlebte in Bern das ruhmbedeckte Bundesamt für Außenwirtschaft (Bawi). Staatssekretär Paul R. Jolles (1966-84) war der letzte Bawi-Direktor, der an Bundesratssitzungen mitreden durfte. Franz Blankart (1986-98) war der letzte, der bei Verhandlungen mit Brüssel für die Schweiz federführend war; er holte den EWR heraus. Nach dem Volksnein zum EWR 1992 mussten die Wirtschaftsdiplomaten die euro- papolitische Schlüsselrolle ans EDA abtreten. Blankart hatte intern Gegenwind. Sein aristokrati-
- 136
- scher Habitus war einzelnen Bundesräten unerträglich. Der manirierte Humanist erfasste jedoch die wahren globalen Gefahren mit scharfem Blick. Sorge bereiteten ihm wirtschaftliche Deregulierer, die das WTO-Regel- werk unterliefen und über China arbeiteten. Er bestand auf Einhaltung der Regeln und warnte deshalb vor Chi- nas verfrühter WTO-Aufnahme: «Es ist wichtig, dass Be- werber den Vertragscharakter der WTO-Mitgliedschaft voll und ganz verstehen. Ein überhasteter und unsorgfäl- tiger Aufnahmeprozess könnte die Dauerhaftigkeit des multilateralen Handelssystems gefährden.» Er sollte recht behalten. Sein Mitarbeiter Pierre-Louis Girard, Bawi-Botschafter, der für die WTO die Gespräche über Chinas Beitritt führte, bewies Engelsgeduld. Doch 2001, nach 16 Jahren und 40 Sitzungen, erlag die Arbeits- gruppe Girard dem Druck westlicher Konzerne und Re- gierungen, denen an Pekings Beitritt dringend gelegen war. Chinas verfrühte WTO-Aufnahme wurde Tatsache, und die von Blankart befürchteten Folgen sind eingetre- ten. Die Deregulierer expandieren. Setzten sie früher auf die USA, so bevorzugen sie jetzt China. Ihr Ziel: freier Welthandel ohne Regeln. Im Gegenzug schlagen überall Etatisten zurück. So schaukeln sich Gegner und Freunde schrankenlosen Wettbewerbs hoch. Liberale Regeln ge- raten dabei außer Kurs. Das multilaterale Handelssystem ist in der Krise. Die liberalen Technokraten, die die Welt einst ohne Politik regeln zu können hofften, sind am Ende ihres Lateins. Fürwahr ein schwieriges Erbe, das Jean-Daniel Ger- ber, seit 2004 Chef des Staatssekretariats für Wirtschaft
- 137
- (Seco), antrat. Der Täufersohn und Wirtschaftsdiplomat klassischen Zuschnitts hätte am liebsten liberale Regeln weiterhin auf Weltebene gefördert. So aber muss er mit den andern Ländern einzeln Freihandelsverträge schlie- ßen. Das gelingt Gerber mit kleineren und mittleren Wirtschaftsnationen auch. Einer «mission impossible» hingegen gleichen seine bilateralen Gespräche mit Großmächten in Übersee. So misslang dem erfahrenen Könner schon der erste Anlauf für einen Freihandelsvertrag mit den USA. Die Supermacht stellte der Schweiz für den Agrarhandel zu hohe Forderungen, im Gegenzug drohte der mächtige Bauernverband in Brugg mit seinem Veto, und der Deal platzte. Unverdrossen nahm Staatssekretär Gerber 2006 einen neuen Faden mit einer andern Großmacht auf. Der Berner flog nach China und rang den roten Man- darinen die Zusage ab, Freihandelsgespräche mit der Schweiz ins Auge zu fassen. Ein riskantes Unterfangen, weil China gleich auf mehreren Gebieten völlig ande- ren Prioritäten folgt, Stichworte Arbeits-, Umwelt-, Tier- und Genschutz-Anliegen, für die in der Schweiz im Falle eines Freihandelsvertrags zum Teil kämpf- und referendumsfähige Nichtregierungsorganisationen be- reitstehen. fean-Daniel Gerber droht ein neuer Zweifron- tenkrieg. Er muss mit wachsendem Widerstand gegen schrankenlosen Freihandel rechnen. Der ethisch sen- sible Spitzendiplomat kennt das Risiko und gibt dem Versuch mit China dennoch eine Chance. Sein stärks- tes Argument: «Ein Viertel der Menschheit ist ein Kapitel für sich.» Da hat er allerdings recht.
- 138
- WIE SCHWEIZER MANDARINE mit der Großmacht China umspringen und welche Gewerkschafter die Finger von ihr l a s s e n - Serge Gaillard, Uli Sigg
- In China war er nie. Serge Gaillard hat für Trips nach Asien keine Zeit. Erst mit 45 Jahren flog er in die USA - die erste Überseereise seines Lebens. Als Chefökonom des Gewerkschaftsbunds widmete er sich zu «98 Prozent der Schweiz, 2 Prozent Europa» - und dem Rest der Welt null. Als Direktor für Arbeit im Staatssekretariat für Wirt- schaft (Seco) in Bern löste Gaillard im Februar 2007 sei- nen Vorgänger Jean-Luc Nordmann in sämtlichen Funk- tionen ab, nur nicht als Stellvertreter von Staatssekretär und Seco-Direktor Jean-Daniel Gerber. Dafür fehlte Gail- lard die nötige Auslanderfahrung. Das Ziel, für das sich der eloquente Ökonom seit je abrackert, ist Vollbeschäf- tigung in der Schweiz, fertig. Alles andere ist weniger wichtig. Ihm ist völlig klar, wie sehr die Reduktion der Arbeits- losigkeit im Inland abhängig ist vom Ausland, gerade von Asien, und er steht noch heute links der Mitte, doch ist er nun einmal, linken Leitbildern entgegen, kein In- ternationalist. Mit sich selber ringend, meint Serge Gail- lard zögernd: «Ich bin vielleicht national orientiert.» Andere Ökonomen sind deutlich weltoffener. Franz Jaeger, Arena-tauglicher Alt-Nationalrat aus St. Gallen, drängt die Schweiz, sich für den Wettbewerb mit Asien «noch mehr zu öffnen». Allerdings hat auch Jaeger einen weiten Weg hinter sich. Einst, 1972, empörte ihn der rück- sichtslose Kapitalismus ä la chinoise noch, den er auf
- 139
- einer Asienreise mit zehn andern Schweizer Parlamen- tariern im damals britisch regierten Hongkong erlebte. «Hongkong», erklärte der junge Nationalrat des Lan- desrings der Unabhängigen, «steht als abschreckendes Beispiel für die Macht von Geld und Profitdenken. Es präsentiert sich mit allen Widerwärtigkeiten einer über- bordenden Konsumgesellschaft.» Jaeger atmete auf, als er die Grenze zu Rotchina passierte und mit den Schwei- zer Kollegen in zwanzig Tagen bis nach Peking reiste. Der real existierende Maoismus erlöste ihn von allem Übel: «Wo wir hingekommen sind, haben wir nur zufriedene Menschen angetroffen. Keine Slums, keine Bettler, keine Hungernden, keine Obdachlosen, keine Kriminellen. Wenn man sich die vorrevolutionären Zustände vor Augen hält, so ist man beinahe versucht, von einem Welt- wunder zu sprechen.» Inzwischen hat jener Kapitalis- mus, der Jaeger einst in Hongkong so empörte, weite Teile Chinas erobert und den Rest der Welt verändert - inklusive Jaeger. Heute drängt der gleiche St. Galler den Schweizern ebendiesen Kapitalismus auf. Zum Beispiel müssten sich «die jungen Leute mit Blick auf die Konkurrenz aus China oder Indien bewusst sein, dass sie nicht immer den Job ausüben können, den sie gerne hätten, sondern denjenigen, den sie am besten ausüben». Jaeger selber war und blieb flexibel - ob als Gewählter oder Gelehrter, links- oder rechtsliberal, ob mit Mao, Blocher oder Brüs- sel. So behielt der schlagfertige Debattierer immer sei- nen Lieblingsjob: militanter Trendsetter auf Lebens- zeit, der Zeitgeist in Person. Seit mehr als 35 Jahren zählt
- 140
- Jaeger zur Prominenz - Schweizer Rekord. Seine neuste Version von Internationalismus, die neoliberale Globali- sierung, trug ihm in besten Kreisen neue Freunde ein, etwa Marcel Ospel (UBS). Der betuchte Schnitzelbänkler rühmte den professoralen Springinsfeld bei dessen Ab- schiedsvorlesung 2007 an der Uni St. Gallen humorvoll in gereimten Versen. Wie Jaeger erging es manchen Schweizer China- Freunden. Sie begannen bei Mao und endeten bei den Managern. Sie blieben im Gleichschritt mit China selbst. Die wenigsten allerdings mit den ganz realen Wirkun- gen, welche die ehemaligen Schweizer Botschafter Uli Sigg (1995-98) und Erwin Schurtenberger (1988-95) ent- falteten, zwei Sechziger, die seit über dreißig Jahren als Diplomaten und Geschäftsleute die Öffnung Chinas tat- kräftig unterstützen. Beide gehören zu den Wegbereitern der weltwirtschaftlichen Umwälzung, die vom Reich der Mitte ausging und den Job-Export von West nach Ost auslöste. Beide stehen über alle ideologischen Gräben und Umbrüche hinweg im Bann der ältesten Weltkul- tur, die ein Gegenmodell zum Westen darstellt und in ihren Tiefen allem Wandel der Geschichte trotzt. Beide Schweizer sind halbe Chinesen geworden - Kapitalis- mus hin, Sozialismus her. «Ich habe mich an diesem Land gerieben, an ihm gelitten, gelernt und erfreut», sagt der in sich gekehrte Glatzkopf Uli Sigg. Er und Schurtenberger pendeln beide, doch jeder ganz für sich, sechs- bis zwölfmal jährlich nach China und laden ihre Geschäftsfreunde aus Fernost gern in ihre schmucken Schlupfwinkel in der Zentral- und der
- 141
- Südschweiz ein. Uli Sigg, Schlossherr im luzernischen Mauensee, bereitet offiziell als Generalkommissär den Schweizer Auftritt an der Expo 2010 in Shanghai vor, be- rät das Architekturbüro Herzog & de Meuron beim Bau des Olympiastadions Peking und sitzt mit Henry Kis- singer im Beirat der China Development Bank, welche Großprojekte wie Dreischluchtendamm und Autobah- nen finanziert. Erwin Schurtenberger, Verwaltungsrat bei Chinas Erdölriesen CNOOC, Schweizer Maschinen- bauer Bühler und Deutschlands Technologiekonzern Bosch, empfängt seine Gäste in Minusio, wo er seit Jahr- zehnten eine Wohnung hat, mit sonniger Terrasse und schönster Aussicht auf den Lago Maggiore. Schurtenber- ger steht mit Familien der Machtelite Chinas in so enger Beziehung, dass er ihre erwachsenen Kinder häufig bei sich empfängt, darunter Töchter und Söhne von Deng Xiaoping, dem Reformer, der die Volksrepublik 1976 bis 1997 faktisch führte. Erwin Schurtenberger wurde früh von der Liebe zu China erfasst. Der Luzerner Arbeitersohn, Jahrgang 1940, hatte oft Hunger und kein Geld; eines Morgens, zwölf- jährig, wachte er auf und sagte: «Ich will nach China.» Dort gab es eine andere Welt, bessere Menschen und zu essen für alle. Er fuhr mit Autostopp nach Marseille, schreckte im Hafen aber vor der Abreise zurück. Er fühlte sich, als er die großen Schiffe und das weite Meer sah, ganz klein. Still kehrte er nach Hause zurück und begann zunächst einmal, Chinesisch zu lernen, um den großen Mao zu verstehen. Er war tieftraurig, als 1953 Stalin starb. Nach dem Studium der Politologie in Paris wurde er zum
- 142
- Diplomaten und stieg ab 1975 in der Schweizer Mission in Peking - unterbrochen von Einsätzen in andern Staa- ten Asiens - Sprosse um Sprosse vom dritten Sekretär zum Botschafter auf. Er gab für den Job sein Herzblut. 1989, während des Tien-An-Men-Massakers, dem schätzungsweise 1400 Menschen zum Opfer fielen, fuhr er unerschrocken durch die brennenden Straßen Pekings, holte gefährdete Eidgenossen aus ihren Wohnungen und brachte sie in sein sicheres Botschaftsgebäude. Um ein Dutzend im Hotel amTien-An-Men-Platz eingeschlossene Schweizer Touristen zu retten, befestigte Schurtenberger in fliegen- der Eile zwei große Schweizer Fahnen vorn und hinten an seinem Diplomatenauto und fuhr unbehelligt von den schießwütigen Soldaten zum Hotel inmitten des Hexenkessels. Er war sich sicher: Nie wird ein Soldat Chi- nas in dieser Lage auf eine Schweizer Fahne schießen. Die Schweiz genießt in Rotchina besonderes Ver- trauen, weil sie eines der ersten Länder war, welche die 1949 gegründete Volksrepublik anerkannten, und weil beim neutralen Kleinstaat die Herren Pekings vor macht- politischen Flintergedanken sicher sind. DengXiaoping, «dieser ungewöhnlich kleine und wurzelkräftige Mann, der zu jedermann emporschauen muss» (wie Max Frisch nach einem Treffen 1975 notierte), schätzte Kontakte mit Eidgenossen. Deng suchte im Machtvakuum nach Maos «Kulturrevolution» nach neuen Wegen und empfing da- bei auch die Bundesräte Pierre Graber und Fritz Honeg- ger. Erwin Schurtenberger sah ihn alles in allem fünf- mal, bekam jedoch immer mehr Probleme mit Bern. 1994
- 143
- wollte ihn Flavio Cotti als seinen Generalsekretär nach Bern holen. Schurtenberger aber, der fließend Mandarin spricht, wäre, wenn er China schon verlassen musste, lieber in einem seiner Nachbarländer eingesetzt worden, etwa in Kasachstan. Er stieß in Bern auf taube Ohren, hörte nach 26 Jahren Diplomatie auf und blieb auf eigene Rechnung im China-Geschäft. Jetzt hatte Cotti ein Problem, wusste aber Rat. Bei ei- nem Empfang am Rande des Filmfestivals von Locarno 1994 nahm er plötzlich den Unternehmer Uli Sigg bei- seite und fragte ihn, ob er als Quereinsteiger Botschafter in China werden möchte. Sigg überlegte nicht lange. Der Sohn des Direktors der Aufzugsfabrik Schindler hatte 1980 in Peking das erste Gemeinschaftsunternehmen zwischen China und dem Westen gegründet. Er legte den Keim für den ganzen Boom. Er schuf bewusst ein Modell für China und westliche Investoren zugleich. Sein revolutionäres Konzept wurde von Deng-Mitstrei- ter Jiang Zemin genehmigt, dem späteren Präsidenten Chinas (1993-2003). Sigg und Jiang pflanzten die Markt- in die Planwirtschaft ein. Kritiker hüben und drüben fanden den Zwitter widernatürlich, ja lachhaft, doch heute zählt China 500000 solcher Unternehmen. Das Land ist die Fabrik der Welt. China, ein Land ohne freie Gewerkschaften, zog In- vestoren an, die den Sozial- und Umweltnormen des Westens ausweichen wollten. Über China unterliefen Konzerne die Regeln demokratischer Staaten. So konn- ten sie die Arbeitnehmer aller Erdteile gegeneinander ausspielen. Sie machten aus China im Industriebereich,
- 144
- was London für sie im Finanzsektor gewesen war: die Offshore-Plattform für eine staatenlose Weltwirtschaft. Chinas Aufstieg erhöhte den Wettbewerbsdruck auf die alten Industrieländer. Uli Sigg sagt es so: «Der Westen hat sich mit China einen starken Konkurrenten aufgebaut.» Deng kannte die Erwartungen der Konzerne und sorgte im Land für Ruhe und Ordnung. 1989 rechtfertigte er den Truppeneinsatz gegen die mehr Freiheit fordern- den Demonstranten auf dem Tien-An-Men-Platz damit, bei Streiks und Kundgebungen «könnte das ausländische Kapital China rasch verlassen»; mehr Härte gegen Kriti- ker werde «ausländische Investoren nicht vertreiben, sondern, im Gegenteil, nur beruhigen»; ihnen müsse China «zeigen, dass wir dadurch, dass wir die Schraube etwas anziehen, die politische Stabilität bewahren». Die westlichen Konzerne, denen Deng damit die letzte Verantwortung für das Massaker zuwies, widersprachen ihm nicht, sondern schwiegen feige. Im Nationalrat in Bern ging Konzernchef Christoph Blocher wenigstens ans Rednerpult. Er wand sich und riet der Schweiz, sich nicht aufzuregen: «Proteste von uns bewirken bei den Chinesen sehr oft das Gegenteil.» Und: «Das Erstaun- lichste im Westen scheint mir die Überraschung über die vorgefallenen Ereignisse.» Sowieso: «China ist China. China zu verstehen, ist für uns praktisch nicht möglich.» So viel verstehen Schweizer Investoren inzwischen von China aber schon, dass sie dort viel Zukunft haben. Die Pharmakonzerne sind vor Ort vielfach führend. Daniel Vasella, langjähriger Präsident des internationalen Bei- rats des Bürgermeisters von Shanghai, baut dort eines
- 145
- der weltweit wichtigsten Novartis-Forschungszentren auf. Stolz hob er in Shanghai hervor: «Wir sind die Ers- ten, die ein Entwicklungszentrum auf diesem Niveau in China gründen.» Einst drohte der Novartis-Chef den in Sachen Genforschung kritischen Schweizern nicht mit Asien, sondern mit Amerika: «Die Forschung wird so- wieso stattfinden, nur anderswo, nicht in Schwellenlän- dern, sondern in Ländern wie Kanada oder USA, streng geführt, mit klaren Regelungen für die Forschung.» Nun forscht er doch im größten aller Schwellenländer, das in der Gentechnik wenig Skrupel kennt. Er gerät frist- gerecht zum Erfüllungsgehilfen der Kommunistischen Partei Chinas, die in ihrem elften Fünf jahresplan den Aufbau einer forschenden Industrie in der Biomedizin bis 2010 vorgesehen hat. Westliche Konzerne als Komplizen eines Einpar- teienstaats, Motto: wirtschaftliche Freiheit, politischer Zwang. Reüssiert diese scheinbar widernatürliche Alli- anz im Osten, werden die Folgen für die Demokratie im Westen nicht ausbleiben. Längst entfaltet der Lohndruck aus China globale Wirkung. Die politischen Folgen die- ses Ringens stehen noch aus. Demokratie und Einpar- teienstaat treten in Systemkonkurrenz zueinander. Die Topmanager haben sich entschieden. Ihre Strate- gie hat eine klare Richtung: Marktmacht total und glo- bal, so oder anders. Die Konzerne wissen, was sie wollen. Nicht so die Schweizer Politik. Für die Linke gibt SP-Prä- sident Hans-Jürg Fehr einen klaren Rückstand zu: «Dem sozialdemokratischen Internationalismus kommt kaum mehr oder nur noch punktuell eine Pionierrolle zu.
- 146
- Gemessen am real praktizierten Internationalismus der Konzerne hinkt er wohl eher hinterher.» Hübsch gesagt. Die Linke rührt in Sachen China keinen Finger. Sie baut keinen Druck auf. Sie unternimmt nicht alles in ihrer Macht Stehende, um die Koalitionsfreiheit für Arbeit- nehmer in China zu fordern. Gerade dieser Punkt aber läge im ureigenen, dringenden Interesse der Arbeitneh- mer im Westen, auch in der Schweiz. Anders ist Chinas Sozialdumping nicht zu stoppen. Das Desinteresse der Schweizer Gewerkschaften ist deshalb bemerkenswert. Bei ihnen ist das Internationale nicht Chefsache. SGB-Präsident Paul Rechsteiner, zwi- schen Boden- und Genfersee hochaktiv, erspart sich so gut wie alle internationalen Kongresse und Kontakte. Sie lohnen für ihn die Mühe nicht. So war er auch ver- hindert, als einmal eine Spitzenvertreterin des offiziel- len, KP-gelenkten chinesischen Gewerkschaftsbunds in Bern zu Besuch weilte. Die regimetreue Chinesin wurde immerhin empfangen von Christian Levrat, SGB-Vize- präsident, Freiburger SP-Nationalrat und Präsident der Gewerkschaft Kommunikation. Er empfahl ihr, sich in ihrem Land für Koalitionsfreiheit und Menschenrechte einzusetzen. Daraufhin war das Treffen «rasch beendet» (Levrat). Pingpong-Diplomatie mit Nullergebnis - mehr schaffen Schweizer Gewerkschafter einfach nicht. Lip- penbekenntnisse im Hinterzimmer sind das höchste ihrer globalen Gefühle. Sie hinken nicht nur den Konzernen hinterher, son- dern auch den ausländischen Gewerkschaftskollegen. 2006 schlossen sich die Dachverbände von 168 Millio-
- 147
- nen Arbeitnehmern in 153 Ländern zum Internatio- nalen Gewerkschaftsbund (IGB) zusammen. Auch der SGB ist offiziell IGB-Mitglied, wobei allerdings Präsi- dent Paul Rechsteiner an der Teilnahme am Gründungs- kongress in Wien leider gerade verhindert war. Ab- wesend war auch China. Das Reich der Mitte wurde auf der Weltkarte der freien Gewerkschaften zum großen Loch. Der allererste politische Akt des IGB überhaupt war ein böser Brief an die Schweizer Regierung. IGB-Gene- ralsekretär Guy Ryder warnte Bundespräsident Moritz Leuenberger schriftlich: «Die Position der Schweiz könnte für die Diktaturen eine Bresche schlagen.» Kon- kret forderte er von Bern, Gewerkschaftsvertreter besser gegen missbräuchliche Kündigung zu schützen. Da die Schweiz die Uno-Normen in dieser Frage nicht erfüllt, wurde sie auch von der Internationalen Arbeitsorganisa- tion (IAO) in Genf aufgefordert, Abhilfe zu schaffen. Auf diesem langen Umweg ist nun das Internationale doch zum Thema für Serge Gaillard, Chef der Direktion für Ar- beit im Seco, geworden. Der ehemalige Gewerkschafts- vertreter muss darauf achten, dass die Schweiz in der organisierten Arbeitswelt nicht ganz ins Abseits gerät. Allerdings kann Serge Gaillard auch in seiner neuen Funktion nicht aus seiner nationalen Haut. In seinen Augen vermag die Schweiz, im Gegensatz zu Großmäch- ten wie die USA und die EU, wenig auszurichten, wenn es um das Durchsetzen von Arbeitsschutznormen in Ländern wie China geht. Zwar weicht der hochbegabte Staatsdiener einstweilen diplomatisch aus: «Das ist im
- 148
- Moment ja alles noch offen.» Doch wird Gaillard im Fall eines Freihandelsvertrags mit China wohl kaum auf bin- denden Arbeitsschutznormen bestehen können. Viel fehlt deshalb nicht, und die Schweiz wird zumindest für den Internationalen Gewerkschaftsbund neben dem riesigen Loch China auf der Weltkarte zum zweiten Loch - oder zu einem Löchlein.
- VI Wie die globalen Krisenmanager improvisieren
- WAS DAS ROTE KREUZ mit den Wirtschaftskapitänen zu schaffen h a t - u n d wieso Jakob Kellenberger und Klaus Schwab das Gleiche sagen und das Gegenteil voneinander meinen
- Ein strahlend blauer Himmel wölbt sich über dem Genfer Seebecken. Klaus Schwab steigt am postmodern- pompösen Sitz des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Cologny in die rassige Audi-Limousine. Sein Fahrer kennt den Bestimmungsort bereits: Genfer Stadtzent- rum, Rue du Marché, Nachrichtenagentur ßloomberg News. Dort ist der «Professeur», wie sich der WEF- Gründer vom Chauffeur anreden lässt, mit dem durch- reisenden New Yorker Bürgermeister und Geschäfts- mann Michael Bloomberg verabredet. Auf schneller Fahrt spricht Schwab im Fond vom Kampf ums Weiße Haus. Er sagt voraus, Bloomberg werde, sobald Hillary scheitere, der Mann der Stunde sein. Am Genfersee wird Weltpolitik zum Welttheater. Echte und falsche Brückenbauer geben sich die Klinke in die Hand, vor und hinter den Kulissen. Die Personen und ihre Darsteller kommen und gehen, Regisseure und Souffleure wechseln, die Probleme bleiben. Kaum hat man sich vom schwäbelnden Zeremonienmeister der Globalisierung inmitten des geschäftigen Treibens der Rue du Marché vorläufig verabschiedet, findet man
- 151
- auf dem Hügel hinter dem Völkerbundpalast den außer- rhodischen Nothelfer der Globalisierungsopfer. Jakob Kellenberger, seit 2000 Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), ist gerade aus Su- dans Krisenprovinz Darfur zurück und wirkt düster. Was er gesehen habe, sei «ein typischer Konflikt der heu- tigen Zeit», analysiert er im historischen Rotkreuz- Gebäude an der Avenue de la Paixdie gegenwärtige Welt- lage: «Es wird relativ wenig geschossen und ungeheuer gelitten.» Kellenberger - zerknittertes Gesicht, doch voll Vitali- tät - leidet mit jeder Faser mit. Er kämpft mit den übels- ten Folgen der globalen Risikogesellschaft: Aufstände ohne Ende, Bürgerkriege ohne Sieg, Konflikte ohne Ziel. Das IKRK steht Millionen von Durstenden, Verwundeten und Erkrankten bei. Das Hilfswerk besucht im Jahr eine halbe Million Männer und Frauen in 2500 Gefängnissen. Kellenbergers Arbeit wächst und wächst: immer mehr Opfer, immer mehr Helfer. Er führt einen humanitären Weltkonzern. Jedes Jahr gibt er eine Milliarde Franken aus. Er vermehrte das Personal Tempo Teufel von 8500 auf 13 000 Mitarbeitende. Das sprunghafte Wachstum seit der Jahrtausend- wende ist fürs IKRK selbst nicht ungefährlich. Die größte Geldgeberin, die Regierung der USA, liebt keinen Tadel. Und doch kommt der Sohn eines Fotogeschäftinhabers in Heiden nicht darum herum, die von ihrem Freiheits- pathos berauschte Supermacht öfter bei den Ohren zu nehmen und an Regeln zu mahnen. Der topfnüchterne IKRK-Präsident vertritt selber eine - moralische - Groß-
- 152
- macht; er muss weltweit die Rechte von Kriegsopfern und -gefangenen einfordern, gegen alle und jeden, selbst gegen den US-Präsidenten. Das tut er auch, meis- tens freilich streng vertraulich. So forderte er von den USA für die Insassen des Gefangenenlagers Guantä- namo einen klaren Rechtsstatus und korrekte Haftbe- dingungen. An sich hätte er Guantánamo gern selbst be- sucht. Er kam vom Plan ab, weil er den unvermeidlichen Publizitätsrummel scheute und sich mehr davon ver- sprach, bei Präsident George W. Bush persönlich vorzu- sprechen. Im diskreten Kräftemessen im Weißen Haus stieß des Appenzellers Methode an ihre Grenzen. Er er- zielte Verbesserungen, doch blieb die Kernfrage strittig: Für welche sogenannten Terrorverdächtigen sind die Genfer Konventionen über Kriegsgefangene anwendbar? Mit Bush-Leuten musste er dann darüber diskutieren, wann genau die Behandlung von Häftlingen als «un- menschlich», wann als «entwürdigend» zu gelten habe. Wortklaubereien an der Schmerzgrenze. Scharfsinnig beschrieb Jakob Kellenberger einst in seiner Doktor- arbeit das Welttheater des spanischen Dichters Calderón (1600-1681), besonders dessen komische Figuren, welche die großen Worte großer Leute, das Pathos, als unecht entlarvten. Die Sprache ist Kellenbergers alte Liebe. An der Uni Zürich entflammte er für Spaniens «goldenes Zeitalter», die französische und spanische Literatur so- wie für seine Zukünftige, die Mitstudentin und Pfar- rerstochter Elisabeth. Seitdem kultiviert er sein Sprach- gefühl. Bereist der IKRK-Chef die Stätten des Elends dieser Welt - ob Afghanistan, Ruanda, Uganda oder
- 153
- Kolumbien -, dann hat er stets ein Heft dabei, in das er ein paar seiner Lieblingsgedichte geschrieben hat, etwa das Gedicht «das wort» von Stefan George (1868-1933), das endet mit «So lernt ich traurig den verzieht: Kein ding sei wo das wort gebricht». Sprache bedeutet für Kellenberger alles. Sie ist seine Gegenwelt zur Barbarei. Er ist der erste IKRK-Chef seit langem, der das persön- liche Gespräch mit den Präsidenten der Weltmächte ge- radezu sucht. Er traf sich nicht nur mit George W. Bush im Weißen Haus, sondern auch mit Chinas Hu Jintao in der Großen Halle des Volkes, mit Russlands Wladimir Putin im Kreml. Der letzte IKRK-Präsident, der genau- so verfuhr, war Gustave Ador, jener gusseiserne Kollege, der heute im Berner Bundeshaus die Genfer Außen- ministerin Micheline Calmy-Rey täglich stumm begrüßt, egal, ob sie nun seiner achtet oder nicht. Gustave Ador reiste 1919, nach dem Ersten Weltkrieg, als Bundespräsi- dent und IKRK-Chef nach Paris und sprach dort an der Friedenskonferenz mit US-Präsident Woodrow Wilson. Der Genfer, großbürgerlich-altliberal, war begeistert von Wilsons Idee, den Völkerbund zu gründen. Der Funke sprang zwischen ihnen über. Der calvinistische US-Prä- sident erhob die Calvinstadt zum Sitz des neuen Völker- bunds. So entstand die diplomatische Weltstadt, die heute Jakob Kellenberger so malerisch zu Füßen liegt, sooft er aus dem Fenster blickt. Der Völkerbundpalast breitet sich gleich unterhalb seines Büros raumgreifend aus, eine würdige Nachbarschaft, die den IKRK-Präsiden- ten jeden Tag an gemeinsame geschichtliche Wurzeln
- 154
- gemahnt. Die Pioniere beider Institutionen waren be- seelt von verwandten Idealen und Utopien. Beide kämpf- ten gegen die Greuel des Krieges und sehnten sich nach Frieden, Demokratie und Menschenwürde. Krieg und Terror sind bis heute nicht von der Bildfläche ver- schwunden. Jakob Kellenberger bleibt trotzdem erfüllt vom «unnachgiebigen Willen, zivilisatorische Minima auch unter ungünstigsten Bedingungen zu verteidigen». Diesem - bei ihm höchst konkreten - Ziel ordnet er alles, aber auch alles unter, selbst seine Kritik an Tätern. Er hütet sich vor kontraproduktiven Schuldzuweisun- gen. Wer mit ihm Ursachen des Elends der Welt bespre- chen will, kommt nicht allzu weit. Andeutungen müssen bei ihm genügen. Würde der Wahlgenfer zum Beispiel einmal über das Seebecken hinweg Richtung Cologny blicken, sähe er unfehlbar Klaus Schwabs eleganten WEF-Sitz. Doch blickt Kellenberger - er versichert es auf eine entsprechende Frage - nie in jene Richtung. «Nein», sagt er verwundert und fragt zurück: «Warum sollte ich?» Nun, da drüben würde er womöglich Miturheber jener Nöte finden, die ihn und sein Personal in aller Welt jahr- ein, jahraus in Atem halten. Jakob Kellenberger hätte sogar Argumente genug, Klienten Schwabs nach dem Verursacherprinzip an den Kosten des IKRK zu beteiligen. Er gelangte in der Tat schon an einige von ihnen. Er bat Schweizer Konzerne um Sponsorgelder, freilich mit ganz anderer Begrün- dung. Er wollte die Unabhängigkeit des IKRK von den Regierungen - nicht nur der amerikanischen - sicher- stellen und deshalb die Geldquellen diversifizieren. Der
- 155
- Anteil der Wirtschaft an den IKRK-Einnahmen sollte von 0,5 auf 3 Prozent steigen. Der gewünschte Erfolg blieb jedoch aus. Zusagen gab es von Franz Humer (Roche) und Peter Forstmoser (Swiss Re), doch winkten Novartis und beide in Geld schwimmenden Großbanken ab. Kel- lenberger war über die vielen Absagen enttäuscht und trug sie doch mit Fassung. Seine Unabhängigkeit - auch von Konzernen - ist ihm zu wichtig. Kellenberger möchte überhaupt die Globalisierung nicht auf die Anklagebank setzen. Sie dürfe sich, sagt er, nur nicht aufs Wirtschaftliche beschränken, sondern müsse auch politische, soziale und ökologische Aspekte einbeziehen: «Ich bin Gegner der Ökonomisierung.» Das ist allerdings ein weites Feld. Klaus Schwab sagt Ähnliches, nur mit umgekehrter Blickrichtung. Der Nationalökonom und ETH-Ingenieur sieht alles vom Wirtschaftlichen her, doch tut er seit Jahr- zehnten nichts anderes, als die Topmanager unablässig einzuladen, Politik, Gesellschaft und Umwelt zu berück- sichtigen. Sein Kerngeschäft ist es gerade, Manager nicht nur miteinander, sondern auch mit Politikern ins Ge- spräch zu bringen. Er zählte in Europas Chefetagen zu den frühen Warnern vor ungezügelter Globalisierung. 1973 proklamierte er in der Davos-Charta: «Die Aufgabe des Berufsmanagements ist es, dem Verbraucher, dem Investor, dem Beschäftigten und auch den Gemein- schaften zu dienen, in deren Umgebung ein Manage- ment arbeitet.» Der WEF-Gründer ist aus anderem Holz geschnitzt als die meisten Wirtschaftskapitäne, für die er dauernd auf
- 156
- Achse ist. An seinen Kongressen der globalen Machtelite, egal ob in Davos, den USA oder China, bewegt er sich zwischen den Konzernchefs mit der Würde eines selten gewordenen Stelzvogels. Der selbsternannte Geschäfts- führer des Weltgeists steht in engem Kontakt zur nackten Macht, doch über seinem Wesen liegt ein Abglanz alt- europäischer Geistigkeit. Klaus Schwab ist in der hiesigen Industriewelt groß geworden. Sein Vater war Chef der 2000 Mitarbeiter der Escher-Wyss-Niederlassung im süddeutschen Ravens- burg. In Frankfurt promovierte Klaus Schwab über die Exportchancen der deutschen Maschinenindustrie und arbeitete beim deutschen Dachverband der Branche. Er besuchte 1967 die Harvard University (USA), um die neusten amerikanischen Managementlehren - «stake- holder theory», «Unternehmensführung mit sozialer Verantwortung» - zu studieren und sie seinen Industrie- kollegen in der Schweiz heimzubringen. Er wurde Vor- standsmitglied der Sulzer Escher-Wyss AG in Zürich und Dozent für Management in Genf. 1971 zog er in Davos ein «European Management Sym- posium» auf - die Geburtsstunde des heutigen WEF. Seine Verwandten und Studenten schleppten mit ihm Kisten und stapelten Papier. Schwabs erstes Symposium wurde zum Erfolg, wobei 40 Prozent der 444 Teilnehmer aus Deutschland kamen, speziell aus der mittelstän- disch geprägten Maschinenindustrie. Die nächsten zwei Treffen waren Flops. Sie verzehrten sein finanzielles Pols- ter. Er beschloss, sein Forum auf die tausend weltgrößten Konzerne auszurichten.
- 157
- Sein Strategiewechsel fiel mit dem Umbruch der Welt- wirtschaft zusammen. Die verunsicherten Topmanager benötigten neue geistige Leitplanken. Schwab konnte sie ihnen bereitstellen. Seinen alten treuen Kunden tat sein Schrittwechsel in die Welt der Konzerne weh. Über Jahre hinweg musste er, um für die Großen Platz zu schaf- fen, jeweils zwanzig bis vierzig kleine und mittlere Fir- men kündigen. Blessuren persönlicher Art blieben nicht aus. Schwab plagte gegenüber dem deutschen Mittel- stand ein schlechtes Gewissen. Seine Rechnung ging jedoch auf. Schwab machte aus dem Symposium eine gemeinnützige Stiftung und benannte sie 1987 in World Economic Forum um. Das WEF geriet zur Erfolgsstory ohnegleichen. Um die nötige Resonanz zu erzielen, schrieb er dem WEF sogar noch mehr Einfluss zu, als es ohnehin hatte. Er tat, als seien die meisten Großereig- nisse der Weltgeschichte bei ihm in Davos angebahnt worden - bereits 1979 die Öffnung Chinas, 1982 die Uru- guay-Welthandelsrunde, 1987 Russlands Wende, 1989 Deutschlands Vereinigung, 1990 Osteuropas Einbezug in die Weltwirtschaft, 1992 Südafrikas Wandel und so fort. Die überzogene Selbstdarstellung war ihm nicht überall dienlich. Der Mythos vom globalen Einfluss des WEF schlug auf das Forum zurück. Globalisierungsgegner nahmen ihn beim Wort. Davos geriet zum Schlachtfeld. Schwab musste sich jetzt gegen die «Verteufelung und I iäinonisierung des WEF» zur Wehr setzen. Sein Nimbus wurde von Bill Clinton noch vergrößert, dem ersten US Präsidenten, der am WEF teilnahm. Auf einer seiner Fahrten nach Davos kam Clinton freilich
- auch auf die Idee, ein Konkurrenzunternehmen auf- zuziehen. Stets habe er, sagte Clinton, bedauert, dass man in Davos zur Tür hinausgehe, und es passiere rein gar nichts. Seit 2005 veranstaltet er in New York seine eigenen Spitzentreffen für Manager und Staatschefs. Seine Stiftung, die Clinton Global Initiative, ist bereits weltgrößter privater Fundraising-Kanal. Bis 2007 erhielt er 570 Zusagen aus hundert Ländern - Milliardenbeträge für den Kampf gegen Klimaerwärmung, Seuchen und Armut. Bill Clinton knüpft, wie seine Frau Hillary, an frühere Präsidenten der Demokratischen Partei an, allen voran lohn F. Kennedy, Franklin D. Roosevelt und Woodrow Wilson. Er übernahm ihr Pathos für eine bes- sere Welt. Clinton und Schwab, New York und Davos - sie stehen in unterschiedlichen Traditionen. Am internationalen Kongress der Gelehrten 1929 in Davos, von Bundesrat Giuseppe Motta eröffnet, forderte Philosoph Martin Heidegger, die Menschen «radikal der Angst auszulie- fern». 1933 stimmte Heidegger, sozusagen folgerichtig, der Machtergreifung Hitlers zu. Umgekehrt zählte US- Präsident Franklin D. Roosevelt die Freiheit von Furcht (Freedom of FearJ zu den wichtigsten Zielen seiner Poli- tik. Er siegte im Weltkrieg gegen die nationalsozialisti- schen Angstmacher. Die von den Siegermächten in New York gegründete Uno forderte 1945 die Freiheit von Angst als ein allgemeines Menschenrecht. Durch den islamisti- schen Terrorangriff vom 11. September 2001 gegen New York kehrte für Amerika die Angst als beherrschender Faktor auf die Weltbühne zurück, und der republikani-
- 159
- sehe Präsident George W. Bush zog Traditionen seiner demokratischen Vorgänger in Zweifel, einschließlich der Berücksichtigung des humanitären Genf. Häufiger als Jakob Kellenberger ist beim Präsidenten in Washington denn auch jener andere Wahlgenfer, Klaus Schwab, zu Gast. Schwab war mit Gemahlin und andern Gästen bei Bush und der First Lady auch schon zum Dinner im Wei- ßen Haus geladen. Mit Schwab braucht der US-Präsi- dent keine Kontroversen über zivilisatorische Minima auszufechten, mit dem WEF-Gründer kann George W. Bush globale Themen großräumiger einkreisen. Im Genfer Seebecken liegen die Hauptquartiere von WEF und IKRK einander auf Sichtweite gegenüber und beschränken ihren Kontakt aufs Nötige. Ohne die Präsi- denten der USA wären beide nicht so bedeutend gewor- den, wie sie heute sind - freilich auch nicht die latenten Differenzen zwischen ihnen. Nun hat sich der frühere Uno-Generalsekretär Kofi Annan in Genf als dritter Mann zwischen den globalen Krisenmanagern etabliert. Er baut an der Avenue de la Paix ein neues humanitä- res Forum auf - nach seinen Worten «eine humanitäre Version des World Economic Forum». Der altbewährte Brückenbauer zwischen Tätern und Opfern der Globali- sierung will in der humanitären Katastrophenhilfe «alle Schlüsselfiguren an den Runden Tisch bringen». Da wird er in Genf noch viel zu tun haben.
- iftn
- WIESO SELBST DIE MANAGER vor der Globalisierung Angst haben müssen und doch dem Machtstreben nicht entsagen können - Walter Kielholz, Peter Brabeck
- Über den Wolken mag die Freiheit grenzenlos sein, am Zürcher Paradeplatz ist alles anders. Hier schimpft Wal- ter Kielholz, freisinniger Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse: «Ich bekomme einen Lachkrampf, wenn mir ein Journalist sagt, ich sei ja der Chef und könne also auch über meine Zeit verfügen.» Seine Agenda sei mit Terminen auf ein Jahr hinaus so gut wie zugepflastert. Dagegen kann der gestresste Herrscher beim besten Wil- len nichts machen. Plöflich zieht er sich ins wuchtige CS- Hauptgebäude zurück. Später gibt's in der Agenda doch noch ein Loch. Aufge- kratzt und aufgedreht wettert Walter Kielholz diesmal über die in Bern oben, diese politischen Halbblinden. Die «Nabelschau» gewisser Magistraten sei ja «kindisch». Kielholz würzt seine Tiraden mit lustigen Einschüben, ruft bald «Habakuk» oder «Chabis», bald «Kakao» oder «Gaggalari». Feurig verteidigt er die Manager gegen das «mediale Geschrei». Dabei ist ihm selber klar: «Wir geben schon wunderbare Buhmänner ab.» Manche seiner Urteile sind dann wieder überraschend bedachtsam. Die Gewerkschaften, sagt er, seien außer- halb des öffentlichen Diensts zwar bedeutungslos ge- worden, aber dies sei «keine Entwicklung, über die ich hurra brülle». Konkurrent Marcel Ospel rede vielleicht dem reinen Shareholder-Value das Wort, achte aber in der
- 161
- Realität nicht nur auf Interessen von Aktionären, son- dern, richtigerweise, auch auf die anderer Anspruchs- gruppen. Mag Kielholz im Einzelnen recht haben oder nicht, er hat nicht nur Temperament, sondern auch Urteilskraft. Er steht mit beiden Beinen auf der Erde. Sein Vater, FDP- Mitglied, erst Präsident des Schneidermeister-Verbands, dann Textilfabrikant im solothurnischen Baisthal, hatte ums wirtschaftliche Überleben zu kämpfen. Nach seiner Pensionierung musste die Fabrik unter Druck von Ban- ken, auch der CS, schließen. Sohn Walter, studierter Be- triebswirt, machte damals Karriere als Rückversicherer. Dass er am Ende Banker im Hauptberuf sein würde, ahnte er nicht. Die CS berief ihn nach ihren Turbulenzen 2002 an die Spitze. Er wurde ihr Garant für neue Stabi- lität und politischen Rückhalt. Heute ist Kielholz nicht nur bei der CS wichtig, sondern auch bei Economie- suisse, Avenir Suisse und Swiss Re. Er ist der bestvernetzte Topmanager des Landes über- haupt. An Rive-Reine-Tagungen fehlt er selten. Bei den Bilderbergern sitzt Kielholz direkt neben Kissinger, dies allerdings nicht seiner globalen Wichtigkeit wegen - die ist in diesem Kreis normal -, sondern weil sich die Bil- derberger Sitzordnung nach dem Alphabet richtet: K sitzt neben K. Walter Kielholz schwärmt: «Da kommt Kissin- ger mit NZZ, FAZ, Le Monde und El Pais unterm Arm da- her - und hat sie alle in Originalsprache gelesen.» Sozialer Auf- und Abstieg gehören beide zu Kielholz' familiärer Erfahrungswelt. Heute steht der vife Fünfzi- ger offen zu seinen ganz persönlichen Ängsten, für einen
- 162
- Banker seiner Stufe ungewöhnlich. Die Globalisierung mache auch ihm Angst, sagt er: «Wir leben in Zeiten er- höhter Unsicherheit.» Die Manager spürten generell mehr Tempo, Druck und Risiko: «Angst ist im Manage- ment weiter verbreitet als angenommen.» Häufig spricht er darüber mit Marcel Ospel (UBS) oder James Schiro (Zürich) beim Essen. «Wir stehen unter gleichem Druck.» Kielholz ist überzeugt: «Nur Manager, die dazu stehen, dass ihnen die Risiken oft Sorgen machen, können damit fertig werden.» Denn «nur ein sehr bewusster Umgang mit den Ängsten» könne «Erleichterung schaffen». In diesen Dingen ist der CS-Chef quasi Mann vom Fach. Sein Großcousin Paul Kielholz (1919-90) war weltbe- rühmter Psychiatrieprofessor sowie Depressions- und Angstforscher in Basel. Durch ihn ist Walter Kielholz mit dem Thema altvertraut. Macht die Globalisierung selbst ihren Urhebern Angst, dann umso mehr vielen Passanten, die über den Zürcher Paradeplatz strömen und von Kielholz manchmal von seinem Büro im zweiten Stock der CS herab flüchtig be- obachtet werden. Laut dem Sorgenbarometer, mit dem die CS die Ängste der Bevölkerung seit 1976 regelmäßig misst und wie eine Fieberkurve des kollektiven Bewusst- seins nachzeichnet, sorgen sich die Menschen um Ar- beitslosigkeit, Umwelt, Gesundheit und Altersvorsorge. Fast die Hälfte der Bevölkerung findet, Politik und Wirt- schaft würden «in entscheidenden Fragen» oft versagen. Die CS-Umfragen belegen stets aufs Neue: Der Souverän lebt in Angst - schon wörtlich genommen eine Para- doxie.
- 163
- Einst wollte die Demokratie - die Selbstregierung des Volkes - mit der Angst ein für alle Mal Schluss machen. 1848 überwanden die revolutionären Gründer der mo- dernen Schweizer Demokratie, die Freisinnigen, die läh- menden Ängste und die Ohnmacht der Menschen im Obrigkeitsstaat. Die Väter des neuen Bundesstaats setz- ten Hoffnungen der Aufklärer des 18. Jahrhunderts um. Zum Glück der Menschheit sollten alle Furcht und aller Schrecken abgeschafft werden - eine Illusion, wie sich längst gezeigt hat. Durch die Trennung von «Souverän» und Macht aber hat die kollektive Angst neuen Auftrieb erhalten. Heute scheinen viele Ängste unausweichlicher denn je-Terror, Klima, Kriege, Hunger. Die Dämonie der Angst bleibt des Volkes treue Begleiterin. Die Hoffnung freilich stirbt zuletzt. Selbst Fritz Leut- wiler, langjähriger Präsident der Nationalbank und Aar- gauer Freisinniger von altem Schrot und Korn, ein Weg- bereiter der Globalisierung, der mit der Freigabe der Wechselkurse 1973 eine Büchse der Pandora öffnete, war in seiner Seele gespalten. Leidenschaftlich forderte Leutwiler «die lebendige öffentliche Diskussion» und betonte, die Anpassung der Politik an «eine sich wan- delnde Welt gelingt umso besser, je rascher wirtschaft- liche Veränderungen erkannt und neue Ideen verstan- den werden, und zwar nicht nur bei den Behörden und den Experten, sondern auch beim Bürger, dem in un- serem Lande die letzte Entscheidung zukommt». Leut- wiler: «Je offener die Ideen aufeinandertreffen, desto eher wird das Geschehen von Ideen gelenkt und nicht von versteckten Interessen.»
- 164
- Leutwiler war ein Technokrat staatsmännischen For- mats, überzeugter Demokrat und Rive-Reine-Teilneh- mer in einer Person. Seine Generation wurde in den Chef- etagen der Konzerne von den Babyboomern abgelöst, die ganz andere Akzente setzen. Die «Best-Agers», vom Schicksal begünstigt, in der Nachkriegszeit geboren, im wirtschaftlichen Aufschwung aufgewachsen, selbstbe- zogen, unternehmungslustig und gewohnt, ihre Macht- gier mit Weltverbesserungsphrasen zu drapieren. Keine Generation der Geschichte hat so viel verdient wie die Babyboomer, keine so viele Schulden angehäuft, keine so wenig Kinder gezeugt und keine eine derart große Treibhausgasbelastung für die kommenden Generatio- nen geschaffen. Nun meinte Nestle-Konzernchef Peter Brabeck am WEF 2007 in Davos, mit Statistiken könne man alles belegen, auch die nahe Klimakatastrophe. Er machte außerdem geltend, dass der Bericht des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums in den siebziger Jah- ren den Niedergang Europas eingeläutet habe. Der Top- manager aus Vevey schenkt der globalen Erwärmung wenig Beachtung. Er lässt sich in diesem speziellen Fall auch von Zahlen nicht irritieren. Er möchte stattdessen expandieren und setzt große Hoffnungen auf die Neurei- chen der Schwellenländer, vor allem in Asien. Konkret rechnet er bis 2015 global mit der Verdoppelung kaufkräf- tiger Mittelschichten. Die Rechnung dürfte für ihn und seine Managergeneration gerade noch aufgehen, sofern und solange es ihr gelingt, die immer bedrohlicheren Ri- siken für den Planeten aufzusehen hin zu überspielen.
- 165
- Auf der Terrasse des Nestlé-Schulungs- und Kon- ferenzzentrums Rive-Reine mahnt eine kleine Plastik von P. Nicolas mit dem Titel Nid von 2002, die das be- rühmte Vogelnest darstellt, an ganz andere Traditionen des Unternehmens. Das Markenzeichen geht auf das Nest im Familienwappen von Firmengründer Henri Nestle zurück - ein Symbol elterlicher Fürsorge, heute ein historisches Relikt. Hugo Thiemann, Mitbegründer des Club of Rome und Vater der Rive-Reine-Tagungen bei Nestlé, muss sich auf seine alten Tage doch sehr wun- dern. Er hütet sich vor Kritik an der heutigen Konzern- spitze, macht aber ansonsten aus seinem Herzen keine Mördergrube: «Die Welt wird offensichtlich weniger durch logisches Denken geführt als durch menschliche Ambitionen und Streben nach Macht.» Hugo Thiemann schlägt ein letztes Mal Alarm: «Es ist zwar spät, aber viel- leicht noch nicht zu spät, das Ruder herumzureißen. Noch sind die Erinnerungen wach an eine Zeit, da die Firmenchefs Unternehmerpersönlichkeiten waren und nicht raffgierige Topmanager, die zuerst für sich selbst schauen. Noch verfügen wir über eine alte Garde an Fachkräften, die ihre traditionelle Berufsethik der Nach- folgegeneration übergeben kann.» Der Gründer der Rive-Reine-Tagungen ruft zum drin- genden Kurswechsel auf. Seine Sorgen teilen kritische Köpfe in allen politischen Parteien, auf ganz besondere Weise aber Ruth Genner, Zürcher Nationalrätin und Che- fin der Grünen Schweiz, die als einzige Parteipräsiden- tin konsequent nicht an die Rive-Reine-Tagungen bei Nestlé eingeladen wird. Ruth Genner bildet zum Geist
- 166
- der Geheimkonferenz in der Tat das exakte Gegen- stück. Ohne von dieser Tagung auch nur gehört zu ha- ben, kritisiert die gebürtige Schaffhauserin die unge- brochene Macht diskreter Männerbünde in Politik und Wirtschaft. Die Tochter eines ungelernten Arbeiters musste sich von klein auf gegen «das Patriarchalische» behaupten. Ihr Vater traktierte sie, wenn sie nicht spurte, mit Stöcken. Er wollte sie nicht ins Gymnasium gehen lassen. Sie wehrte sich gegen ihn durch gute Schulleis- tungen. Die Lebensmittelingenieurin ETH heiratete ih- ren Schaffhauser Mitstudenten Thomas Genner, Poch- Mitglied, angehender Anglist und Gymnasiallehrer. Die Mutter zweier Töchter stürzte in eine persönliche Krise, als ihr Mann - Opfer einer HIV-Infektion - aus dem Leben schied. Die Selbstzerstörung der Männerwelt in allen ihren Formen hält Ruth Genner bis heute in Atem. Sie ist nicht allein. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger richten ihre Hoffnungen gleichsam instinktiv auf Akteure, die, ob rechts oder links, ob bürgerlich oder rot- griin, gerade nicht zur geheimen Machtelite zählen. Ge- fragt sind Verantwortungsträger, welche die Macht nicht um ihrer selbst willen erstreben. Denen die Dominanz der Konzerne kein unabwendbares Schicksal bedeutet. Denen die Ängste der Menschen kein Herrschaftsinstru- ment sind. Die die Globalisierung lenken und nicht nur erdulden wollen. Die in der offenen Gesellschaft eine Chance für alle sehen. Die die elterliche Fürsorge als um- fassende Verantwortung für kommende Generationen begreifen. Und die alles daran setzen, eine neue Balance zwischen Demokratie und Wirtschaft zu finden.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement