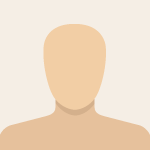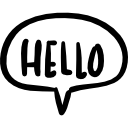Advertisement
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- Analyse und Erörterung zu „Erdbeeren oder Gnocchetti? Wie Computerspiele Geschichten erzählen“
- 15.09.2019 | Hausaufgabe
- Videospiele sind ein gesellschaftlich kontrovers diskutiertes Thema. Während sich in einem Großteil der Bevölkerung die Gruppierung derjenigen, die Videospiele als ein reines Unterhaltungsmedium ansehen und konsumieren, als Mehrheitsstimme etabliert hat, gibt es gleichzeitig auch, vorallem in der jüngsten Generation und bei den in der Produktion von Videospielen beteiligten Personen, die Ansicht, Spiele könnte man über den Status als Mittel zur Unterhaltung hinausheben. Ein künstlerischer Wertekodex wird vermittelt, wenn Spieler sich mit einem Titel beschäftigen und bilden sich über die Grenzen der Spielerfahrung hinaus weiter. Wieder andere Teile unserer Gesellschaft würden Videospiele allgemein verteufeln und als negativ bewertete ‚Zeitfresser‘ generalisieren, die, im schlechtesten Fall, dessen Konsumenten gar dümmer machen, als sie es vor dem Konsum eines Videospiels gewesen sind. Mit der Akzeptanz von Videospielen zwar nur indirekt, aber mit den Möglichkeiten und Chancen, Spiele als ein Werkzeug und Mittel zum Erzählen facettenreicher Geschichten zu nutzen, beschäftigte sich Christian Schiffer in seinem 2014 veröffentlichten Aufsatz „Erdbeeren oder Gnocchetti? Wie Computerspiele Geschichten erzählen“, welcher wie ein Sachtext strukturiert ist und nicht klar für eine Seite propagiert, sondern anhand analytischer Aspekte zu bestimmen versucht, wo die großen erzählperspektivischen Stärken der Videospielbranche verborgen sind.
- Einleitend formuliert Schiffer zunächst einen Vergleich zu Thomas Manns Parabel „Der Tod in Venedig“, um festzustellen, dass, während Bücher immer zum selben Ausgang führen, egal, wie intensiv man sich mit deren Inhalt auseinandersetzt, Computerspiele durch deren Interaktivitätsmöglichkeiten es dem Spieler selbst überlassen, frei agierend über den Ausgang einer Spielsituation zu bestimmen. Im Fall des „Tod in Venedig“ stirbt der Protagonist Gustav von Aschenbach, weil er überreife Erdbeeren gegessen und sich somit einen Erreger der Krankheit Cholera auf direktem Wege zugeführt hat. Auch Beispiele aus der Ilias-Sage, „Die Leiden des jungen Werther“ von Goethe oder „Anna Karenina“ aus Leo Tolstois gleichnamigen Roman werden aufgeführt, ob nämlich ein hölzernes Pferd mit feindseligen Soldaten in die Stadt Troja eingefahren wird, sodass dort eben jene Krieger ein Massaker anrichten und die Stadt in Schutt und Asche zurücklassen oder Werther bzw. Karenina Selbstmord begehen, das Ende der Geschichten ist einem vielleicht nicht unbedingt vor dem Durchlesen bewusst, man hat aber keine Möglichkeit gehabt, während man gerade am Lesen ist, den Verlauf in einer Weise zu beeinflussen (vgl. Z. 1-17). Als Schiffer nun den Vergleich zu den Videospielen zieht, nutzt er, obgleich man sich noch in der Einleitung des Sachtext befindet, bereits eine abgewandelte Form eines Autoritätsarguments, indem er nämlich die Behauptung aufstellt, Spiele würden eben diese Möglichkeit, den Spieler in einen Handlungsverlauf eingreifen zu lassen, ermöglichen, diese jedoch nicht sich selbst verantwortet, sondern über Michael Bhatty legitimiert. Dieser unterrichtet Gamedesign als Studienfach an der Macromedia Fachhochschule in München (vgl. Z. 18+19) und wird deswegen in erster Linie von skeptischen Lesern wohl kaum in Frage gestellt; nicht nur aus der Hinsicht heraus, dass es sich bei ihm durch seine Profession als Spieledesigner um einen Experten auf dem Fachgebiet handelt, sondern auch, da eigentlich jedes Mal, wenn ein Aufsatz von der Meinung eines „Professor“ oder „Doktor“ spricht, dessen Leser Respekt zollt. Wer schließlich keinen solchen Titel aufzuweisen hat, sieht in einer Professur automatisch die höhergestellte Autorität. Schon an dieser Stelle sind zwei Aspekte der Argumentation Schiffers anzumerken. Erstens wird der Autor nämlich in seinem Aufsatz stets das Wort „Computerspiele“ als ein Synonym für „Videospiele“ gleichsetzen, obgleich er sich ebenfalls auf Videospiele für Konsolen bezieht, die auf einem Computer nicht, oder zumindest nicht auf legalem Wege, käuflich zu erwerben sind. Manche Videospiele können allein aus Gründen der Peripherie, die für den Spielfluss verwendet werden muss, gar nicht auf einem Computer funktionieren, wenn es nämlich z.B. um die Steuerung durch Bewegungen geht, die bei Spielen der Konsole „Wii“ des Herstellers Nintendo eingesetzt werden. Ebenfalls bildet zweitens die Überschrift des Aufsatzes viel eher die eine im Text behandelte These und im Text genannte Behauptungen, die argumentativ belegt werden, gehen eher auf die eine Feststellung, dass Computerspiele eben Geschichten erzählen und festgestellt werden muss, wie dieses Erzählen einer Geschichte erfolgt, ein, wodurch eine lineare Erzählstruktur entsteht. Es wird sich nun also auf die vorangestellte Aussage Michael Bhattys bezogen hinsichtlich der Interaktivität; dass es sich bei digitalen Spielen um ein interaktives Medium handelt, wird anhand den Spielen L.A. Noire und der Reihe Super Mario, welche als IP von Nintendo bereits weltweiten Ruhm erlangen konnte, belegt. Obwohl es offensichtlich ist, dass man an einer solchen Schlucht nicht herunterfallen sollte, ist es dem Können und Willen eines Spielers selbst überlassen, ob diese Schlucht von der Hauptfigur Mario überwunden wird. L.A. Noire sieht es nicht vor, dass der Spieler einer Rede des ehemaligen US-Präsidenten Truman zuzuhören verpflichtet ist, aber vielleicht verpflichtet sich der Spieler selbst dazu, bleibt vor dem Radio, welches eine solche Rede abspielt, stehen und hört der Rede zu, um ein immersives Spielerlebnis zu haben. Das Bedürfnis, die Geschichte weitererzählt zu bekommen, wird durch ein von wieder anderen Spielern als obsolet und wichtig betrachtetes Feature in den Hintergrund gerückt (vgl. Z. 25-30). Entsprechend der Zielgruppe kann der Autor einer für ein Videospiel verwerteten Geschichte so einen Rahmen bilden, innerhalb dessen der Spieler sich frei austoben kann. Wenn ein Spiel ausschließlich eine volljährige Zielgruppe anspricht, so Schiffer, kann eine „schmuddelige Erotikszene“ (Z. 35) enthalten sein und nie wird eine Geschichte zweimal auf genau die gleiche Art wiederverwertet, selbst wenn sich nur kleine Details ändern, liegt schließlich ein anderer „Rahmen“ vor. Das Erzählen ist interaktiv und non-linear (vgl. Z. 31-37). Ein neuer und zehnzeiliger Abschnitt wird daraufhin allein für die Nennung von Beispielen für ein solches non-lineares Erzählen investiert, welches man bereits in alten Schriften und Büchern finden kann. Vieles wäre Schiffer sicherlich vorzuwerfen, würde man eine Gegenargumentation anstreben, doch sicherlich lässt es sich nicht behaupten, dass er zu wenige Belege angibt oder sich kaum mit dem Thema auseinander gesetzt habe. Bereits 1941, so der Verfasser, habe „Der Garten der Pfade, die sich verzweigen“ Interaktivität benutzt, um verschiedene Handlungspfade vorzugeben, „Ravuela“ ist auf zwei verschiedene Arten durchlesbar, auf die konventionelle Art und Weise von Anfang bis Ende des Romans oder nach einem System, welches der Autor Julio Cortázar dem Leser vorgibt und empfehlt. Bestimmt sind viele ebenso mit den „Spielbüchern“ vertraut, in denen man ein Kapitel durchliest und dann im Buch zu einer bestimmten Stelle blättern muss, die am Ende des gerade gelesenen Abschnitts angegeben ist, sollte man sich für Option A oder Option B entscheiden, im Handlungsstrang fortzufahren (vgl. 39-49). Mit großer Sicherheit haben viele der Leser des Originalartikels bereits solche Romane konsumiert oder zumindest von ihnen gehört, hier arbeitet Schiffer also mit einem Bezug auf etwas, mit welchem die Allgemeinheit der Leser vertraut ist. Durch die Bildung einer nostalgischen Erinnerung in den Köpfen der Leser wird Vertrauen aufgebaut und die Leser sympathisieren vielleicht sogar mit dem Autor trotz eventuell differenzierenden Meinungsansätzen. Es folgt ein weiteres Autoritätsargument. Dieses Mal bezieht sich Christian Schiffer aus Sid Meier, eine wahre Legende, wenn es darum geht, aus wenig zur Verfügung stehenden Ressourcen und einer Hardwarelimitierung, die nicht gerade dafür sprechen sollte, ein komplexes Strategiespiel zu entwickeln, 1991 für den Commodore Amiga den ersten Ableger von „Civilization“ zu veröffentlichen, welches von ihm codiert, programmiert und designt wurde und dessen Geschichte er auch in eigener Hand verfasst hat; ein Einmannprojekt, wie es sie heutzutage mit einigen Ausnahmen wie den Indie-Spielen „Undertale“ von Toby Fox, „Cave Story“ von Daisuke Amaya oder dem von Videospielkritikern in hohen Tönen gelobten Bauernhofsimulators „Stardew Valley“ von TeamChucklefish, welches aus gerade mal zwei Personen besteht, entwickelt wurde, gibt, da der Spielemarkt sich eher an Blockbuster-Produktionen und Entwicklerstudios mit mehr als Hunderten oder Tausenden von Programmierern, Entwicklern, PR-Agenturen und Publishern gewöhnt hat. Leser, denen diese Koryphäe oder zumindest dessen Name bekannt ist, freuen sich, den Namen in diesem Aufsatz Schiffers lesen zu können; ein weiterer Sympathiepunkt wurde aufgebaut. Das Zitat Sid Meiers, dass ein Spiel viele interessante Entscheidungen in sich bergen würde, belegt der Autor an den Charaktereditoren, welche in vielen Spielen zum Einsatz kommen. Dort wird dem Spieler die Möglichkeit gegeben, das Aussehen oder manchmal sogar bestimmte Verhaltenseigenschaften anzupassen; die Entscheidung, wie genau die Figur im Spiel auftritt, bleibt also jedem Spieler selbst überlassen. Ein eigentlich ernstes und düsteres Spiel wirkt humoristisch auf die Schippe genommen, wenn der Protagonist wie ein Clown aussieht oder, anders betrachtet, kann ein Spiel, welches an sich lustig scheint, durch eine Figur gebrochen werden, die wie ein grauenvolles und brutales Monster aussieht. So kann der Spieler das Spiel an seine eigenen Vorstellungen, Bedürfnisse und an den Humor anpassen, der eben angestrebt wird; alles je nach Entscheidungswille. Andere Spiele, so Schiffer, würden durch vorgegebene Charakter eher „platt“ ausfallen, so die Super-Mario-Reihe oder das Spiel „Half-Life“, da die Hauptfiguren ein klar gesetztes Ziel verfolgen, in keine Dialoge eingehen, stattdessen stumm bleiben und deren Fähigkeiten nicht weiter hinterfragt werden über den Verlauf des Spiels hinweg (vgl. Z. 50-61). Stutzig macht mich einzig und allein die letzte Aussage des selbigen Abschnitts, „gebrochene Charaktere mit tragischer Fallhöhe [seien] in Computerspielen immer noch die Ausnahme“ (Z. 61+62). Auf diesen Satz möchte ich später in meinem erörternden Aspekt nochmal eingehen, da man hier eine Problematik des Aufsatzes festmachen kann, die ihn nicht mehr wirklich zeitgemäß erscheinen lässt. Computerspiele, so Schiffer, würden einen anderen Kodex an „Gesetzen“ aufweisen, die dem Spieler die Möglichkeit geben, herum zu experimentieren, anstatt linear eine perfekte Geschichte zu erleben, die einfach so hervorgerufen wird, weil sie so in z.B. einem Film gezeigt wird oder in einem Roman geschrieben steht. Während dem Spielerlebnis trifft man so eben mal auf eine Sackgasse und muss den Weg zurück ohne weitere Hilfen selbst finden oder macht schlicht und ergreifend Fehler. An diesen lernt man und treibt so die Erzählung nach vorne. Im Folgenden bezieht sich Schiffer erneut, wie so oft in seinem Aufsatz, auf Beispiele aus der Videospielwelt. „Papo & Yo“ des kolumbianischen Entwicklers Vander Caballero verarbeitet mithilfe eines Jungen, der von einem Monster begleitet wird, welches zwischen den Zuständen, den Jungen angreifen und, dem gegenübergestellt, helfen zu wollen, in häufigen Wechseln hin und her springt, die reale Gegebenheit, dass der Vater des Entwicklers durch dessen Alkoholkonsum sowohl hilfsbereit als auch aggressiv gegenüber dessen Sohn sein konnte, je nach Gemütszustand. Ein künstlerischer Sachbestand wird hier in einem simplen Rätsel-Jump N Run verarbeitet, ähnlich wie in den vom Autor als „Experimentalspiele“ bezeichneten Videospielen, die mit ernstzunehmenden historischen Ereignissen oder Krankheiten wie Autismus arbeiten und versuchen, emotionale Umstände in Form eines experimentellen Spiels zu verarbeiten (vgl. 69-80). Christian Schiffer ist der Meinung, dass an dieser Stelle eine Grenze gezogen werden müsse. Diese „Computerspiele“ seien eigentlich etwas höheres und müssten mit einem anderen Begriff konnotiert werden, sobald die gesellschaftliche Akzeptanz für derartige Experimente erreicht ist, in denen eine Genialität solchen Grades wertgeschätzt wird (vgl. Z. 80-84). Erforschte Systematiken und Methoden Steven Pinkers, eines Evolutionspsychologe und somit einer weitere Autorität, die Handlungen von Büchern auf das emotionale Verständnis eines Menschen zu beziehen, werden im Sachtext aufgegriffen und auf Computerspiele bezogen. Wie Bücher können auch Videospiele Themen wie Furcht und Leid behandeln und dadurch, dass man das Geschehene nicht einfach nur liest und sich vorstellt oder in einem Film mithilfe anderer Figuren aus der Sicht der dritten Person miterlebt, ist man in Videospielen selbst derjenige, der eine Figur steuert und dessen Emotionen miterlebt. Das Können, sich in andere hineinzuversetzen und allgemeingültig die Empathie im Menschen zu stärken, kann durch Spiele auf intensive Art und Weise gefördert werden (vgl. Z. 85-95). Um den Text mit einem witzig gemeinten kleinen Seitenhieb an die Einleitung seines Aufsatzes abzuschließen, beendet Schiffer die Argumentation mit der Anmerkung, dass uns Videospiele irgendwann in der Zukunft vielleicht auch eine Antwort darauf geben können, „warum Gustav von Aschenbach auf die dumme Idee kam, überreife Erdbeeren zu essen.“ (Z. 95-97).
- Schon im Analyseteil, welchen ich hiermit übrigens beendet habe, erwähnte ich, dass ich, sollte ich zur Erörterung und eigenen Argumentation kommen, noch einmal auf die Tatsache eingehe, dass eigentlich die Überschrift des Sachtexts die einzige These aufstellt und sich an dieser Behauptung die gesamte Argumentationskette entlanghangelt. Denn obwohl das auf den ersten Blick etwas zu sein scheint, worauf Schiffer besser hätte Acht nehmen sollen; etwas Unverzeiliches, was den größten Fehler darstellt, den man in einer Argumentation begehen könne, passt diese Art des Argumentierens in der Tat am besten zur Intention des Autors. Es geht schließlich nicht darum, eine Fragestellung, die im Raum steht, multiperspektivisch in Frage zu stellen, sondern die eigens aufgestellte These, Computerspiele seien ein Mittel, Geschichten zu erzählen, linear zu erläutern und argumentativ zu festigen. Auch lässt sich an der Quellenlage genau festlegen, dass aus einem größeren Sachtext nur die Seiten 70-79 herausgenommen wurden, um den mir vorliegenden zu analysierenden Text zu filtern. Sicherlich wurde bis zu diesem Punkt auch schon darauf hingeführt, wie diese These zu Stande kam und sie muss nicht weiter in Frage gestellt werden, zumal ich der selbigen Meinung bin. Darum werde ich auch hauptsächlich die Beispiele Christian Schiffers einfach näher ausführen und erweitern, anstatt dagegen zu argumentieren, bis auf zwei Ausnahmen, die nicht falschen Ansichten Schiffers verschuldet sind, sondern einem Aspekt der Zeitdifferenz. Als von dem „interaktiven Medium Videospiel“ gesprochen wird und ausgerechnet Super Mario als Beispiel aufgeführt wurde, war ich recht verwundert, dass Schiffer, gerade, da er von dem Sprung in Schluchten, die den Fluss der Fortführung des Geschichtsablaufs hindern und zum Startpunkt zurücksetzen, spricht, nicht auf das Offensichtlichste eingeht, um seine Unterthese zu stützen, Bücher und Videospiele seien anders starke Präger individueller Möglichkeiten für den Spieler, in das Geschehen einer Handlung einzugreifen: Wenn in einem Buch ein Charakter verenden würde und daraufhin die Geschichte einfach wiederholt wird, bis es ihm gelingt, eine Aufgabe zu erfüllen, ohne dabei zu sterben, würde das die Grenzen sprengen, die in der Geschichtserzählung möglich sind. Richtig immersiv wird die Erfahrung für den Spieler doch erst, wenn sein spielerisches Vermögen dafür sorgt, dass die Hauptfigur, die gesteuert wird, eine große Hürde überwindet, nicht wie in einem Film oder einem Roman, der trotz spannender Geschichte sowieso entweder im Schema des Happy Ends oder im Schema des Tods enden wird. In Videospielen kann es eben durchaus beides geben und eine Figur kann bis zum Ende des Spiels schon mehrere Millionen Male erschossen, erstochen, eine Schlucht hinuntergefallen, verhungert, ertrunken oder eine beliebige andere Möglichkeit des Sterbens erlitten haben, doch aber die Prinzessin retten, das gegnerische Team ausschalten oder einen fernen Planeten von dessen korrupter Schreckensdiktatur befreien. Zur Zielgruppenanpassung fiel mir ohne weiteres Nachdenken das Partyspiel „Ultimate Chicken Horse“ für den Computer ein, bei dem schon die Genrebezeichnung die Umstände erklärt, unter welchen es gespielt werden soll. Das reine Multiplayer-Spiel ist ein lustiges und niedlich gestaltetes Jump N Run, in dem zwei bis zu vier Spieler gemeinsam dasselbe Level spielen, nicht hintereinander, sondern gleichzeitig. Sie können entweder so schnell wie möglich zur Ziellinie rennen und dadurch gewinnen oder anderen Spielern fallen stellen, damit diese das Level nicht beenden können. Wer zehn Mal als erstes die Ziellinie überschreitet, also am schnellsten war, gewinnt eine Spielrunde. Hier gibt es die Funktion der Taste „Y“ auf der Tastatur bzw. des Buttons „Y“ auf einem Controller, sollte man einen solchen an den Computer anschließen, welche nämlich einfach hervorsieht, dass die eigene Spielfigur beginnt zu tanzen. Dieses Tanzen hat keinen näheren Zweck und hält sogar eigentlich eher den Spieler auf, weil man dabei nicht weiterlaufen kann, doch man kann andere Spieler damit auf humoristische Weise verspotten, sollten diese gerade in eine Falle tappen. Stellt man sich diese Funktion bei einem Spiel vor, welches für eine andere Zielgruppe gedacht ist, zum Beispiel bei einem Einspieler-Abenteuer, wäre das hingegen sehr unpassend und würde die aufgebaute vorherrschende Atmosphäre zerstören. Stellen Sie sich dafür einmal ein Spiel vor, welches in einem Geisterhaus, einer Burg zu Zeiten des Mittelalters oder in einer menschenverlassenen Weltraumstation, die von zombieähnlichen Kreaturen bewohnt ist, gegen die man fast keine Überlebenschancen hat, sich aber wehren muss, vor. Und dann überlegen Sie, ob ein Tanzknopf an dieser Stelle irgendeine Bewandtnis hätte. Ein anderes Denkbeispiel für diese Zielgruppenorientierung wäre es, sich einfach mal ein Tier wie eine Giraffe oder einen Elefanten in einem Spiel, welches in der Arktis spielt, vorzustellen oder ein Lovecraft-Monster wie den Cthulhu in einem niedlichen Kinderspiel. Auch bezüglich des von Schiffer verwendeten Begriffs des von den Entwicklern eines Computerspiels gesetzten „Rahmen“, innerhalb dessen sich Spieler austoben können, könnten weitere Paradigmen und Muster von Nöten sein, die sich bereits durchsetzen konnte, um eben jene als Belege zu nennen, wenn man nun sich nämlich einmal eine Videospielserie wie Pokémon anschaut, fällt schnell auf, dass jedes Spiel, welches kein Spin-Off, sondern ein Teil der Hauptreihe darstellt, auf den selben Schemen beruht und vom Prinzip, was im Spiel zu tun ist, fast identisch erscheint. Es werden Monster, die Pokémon, in Grasfeldern gefangen, damit diese in Kämpfen gegen andere Pokémon anderer Trainer antreten können. Damit diese Kämpfe ausgeglichen von Statten gehen können, liegt es am Spieler, die Monster so gut wie möglich zu trainieren und stärker werden zu lassen. Der Rahmen ist also immer gleich, jedoch kommt dem Spieler das Erlebnis immer anders vor; ich selbst behaupte als Fan der Reihe, dass besonders die fünfte und sechste der sieben Spielgenerationen es mir angetan haben und es andere gibt, die ich nicht so gerne mag. Atmosphärisch vermittelt jedes Spiel nämlich ein anderes Gefühl, da es in anderen Regionen spielt, die jeweils der echten Welt nachempfunden sind, so spielen sich einige Spiele eher am Wasser ab, andere haben von Großstädten inspirierte Welten und die im Oktober neu erscheinenden Titel „Pokémon Schwert“ und „Pokémon Schild“ sind an die Region rund um die Stadt London in Großbritannien angelehnt. Auf den ersten Blick scheint jeder Ego-Shooter gleich zu sein, doch es gibt nur so viele davon, da das Prinzip immer ein wenig anders ist. „Prey“ spielt sich in einer verlassenen Weltraumstation ab, im Endlosspiel „Borderlands“ geht es um das Sammeln von Schätzen, während Aliens und Insektenkreaturen um Leben und Tod die Basen, in welchen neuer „Loot“, also eben jene Schätze gefunden werden können, bewachen und „Battlefield“ stellt historische Kriege nach. Die von Schiffer so sehr geschätzte Super Mario-Reihe spielt sich in den meisten Ablegern im Pilzkönigreich ab, doch was ist mit Super Mario Sunshine, welches auf der Insel „Piazza Delfino“ spielt oder Super Mario Galaxy, welches durch das Szenario, zwischen verschiedenen Galaxien zu reisen, mit physikalischen Gegebenheiten wie der Schwerkraft arbeitet? Zu guter Letzt, und sich wahrscheinlich als das beste Beispiel für dieses Argument herausstellend, lässt sich The Legend of Zelda nennen, eine weitere Reihe des Industriegiganten Nintendo, wo nicht nur jedes Spiel in einer Paralleldimension der fiktiven Welt „Hyrule“ spielt, sondern die Spiele auch mit einem anderen Artstyle ausgestattet sind und manchmal düster bis erschreckend gruselig (Twilight Princess, Majoras Mask), manchmal aber auch zu großen Teilen friedlich-fröhlich im unter Videospielentwicklern als „Cell-Shading“ bezeichneten Comic-Design (Wind Waker, Phantom Hourglass) oder abenteuerlich-episch (The Legend of Zelda 1, Ocarina of Time, Breath of the Wild) sein können. Das erste von beiden Argumenten, die, wie bereits im Vorhinein angesprochen, nicht mehr wirklich zeitgemäß sind, lässt sich schließlich in den Zeilen 61 und 62 finden, die im Analyseteil dieses Texts ebenfalls schon als für die eigene Erörterung von Relevanz herausgestellt wurden: „Gebrochene Charaktere mit tragischer Fallhöhe sind in Computerspielen immer noch die Ausnahme“. An dieser Stelle würde ich nämlich behaupten, dass sich in fünf Jahren, seitdem Christian Schiffer 2014 seinen Aufsatz verfasst hat, viel hinsichtlich der Erzählung charakterstarker Figuren getan hat. Man beachte die Dramatik eines „The Last of Us“, in dem ein Vater seine Tochter in einer Zombieapokalypse verloren hat und präventiv ein kleines Mädchen adoptiert, um sein verlorenes Selbstwertgefühl wieder zu erlangen, indem er dieses so beschützt, wie er es bei seiner leiblichen Tochter wollte, aber nicht geschafft hat. „Life is Strange“ ist ein brillantes Spiel, welches viel eher wie ein interaktiv erzählter Film abläuft, bei dem man Entscheidungen trifft, über die man lange nachdenken muss. Um die Protagonistin Max Caulfield herum verstricken sich Mitschüler in Mobbing, die beste Freundin wird von einem Drogendealer erschossen, ein gigantischer Tornado zerstört ganz Oregon und es herrscht ein Endzeitszenario vor. Dieses kann jedoch nur Max selbst erkennen, denn jedes Mal, wenn etwas Schreckliches passiert, wird der Spieler dazu aufgefordert, die Zeit zurückzudrehen. Sollte er sich dagegen entscheiden, muss er mit ansehen, wie die Spielwelt sich langsam aber sicher dem Ende entgegenstellt und kann das Spiel kein zweites Mal starten, ohne es deinstallieren und neu herunterladen zu müssen. Man kann sich natürlich auch immer für die Optima entscheiden, die das Spiel dem Spieler vorschreibt, jedoch wird das Ende immer ein negatives sein. Die letzte Entscheidung des Spiels hat die Computerspielgemeinde erschüttert und in Tränen zurück gelassen: Opfert man die beste Freundin und kümmert sich darum, den Tornado aufzuhalten oder opfert man die Heimatstadt und reist mit der besten Freundin in die Freiheit? Max Caulfield ist ein düster geschriebener, depressiver Charakter, der selbst, wenn mit der Freundin gefeiert wird, hinsichtlich der auf sie zukommenden Entscheidungslasten und Ereignisse, nie auch nur ein einziges Mal im Spiel lächelt. „Heavy Rain“ behandelt die Geschichte eines Polizisten, der den Mörder seines Sohns sucht und am Ende erfährt, selbst derjenige gewesen zu sein, weswegen der Sohn sterben musste. Die Videospielindustrie konzentriert sich selbst in den großen Blockbustertiteln, vorallem aber in der immer wichtiger werdenden Indie-Branche unabhängiger Spieleentwickler darauf, emotional hochwertige und gesellschaftskritische Geschichten zu schreiben, die von tragischen Schicksalen der Figuren darin geprägt sind. Schiffer bezieht sich ebenfalls auf die Fehler, die ein Spieler macht, die in einem Film oder Buch nicht behandelt werden würden, da der optimale Handlungsfluss nicht unterbrochen werden soll. Hingegen fallen mir, diese Aussage Schiffers unterstützend, sogar Videospiele ein, in denen es das Ziel ist, den Spieler vor unmöglich durchschaubare Situationen zu stellen, in denen ein Tod des Spielcharakters unausweichlich scheint. Vor dem Bildschirm versucht der Spieler zu verstehen, was er falsch gemacht hat, wenn in „Dark Souls“ ein Gegner gerade mit nur einem Schlag den Protagonisten umgebracht hat; eine bessere Rüstung muss her! Das mit einer frei begehbaren Spielwelt ausgestattete „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ bestraft allzu neugierige Spieler, die es nicht abwarten können, in dunkle Wälder zu rennen, indem keine Hilfestellungen gegeben werden, wie man dort wieder hinauskommen kann. Das erfährt man nämlich erst durch einen Dialog mit einer anderen Spielfigur, die erst viel später ansprechbar ist. Theoretisch könnte man sofort zum Endboss des Spiels gehen, doch schnell bemerkt der Spieler, dass er nicht genug dafür gewappnet ist und gar nicht weiß, wie die Gegner, die sich dem Spieler in den Weg stellen, einzuschätzen sind. Man ist neugierig, macht den Fehler, der Neugier nachzugehen, spielt daraufhin, weil man gelernt hat, was man falsch machte, das Spiel auf normalem Wege weiter und bemerkt, dass man trotzdem alles sieht, was man schon am Anfang hat sehen wollen, nur dauert es eben seine Zeit, bis die Geschichte dieses Areal hervorsieht. „The Stanley Parable“ ist ein Spiel mit über 100 verschiedenen möglichen Enden, jenachdem, durch welche Türen man im Bürogebäude, in welchem man sich befindet, schreitet. Eine Erzählstimme sagt so zum Beispiel „Daraufhin geht Stanley durch die Tür auf der rechten Seite.“ und es bleibt dem Spieler selbst überlassen, ob er nicht vielleicht doch lieber zuerst nach links geht. Eine Sackgasse wird erreicht und man kehrt wieder um; der Erzähler lacht Stanley aus. Bezüglich des Arguments, dass es ebenso auch „Experimentalspiele“, oder wie ich sie gerne auch bezeichne „Kunstspiele“ gibt, sind mir sofort die Spiele des Entwicklers „ThatGameCompany“ eingefallen, die mit den Spielen „Journey“, „ABZU“ und „Flower“ bereits drei Spiele veröffentlicht haben, die ohne ein einziges geschriebenes Wort auskommen. Man erforscht, je nach Spiel, eine Wüste, ein unterirdisches System eines Wasserlabyrinths und eine riesige Wiese, spielt einen namenlosen Wanderer, Taucher und den Wind, der die Blumen in Bewegung setzt. Diese Spiele haben kein festes Ende oder gar ein Ziel. Sie dienen der Entspannung und gestaltet ein optisch wunderschönes Kunstwerk, in welchem man interaktiv Figuren steuern kann. Anders als Schiffer an dieser Stelle behauptet würde ich jedoch nicht behaupten, dass man einen anderen Begriff einberufen müsste. Man kann diese Experimente des Programmierens durchaus als Videospiele kategorisieren; eigentlich ist ja jedes Spiel ein Kunstwerk, genauso wie jedes Musikalbum, jeder Film und jede Zeichnung die Bezeichnung „Kunst“ gleichermaßen verdient. Ich verstehe jedoch, was man 2014 vielleicht mit dieser Differenzierung gemeint haben könnte. Im Jahr 2016 geschah das, was man in der Videospielszene nicht für möglich gehalten hat. Ein Blinder hat „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ durchgespielt, da man für ihn eine Modifikation des Spiels erstellt hat, indem ein Stereo-Surround-Sound angewendet wird. Wenn ein Gegner von hinten die Hauptfigur „Link“ attackiert, wird der dazugehörige Soundeffekt auch ‚von hinten‘ abgespielt und die Musik eines Areals wird lauter oder leiser, je näher man sich mittig des Areals befindet. Dieses Experiment zeigte, dass Videospiele, die für Sehende konzipiert wurden, mit ein wenig Leidenschaft für das „Modden“, so nennt man das Modifizieren von Videospielen für bestimmte Bedürfnisse der Spieler, über die eigentlichen Grenzen hinaus auch Menschen unterhalten und fesseln können, die von der optischen Macht eines Spiels überhaupt nichts wissen. Vielleicht stellen sich Blinde in ihren Gedanken ein Spiel ja noch viel imposanter vor, als es eigentlich aussieht und sind noch fantasievoller als die Entwickler. Den letzten Absatz des Aufsatzes von Schiffer würde ich zwar gerne mit weiteren Beispielen belegen, doch habe ich das quasi bereits mit der Nennung von Spielen wie Heavy Rain und Life is Strange getan; Spiele, die an die Substanz menschlicher Emotionen gehen und viele Spieler weinend vor dem Bildschirm zurücklassen, wenn sie erst einmal beendet sind; die unser echtes Leben reflektieren und uns empathischer werden lassen. Stattdessen ist es mir hier wichtig, dass endlich einmal die „Killerspiel“-Debatte beendet wird, von der ich echt langsam genug habe. Was erlauben sich „Psychologen“ die psychischen Störungen einiger Straftäter auf Videospiele zu beziehen. Schon bevor diese konsumiert wurden, haben die Menschen die geistigen Krankheiten gehabt; nicht erst daraufhin. Ein Ego-Shooter zeigt lustigerweise ja sogar eher noch, wie grausam Krieg und Gewalt sein kann und dramatisiert die Umstände von Schießereien realitätsnah, anstatt Gewalt zu legitimieren, was die ganze Diskussion umso lächerlicher macht. Eigentlich hat das nicht so viel mit dem originalen Aufsatz zu tun; nur möchte ich diese Feststellung bereits mit in die Erörterung einbringen, damit man mir das nicht als Gegenargument vorwerfen kann. Faktisch stimmt das ganze Medienecho und Argument hingegen „Killerspielen“ auch einfach überhaupt nicht.
- Ich würde als Fazit also behaupten, dass Christian Schiffer eine gelungen objektive, sachlich beurteilte und in den aufgestellten Thesen korrekte Analyse bezüglich der Fragestellung, wie Videospiele Geschichten erzählen, liefern konnte. Jeder liebt Geschichten, ob sie nun durch mündliche Wiedergabe übermittelt werden, in einem Roman durchgelesen oder in einem Film dargestellt den Konsumenten empfangen oder in einem Videospiel auf die direkteste und persönlichste Art und Weise den Spieler unterhalten, weswegen ich anzweifle, dass es wirklich noch so viele Menschen gibt, wie man es oft darstellt, die anzweifeln, inwiefern Videospiele als wichtige Geschichtenerzähler fungieren können. Als Filme etwas Neues waren, haben sich diejenigen, die nicht damit großgeworden sind, auch gar nicht damit beschäftigen wollen oder Filme als etwas Negatives dargestellt, was die Menschheit ruinieren wird. Heutzutage ist die älteste lebende Generation jene, die den Film als große Innovation wahrgenommen hat. Und so wird das Verständnis für den Videospielkult in einigen Jahrzehnten wohl auch allgemein in der Gesellschaft erreicht sein. Die jetzigen 50-jährigen sind in etwa auch schon die Menschen, die in ihrer Jugend Videospiele das erste mal konsumieren konnten, damals noch auf Spielhallenautomaten oder auf den ersten Heimkonsolen wie dem Sega Master System, den Commodore-Computern C64 oder Amiga, dem Nintendo Entertain System und weiteren. Zumindest das Videospiele ein Kulturgut sind, kann niemand abstreiten, alleine schon, weil sie als Unterhaltungsmedium allgegenwärtig sind. Selbst wenn man den ‚Hype‘ nicht selbst nachvollziehen kann, reicht es ja, sich Verkaufszahlen von Spielen anzuschauen am ersten Tag, nachdem sie überhaupt veröffentlicht wurden. Zuschauer der Videospielpressekonferenz E3 in Kalifornien weinen teilweise jedes Jahr wegen bestimmter Ankündigungen und zelebrieren gemeinsam die Veröffentlichung eines Spiels, obwohl sie gerade um den gesamten Globus gereist sind, nur um Werbung anzuschauen. Mit Videospielen drücken wir ‚Gamer‘ uns aus. Das ist eben genauso eine Form von Selbstexpression wie wenn wir in ein Kunstmuseum fahren, um dort die Werke Van Goghs oder Da Vincis zu betrachten. Wer nun das erste Mal davon überzeugt werden konnte, was für wichtige Träger von Geschichten ein Videospiel doch sein kann, dem empfehle ich Portal. Ich habe mir neulich schon einmal Gedanken darüber gemacht, was das erste Spiel wäre, welches ich einem Neuling empfehlen würde. Portal ist ein First Person-Spiel; diese sind das immersivste, was es in dem Bereich überhaupt geben kann, da man das Spiel aus der Sicht der Spielfigur selbst sieht. Das Spiel hat ein besonders innovatives System: Man kann mit einer Portalpistole ein blaues und ein oranges Energiefeld an Wände setzen und somit Rätsel lösen, die teils sehr komplex und knifflig zu lösen sind. Wenn man durch eines der Portale läuft, kommt man am anderen wieder heraus. Währenddessen wird die Geschichte erzählt, wie man überhaupt in diesen Turing Test gekommen ist und wieso man als Versuchskaninchen so stupide immer wieder dasselbe zu tun hat. Nach jedem Rätsel offenbart sich ein weiteres Element der Geschichte, bis man schließlich in einer düsteren, dystopischen Handlung verstrickt ist, die in einem überraschenden Ende resultie
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement