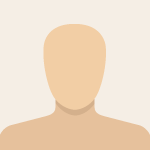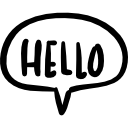Advertisement
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- Sachtextanalyse: Robert Leicht - Justizmord 1999
- In der Glosse „Justizmord“ von Robert Leicht, 1999 veröffentlicht, geht es um die Todesstrafe in den USA deren Praxis der Autor empörend findet. Der Autor versucht seine Antwort auf die Frage, ob die Todesstrafe eine rechtliche und moralische Möglichkeit der Strafjustiz sein könne, polemisch zu verdeutlichen.
- Die Todesstrafe ist aus gutem Grund in Europa weitgehend abschafft worden. Gegen sie kann geltend gemacht werden, dass der Mensch kein Recht dazu hat, einen anderen zu töten. Außerdem dass der Abschreckungseffekt, um den es ja offenbar geht, nicht greift, denn sonst müssten die Vollzüge der Todesstrafe stärker zurückgehen, als sie es tun. Oder dass eine absolute juristische Sicherheit nicht gegeben werden kann, was viele eingestandene Fehlurteile in der Geschichte der Justiz zeigen.
- Robert Leicht nimmt den Fall Troy Dale Farris zum Anlass, seine Empörung zur Praxis der Todesstrafe in den USA zu veröffentlich. Obwohl seine Schuld direkt nicht nachgewiesen werden konnte, ist Farris verurteilt worden, nur weil ein Mitangeklagter sich durch seine Beschuldigung selbst von der Anklage befreien konnte. Offenbar ein allzu wahrscheinlicher Justizirrtum. Die Hoffnung, dass durch einen Appell an den Begnadigungsausschuss die juristisch fragwürdige Entscheidung hätte aufgehoben werden können, war trügerisch. Der Ausschuss bestätigte das Urteil. Die letzte Möglichkeit ist dann eine Begnadigung durch den Gouverneur, in diesem Fall George W. Bush jr., der dem Begnadigungsgesuch aber auch nicht nachkam, weil, so die Unterstellung des Autos, es für seine politische Karriere vorteilhafter schien, die Todesstrafe vollziehen zu lassen. Immerhin wolle er, so der Autor, Präsident der USA werden. Also ein politischer Missbrauch der Justiz. Aber noch etwas anderes empört den Autor: Das ist der Anspruch der USA auf eine moralische Vorreiterrolle der Welt und er stellt diesen Anspruch gegen das Versprechen Russlands, auf die Todesstrafe zu verzichten. Denn immerhin war dieses Land zur Sowjetzeit von amerikanischen Präsidenten als „Reich des Bösen“ gekennzeichnet worden und Robert Leicht stellt zum Schluss die Frage, ob eine moralische Weltmacht sich eine solche Praxis noch leisten könne.
- Rhetorisch beginnt Robert Leicht zunächst mit der knappen Schilderung des Hinrichtungsgeschehens in den USA. Im Satzbau des ersten Absatzes zeichnet er die Geschwindigkeit mit, der die Todesstrafe verhängt wird nach. Die Ellipse „kaum aufgestellt“(Z.2) gefolgt von einem Wortspiel „kaum aufgestellt, bereits eingestellt“(Z.2) unterstützt den Eindruck der Geschwindigkeit und verdeutlicht die Leichtfertigkeit und die Hemmungslosigkeit mit der ein Urteil vollstreckt wird. Der Autor erwähnt auch den Namen des verurteilten um eine emotionale Bindung aufzubauen und den Lesern zu verdeutlichen, dass es nicht nur Zahlen und Fakten der Todesstrafe gibt. Für Robert Leicht wird das Todesurteil brutal an einem Menschen vollstreckt, die verblasste Metapher „ums Leben gebracht“(Z.5f) untermauert diese Aussage. Er nennt den Namen und das Alter der Person um sie hinter der Zahl der „500. Hinrichtung“(Z.2) deutlich zu machen. Der Autor verwendet Umschreibung für die Todesstrafe, so spricht er von einer „Giftspritze“, diese Wortwahl ruft ein unangenehmes und abwertendes Gefühl hervor. Die Empörung über die Anzahl der Todesurteile ist am Satz „peinlicher Rekord“(Z.2) erkennbar. Der Autor kombiniert eine Hyperbel mit einem abwertenden Adjektiv, dies wirkt irritierend weil ein negativer und ein positiver Begriff verbunden wird. Robert Leichts emotionale Sprache und die eindeutigen Urteile dienen dazu, dem Leser den „Skandal“ dieser Hinrichtung aufzuweisen.
- Sachtextanalyse: Robert Leicht - Justizmord 1999
- In der Glosse „Justizmord“ von Robert Leicht, 1999 veröffentlicht, geht es um die Todesstrafe in den USA deren Praxis der Autor empörend findet. Der Autor versucht seine Antwort auf die Frage, ob die Todesstrafe eine rechtliche und moralische Möglichkeit der Strafjustiz sein könne, polemisch zu verdeutlichen.
- Die Todesstrafe ist aus gutem Grund in Europa weitgehend abschafft worden. Gegen sie kann geltend gemacht werden, dass der Mensch kein Recht dazu hat, einen anderen zu töten. Außerdem dass der Abschreckungseffekt, um den es ja offenbar geht, nicht greift, denn sonst müssten die Vollzüge der Todesstrafe stärker zurückgehen, als sie es tun. Oder dass eine absolute juristische Sicherheit nicht gegeben werden kann, was viele eingestandene Fehlurteile in der Geschichte der Justiz zeigen.
- Robert Leicht nimmt den Fall Troy Dale Farris zum Anlass, seine Empörung zur Praxis der Todesstrafe in den USA zu veröffentlich. Obwohl seine Schuld direkt nicht nachgewiesen werden konnte, ist Farris verurteilt worden, nur weil ein Mitangeklagter sich durch seine Beschuldigung selbst von der Anklage befreien konnte. Offenbar ein allzu wahrscheinlicher Justizirrtum. Die Hoffnung, dass durch einen Appell an den Begnadigungsausschuss die juristisch fragwürdige Entscheidung hätte aufgehoben werden können, war trügerisch. Der Ausschuss bestätigte das Urteil. Die letzte Möglichkeit ist dann eine Begnadigung durch den Gouverneur, in diesem Fall George W. Bush jr., der dem Begnadigungsgesuch aber auch nicht nachkam, weil, so die Unterstellung des Autos, es für seine politische Karriere vorteilhafter schien, die Todesstrafe vollziehen zu lassen. Immerhin wolle er, so der Autor, Präsident der USA werden. Also ein politischer Missbrauch der Justiz. Aber noch etwas anderes empört den Autor: Das ist der Anspruch der USA auf eine moralische Vorreiterrolle der Welt und er stellt diesen Anspruch gegen das Versprechen Russlands, auf die Todesstrafe zu verzichten. Denn immerhin war dieses Land zur Sowjetzeit von amerikanischen Präsidenten als „Reich des Bösen“ gekennzeichnet worden und Robert Leicht stellt zum Schluss die Frage, ob eine moralische Weltmacht sich eine solche Praxis noch leisten könne.
- Rhetorisch beginnt Robert Leicht zunächst mit der knappen Schilderung des Hinrichtungsgeschehens in den USA. Im Satzbau des ersten Absatzes zeichnet er die Geschwindigkeit mit, der die Todesstrafe verhängt wird nach. Die Ellipse „kaum aufgestellt“(Z.2) gefolgt von einem Wortspiel „kaum aufgestellt, bereits eingestellt“(Z.2) unterstützt den Eindruck der Geschwindigkeit und verdeutlicht die Leichtfertigkeit und die Hemmungslosigkeit mit der ein Urteil vollstreckt wird. Der Autor erwähnt auch den Namen des verurteilten um eine emotionale Bindung aufzubauen und den Lesern zu verdeutlichen, dass es nicht nur Zahlen und Fakten der Todesstrafe gibt. Für Robert Leicht wird das Todesurteil brutal an einem Menschen vollstreckt, die verblasste Metapher „ums Leben gebracht“(Z.5f) untermauert diese Aussage. Er nennt den Namen und das Alter der Person um sie hinter der Zahl der „500. Hinrichtung“(Z.2) deutlich zu machen. Der Autor verwendet Umschreibung für die Todesstrafe, so spricht er von einer „Giftspritze“, diese Wortwahl ruft ein unangenehmes und abwertendes Gefühl hervor. Die Empörung über die Anzahl der Todesurteile ist am Satz „peinlicher Rekord“(Z.2) erkennbar. Der Autor kombiniert eine Hyperbel mit einem abwertenden Adjektiv, dies wirkt irritierend weil ein negativer und ein positiver Begriff verbunden wird. Robert Leichts emotionale Sprache und die eindeutigen Urteile dienen dazu, dem Leser den „Skandal“ dieser Hinrichtung aufzuweisen.
- Alessandro Stuckenschnieder
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement