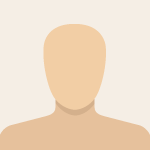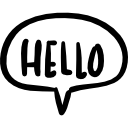Advertisement
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- sein, müssen nicht immer erwidert werden. Die Frage sollte also vielmehr lauten: Wann müssen sie erwidert werden? Welche Arten von Gaben? Unter welchen Umständen? Und was genau kann als Erwiderung gelten? Die Schlussfolgerung wäre unvermeidbar gewesen, hätte Mauss den Begriff der »totalen Leistung« (die er auch als »totale Reziprozität« bezeichnet) weiter ausgearbeitet, statt sich übergangslos dem »Potlatch« zuzuwenden. Bei totalen Leistungen mussten Gaben nicht erwidert werden. Denn anders als beim kompetitiven Gabentausch schufen »totale Leistungen« Beziehungen zwischen Individuen und Gruppen, die genau deshalb dauerhaft waren, weil man sie nicht durch eine Gegengabe aufkündigen konnte. Die eine Seite konnte gegenüber der anderen unbeschränkte Forderungen erheben, weil sie dauerhaft waren; nichts wäre für ein Mitglied einer Irokesen-Moiety absurder, als mitzuzählen, wie viele Tote der jeweils anderen Moiety man in letzter Zeit begraben hatte, um festzustellen, welche vorne lag. Deshalb hielt Mauss sie auch für »kommunistisch«; auf sie trifft Louis Blancs berühmter Satz zu: »Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen.« Die meisten von uns gehen mit ihren Freunden in dieser Weise um. Weil man die Beziehung nicht so behandelt, als würde sie jemals enden, ist auch keine Buchhaltung nötig. Welche Schlüsse man aus den jeweiligen realen Gegebenheiten auch ziehen mag (und die können ganz unterschiedlich sein), der Kommunismus gründet jedenfalls auf einer Ewigkeitsvorstellung. Da angenommen wird, es gebe keine Geschichte, ist jeder Moment letztlich genau wie jeder andere. Das eigentliche Problem entstand, wie ich glaube, als Mauss sich von hier aus unilateralen Beziehungen zuwandte, in denen nur eine Partei unbeschränkt Anspruch auf die Ressourcen der anderen erheben darf. Das musste als logischer Schritt erscheinen, da Mauss' wichtigste Beispiele Beziehungen waren, die durch Heirat entstehen. Wo der Schwesterntausch die vorherrschende Form der Heirat ist, sehen sich beide Seiten in einer Beziehung dauerhafter wechselseitiger Schuld.173 Wenn Frauen dagegen nur in eine Richtung gegeben werden, liegt die Schuld auch nur bei einer Seite, und derjenige, der die Frau gibt, kann oft unbeschränkte Forderungen an die Familie desjenigen stellen, der die Frau nimmt, während dieser überhaupt keine gültigen Ansprüche stellen kann. Aber inwiefern kann das als Beispiel für »Reziprozität« gelten? Es scheint denkbar weit von Reziprozität entfernt zu sein. Bei einem derart vage gehaltenen Begriff fällt einem allerdings immer irgendetwas ein, und das gilt auch für Mauss, wenn er erklärt, dass solche ungleichen Beziehungen im Allgemeinen einen Kreis bilden, der alles umfasst und letztlich für eine ausgeglichene Bilanz sorgt.174 Genau dieses Argument griff später Lévi-Strauss auf und entwickelte es in Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft weiter.175 Er sprach von solchen zirkulären Heiratssystemen als
- »generalisiertem Austausch«. Dieser Begriff hatte schon immer eine verwirrende Ähnlichkeit mit Marshall Sahlins ' »generalisierter Reziprozität«,176 die allerdings nicht das Gleiche bezeichnet, sondern auf den Jeder-nach-seinen-Fähigkeiten-Kommunismus zurückgeht. Die Autoren haben sich offenbar jeweils einen anderen Aspekt von Mauss' »totaler Leistung« vorgenommen. Lévi-Strauss greift Mauss' Argument der unbeschränkten Schuld der Frauennehmer gegenüber den Frauengebern auf, um ein System höchst hierarchischer Beziehungen zu beschreiben, die allerdings aufgehoben werden können, wenn alle im Kreis heiraten. Sahlins wiederum definiert die »generalisierte Reziprozität« als eine Art unbeschränkter Verantwortung zwischen nahen Verwandten, von denen alle nach Kräften einander helfen, und zwar nicht, weil sie eine Rückzahlung erwarten, sondern einfach, weil sie wissen, dass der andere in einer ähnlichen Situation dasselbe tun würde. Das stellt er der »ausgeglichenen Reziprozität« gegenüber, die zwi- sehen Menschen vorherrscht, die sich zwar weniger nah stehen, aber doch nah genug, um sich verpflichtet zu fühlen, moralischen Grundsätzen entsprechend miteinander umzugehen. »Ausgeglichene Reziprozität« umfasst dann interessanterweise den klassischen Gabentausch und weniger halsabschneiderische Formen von Tausch und Handel. Es lohnt sich, diese Verbindung herzustellen. Wenn man den verwirrenden Begriff der Reziprozität weglässt, wird nämlich schnell klar, dass das klassische Gabe-Gegengabe-Szenario sehr viel mehr mit dem Markttausch zu tun hat, als wir gemeinhin annehmen, wenigstens im Vergleich zu der Art unbeschränktem Kommunismus, von dem Mauss ausging. Während es bei Letzterem immer darum geht, ein dauerhaftes Bewusstsein gegenseitiger Verpflichtung zu erhalten, geht es bei Ersterem darum, Verpflichtung zu leugnen und größtmögliche individuelle Autonomie geltend zu machen. Man könnte sogar sagen, dass es bei einem solchen ausgeglichenen Gabentausch noch mehr als bei den meisten Marktvereinbarungen darum geht, die absolute Autonomie der Akteure geltend zu machen. Nehme man zum Beispiel einen Mietvertrag. Ich vermiete Ihnen für ein paar Monate eine Wohnung, wofür Sie mir nach Ablauf der Zeit eine bestimmte Summe bezahlen. Parteien, die einen solchen Vertrag schließen, handeln so, als wären sie dazu verpflichtet, aber das sind sie gar nicht. Wenn der Vertrag nicht gesetzlich abgesichert wird, dann können Sie, wie wir beide sehr wohl wissen, einfach Ihre Sachen packen und sich aus der Verantwortung stehlen; oder (was wahrscheinlicher ist) ich komme meinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nach, für eine gut funktionierende Heizung oder die Renovierung des Badezimmers zu sorgen. Wir tun also so, als unterlägen wir mehr Zwängen, als wir es tatsächlich tun. In dem klassischen Gabenszenario ist genau das Gegenteil der Fall: Der Geber tut so, als erwarte und wünsche er keinerlei Erwiderung auf sein Geschenk, der Empfänger tut so, als sei er durch kein Gefühl der Verpflichtung zum Gegengeschenk gebunden. Beide Parteien tun so, als seien sie sehr viel freier und autonomer, als sie es tatsächlich sind. Meines Erachtens liegt im Begriff der Autonomie der Schlüssel zum Verständnis einer solchen Art von Gabentausch. Wenn es dabei um die »Schaffung sozialer Beziehungen« geht, dann nur um stark beschränkte, temporäre Beziehungen. Darüber hinaus sind sie völlig unausgewogen - der ursprüngliche Geber ist zunächst überlegen und behält seine Autonomie; die Autonomie des Empfängers ist dagegen so lange in Frage gestellt, bis er ein entsprechend prachtvolles Gegengeschenk macht, und in diesem Moment ist die Beziehung zu Ende. Das ist sie zumindest, wenn die beteiligten Parteien das wollen, da keine sonstigen Verpflichtungen bestehen bleiben. Der Akzent liegt stets auf der Verminderung des Gefühls von Verpflichtung oder Abhängigkeit, selbst wenn diese besteht. Natürlich kann ein solcher Gleiches-für-Gleiches-Tausch eine dauerhafte Beziehung gegenseitiger Unterstützung herstellen, aber das ist erst dann der Fall, wenn nicht mehr strikt Gleiches mit Gleichem vergolten wird. Etwas Ähnliches meinte Marshall Sahlins, als er vorsichtig formulierte, in den meisten »primitiven« Gesellschaften ist die ausgeglichene Reziprozität nicht die vorherrschende Form des Tauschs. Strittig ist auch die Stabilität der ausgeglichenen Reziprozität. Ausgeglichener Tausch kann zur Selbstauflösung führen. Einerseits schafft ein redlicher ausgeglichener Handel zwischen vergleichsweise weit voneinander entfernten Parteien Vertrauen, vermindert die soziale Distanz und erhöht so die Chancen auf einen
- zukünftigen generalisierten Handel. [...] Andererseits führt ein Wortbruch zum Bruch von Beziehungen, so wie eine Handelspartnerschaft durch ausbleibende Gegenleistungen zerbricht.177 Nicht nur ein Wortbruch - schon die Erwiderung einer Gabe hebt alle noch offenen Verpflichtungen zwischen zwei Parteien auf, es sei denn, der Empfänger war verschwenderisch und hat die ursprüngliche Gabe in einem Maße übertroffen, dass er einen Kreislauf des gegenseitigen Überbietens anstößt. Nicht ohne Grund sind die beiden Kwakwala-Transaktionen, die dem Gabe- Gegengabe-Tausch am ähnlichsten sind, die Praxis des »Zurückkaufens einer Tochter« - was im Grunde eine soziale Beziehung beendet - und die Gaben zwischen Rivalen, was die Kwakwala selbst als »Kampf mit Besitz« bezeichnen. Bei den Maori war es üblicher, Gleiches mit Gleichem zu vergelten; aber selbst hier liegt die eigentliche Bedeutung des berühmten hau der Gabe - so meine Deutung zutrifft - eben in seinem Vermögen, die Beteiligten vor der Bedrohung durch eine solche Beziehung zu bewahren. Statt von einer »generalisierten« oder »ausgeglichenen« Reziprozität sollte man vielleicht besser von einer relativ »offenen« und einer relativ »geschlossenen« Reziprozität sprechen: Bei einer offenen Reziprozität wird nicht Buch geführt, weil sie eine Beziehung ständiger gegenseitiger Verpflichtung impliziert. Bei einer geschlossenen Reziprozität wird die Beziehung dagegen durch einen Kontenausgleich beendet, zumindest besteht ständig die Möglichkeit dazu. Damit kann man die Beziehung auch eher als eine Sache des Grads und weniger der Art betrachten: Geschlossene Beziehungen können offener werden, offene geschlossener. Es drängt sich der Eindruck auf, dass die geschlossene Reziprozität von Gabe und Gegengabe die Form von Gabentausch ist, die am wenigsten das verkörpert, was eine »Schenkökonomie« von einer durch den Markt beherrschten unterscheidet. Sie ist kompe-titiv, individualistisch und kann leicht zu einer Art Tauschhandel werden (wie bei den Maori). Warum stellte Mauss sie dann ins Zentrum seiner Analyse - und ignorierte dabei sogar jene Zusammenschlüsse im Geist eines individualistischen Kommunismus, die, wie sich zeigt, in den meisten von ihm behandelten Gesellschaften wesentlich wichtiger waren? Auch hier liegt die Erklärung wohl in den politischen Zielen des Essays. Dass sich vermutlich auch ein Vertreter des freien Marktes herabgesetzt fühlt, wenn er ein Geschenk nicht erwidern kann, liefert hier ein gutes Beispiel. Die auch in modernen Gesellschaften herrschende »Verpflichtung, Gaben zu erwidern« kann weder durch die Marktideologie des Eigennutzes erklärt werden noch durch ihren Gegenpart, den selbstlosen Altruismus. Zumindest ist das Teil der Erklärung. Denn es gibt meiner Meinung nach noch einen tieferen Grund, der mit Freiheit zu tun hat. Mauss hebt hervor, dass die bei uns übliche scharfe Unterscheidung zwischen Freiheit und Verpflichtung genau wie die zwischen Eigennutz und Großzügigkeit in erster Linie eine vom Markt geschaffene Illusion ist, dessen Anonymität es möglich macht, darüber hinwegzusehen, dass wir uns in den meisten Dingen auf andere verlassen. Andernfalls muss man sich bewusst sein, dass Freiheit, wenn man nicht als Einsiedler leben will, vor allem die Freiheit der Entscheidung ist, welche Verpflichtungen man mit wem eingehen möchte. Nichtsdestoweniger lässt sich kaum leugnen, dass die Art von unbeschränkten, »kommunistischen« Beziehungen, von denen Mauss spricht, leicht in Hierarchien, Patro-nage und Ausbeutung abgleiten kann. Selbst Moieties haben im Allgemeinen eine Rangordnung. Die Krux liegt meiner Meinung nach in der Organisation der Familie, die fast immer beides ist, der zentrale Ort unbeschränkter Verpflichtungen und der Ort der elementarsten Hierarchieform einer Gesellschaft, das Urmodell von Autorität. Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen. Familien sind in verschiedenen Gesellschaften ganz unterschiedlich organisiert, und meistens liefern sie der Gesellschaft auch ein Urmodell für Gleichheit. Aber wie dem auch sei, Kommunismus und autoritäre Herrschaft tendieren überall auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlichem Ausmaß dazu, sich zu überschneiden.178 Je hierarchischer Beziehungen in einem Haushalt, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Beziehungen zwischen den männlichen Haushaltsvorständen durch solche ausgeglichenen und potentiell kompetitiven Formen des Gabentauschs vermittelt werden. Man denkt sofort an das Hochland von Papua-Neuguinea mit seinem berühmten te- und moka-Tausch oder den Tausch-als-
- Herausforderung im Mittelmeerraum der Antike oder im modernen Nordafrika. Sind diese Gesellschaften nicht auch alle für die extreme Unterordnung der Frau bekannt? Oder der aristokratische Wettstreit bei den Kelten oder Veden, der ebenfalls aristokratische Haushalte voraussetzte, in denen die Tauschprinzipien völlig anders aussahen. Oftmals erhält die Rivalität erst dadurch ihre Schärfe. Tom Beidelman zeigt in seiner Studie über Agamem-nons fehlgeschlagenen Versuch zu Beginn der Ilias, den Streit mit Achilles beizulegen, indem er diesem seine Sklavin zusammen mit unfassbaren Reichtümern zurückgibt, dass man durch ein derart verschwenderisches, niemals erwiderbares Geschenk den Empfänger auf eine Ebene mit einem Angehörigen des eigenen Haushalts stellt, einem Kind etwa oder einem Abhängigen, jedenfalls keinem Gleichrangigen. Ein solches Geschenk könnte kein Mann von Ehre akzeptieren.179 Vielleicht liegt darin eine Antwort auf die zu Beginn gestellte Frage: Wann müssen Geschenke erwidert werden? Im Falle einer strikten Äquivalenz lautet die Antwort: Geschenke müssen erwidert werden, wenn »kommunistische« Beziehungen so sehr mit Ungleichheit in eins gesetzt werden, dass sonst der Empfänger auf die Ebene eines Untergegebenen gebracht wird. Bei diesen Tauschformen wird dann eine Art fragile, kompetitive Gleichheit zwischen Akteuren hergestellt, die sich anderen gegenüber fast immer in einer hierarchisch übergeordneten Position befinden. Ein strukturalistisches Zwischenspiel (über Wert) Der eine oder andere wird sich fragen, wie all das mit der Frage des Werts zusammenhängt, die in diesem Kapitel nur am Rande aufgetaucht ist. Lassen Sie mich dazu einige wichtige Punkte anführen. Erstens zur kompetitiven Gabe: Um diese fragile, kompetitive Gleichheit schaffen zu können, muss es eine Art Äquivalenzstandard für Objekte geben. Sonst könnte man unmöglich sagen, die Gegengabe sei von »gleichem oder größerem Wert« als die ursprüngliche Gabe. Solche Standards zwischen Objekten können also aus der Notwendigkeit entstehen, soziale Gleichheit zu schaffen. Theoretisch ist natürlich ein System des Gabentauschs möglich, das ohne Äquivalenzstandard auskommt. Beispielsweise wäre ein System denkbar, in dem Leute exakt dieselben Dinge tauschen: Wie in Lévi-Strauss' berühmtem Beispiel von den beiden Männern, die man in einem billigen französischen Restaurant an einen Tisch gesetzt hat und die sich nun gegenseitig aus der gemeinsamen Flasche Wein einschenken.180 Ein solches System, in dem Fisch nur gegen Fisch und Yams nur gegen Yams getauscht werden kann, wäre allerdings höchst unpraktisch, es sei denn, es herrschte dort praktisch keine Arbeitsteilung oder alle notwendigen Wirtschaftsgüter ließen sich auf anderem Weg verteilen. Dennoch geht es in der Literatur zur Reziprozität erstaunlich oft um einen solchen offenbar sinnlosen Austausch identischer Dinge. Man sehe sich die folgende Analyse von Edmund Leach an, der dieses Prinzip an sein logisches Extrem treibt, indem er erklärt, dass sich ausschließlich auf diese Weise soziale Gleichheit herstellen ließe: Daher grüßen sich die Engländer mit der reziproken Grußformel »Wie geht es Ihnen?« und schütteln sich dabei die Hand. Nachbarn laden sich wechselseitig ein, um sich ihrer Freundschaft zu versichern. Entfernter voneinander wohnende Freunde tauschen Briefe oder Weihnachtskarten aus und so weiter. In all diesen Fällen wird Gleiches gegen Gleiches getauscht und die Botschaft dahinter lautet in etwa: »Wir sind Freunde und wir sind von gleichem Status.« Aber die Mehrzahl der Tauschakte zwischen Personen ist anderer Art. Entsprechend sind die meisten Personen in einem engen Beziehungsgeflecht eher von ungleichem als von gleichem Status. Die Ungleichheit des Tauschs verhält sich kongruent zur Ungleichheit des Status.181 Das ist sicherlich allzu sehr vereinfacht. Dennoch kann eine solche reductio ad absurdum bei der Klärung der anstehenden Fragen nützlich sein. Leachs Überlegung ist ein typisches Beispiel für die von erstaunlich vielen westlichen Gesellschaftstheoretikern vertretene Annahme, dass jede systematische Unterscheidung zwischen sozialen Rollen zwangsläufig eine Form von Ungleichheit bedeutet. Zum Teil ist das wohl auf die intrinsische Uneindeutigkeit des Wortes »Ungleichheit« zurückzuführen, das einerseits bedeuten kann, dass etwas in Bezug zu etwas anderem als überlegen
- bzw. unterlegen eingestuft wird, und andererseits, dass zwei Dinge schlicht nicht dasselbe sind. Allgemeiner betrachtet, leiden solche Generalisierungen meiner Ansicht nach alle unter einem ähnlichen logischen Fehler. Übersehen wird nämlich, dass sich anfänglich eine Ähnlichkeit zwischen zwei Begriffen feststellen lassen muss, will man ihnen einen Rang zuweisen. Wenn zwei Begriffe völlig unterschiedlich sind, können sie überhaupt nicht verglichen werden. (Deshalb ist »schwarz« das Gegenteil von »weiß« und nicht von »Frosch«.) Wenn sie nicht vergleichbar wären, könnten sie überhaupt nicht für »ungleich« erklärt werden.182 Dasselbe gilt, wenn man zwei Dinge als äquivalent bezeichnet. Denn damit behauptet man nicht, dass sie in jeder Hinsicht gleich sind, sondern nur, dass sie nach jenen Kriterien gleich sind, die man in diesem Zusammenhang für wichtig erachtet, während andere mögliche Kriterien nicht wichtig sind. »Alle Menschen sind gleich, weil sie alle gleich sind darin, eine unsterbliche Seele zu besitzen; daher hat hier der Umstand, dass sie verschieden große Füße haben, keinerlei Bedeutung.« Das Wertelement bezieht sich dabei auf die Kriterien, die in einem bestimmten Zusammenhang für bedeutend oder wichtig gehalten werden. Wenn man kein Zyniker oder Anhänger Dumonts ist, gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass die wichtigsten Zusammenhänge immer die schlimmsten sind. Bei genauerer Betrachtung erklärt sich das alles eigentlich von selbst. Die Angelegenheit wird erst dann komplizierter, wenn man sich von dem, was nach Meinung der Leute nicht verglichen werden sollte, dem zuwendet, was ihrer Ansicht nach nicht verglichen werden kann: Dumonts Verständnis der ersten Prämisse der Moderne zum Beispiel. »Alle Menschen sind gleich, weil sie alle einzigartige Individuen sind.« Unsere Individualität macht uns inkommensurabel, daher letztlich äquivalent. Aber selbst im Fall der Inkommensurabilität gibt es Abstufungen: Auch Hunde sind einzigartige Individuen, aber nur wenige Leute werden deshalb davon ausgehen, dass sie wie unseresgleichen sind. Wieder verleiht eine grundsätzliche Ähnlichkeit (»Menschsein«) der Inkommensurabilität ihre Bedeutung. Damit stehen wir erneut vor einem Paradox, dem wir in diesem Buch schon häufiger begegnet sind: Wie kann ein Ding einzigartiger sein als ein anderes? Man sollte doch meinen, dass das ein Widerspruch in sich ist. Aber mittlerweile dürfte klar geworden sein, dass viele Wertsysteme auf genau dieser Unterscheidung beruhen. Um auf Menschen und Hunde zurückzukommen: Die meisten Amerikaner, so mein Eindruck, übertragen eine solche Annahme auf den Wert verschiedener Arten von Lebewesen. Jedes einzelne Tier - oder Pflanze - gilt als einzigartig, aber bestimmte Arten werden eindeutig für einzigartiger als andere gehalten: Menschen misst man mehr Individualität zu als Hunden, Hunden mehr als Rindern, Rindern mehr als Fischen, Fischen mehr als Kakerlaken und so fort.183 Je einzigartiger ein einzelner Repräsentant seiner Gattung ist, desto verwerflicher ist es wiederum, ihn zu töten. Daher darf man Katzen nicht leichtfertig umbringen; Fische dagegen können straflos geschlachtet werden; Kakerlaken zu töten, kann wiederum zu einem moralischen Imperativ werden. Bei Kunstwerken werden einer ähnlichen logischen Ordnung folgende Unterscheidungen getroffen, denn auch wenn alle schönen Bilder einzigartig in ihrer Schönheit sind, heißt das nicht, man könnte nicht behaupten, dass manche Bilder schöner sind als andere. Ich schweife hier keineswegs ab. Wenn man verstehen will, wie ein beliebiges Wertsystem funktioniert, muss man sich ansehen, was innerhalb dieses Systems nicht gemessen und verglichen werden soll und was nicht gemessen und verglichen werden kann. Im Falle einer Schenkökonomie kann die in kommunistischen Beziehungen herrschende Ablehnung, genau nachzuverfolgen, was gegeben und genommen wird, als Beispiel für Ersteres gelten. Ein Beispiel für Letzteres ist die Betonung von einzigartigen Wertgegenständen in einem ausgeglichenen Gabentausch. Wie wir gesehen haben, werden solche Dinge oft nach dem Grad ihrer Inkommensurabilität in eine Rangfolge gebracht. Aber offensichtlich nicht immer, wie im Fall von Wampum oder Kupferplatten oder der Walzähne bei den Fidschi. Der Einfachheit halber wollen wir uns ein System vorstellen, in dem der Grad an Inkommensurabilität das einzige Kriterium für die Rangfolge wäre (oder ein Kula- System, wie es Nancy Munn beschrieb, das dem relativ nahekommt). Auf der untersten Ebene steht Gekochtes. Es wäre zwar relativ einfach, nachzuverfolgen, wer wem die größte Portion gekochte
- Yams gegeben hat; aber das wird niemand tun, es sei denn, er ist besonders knausrig oder missgünstig. Dagegen wäre es unmöglich, die Vorzüge von zwei berühmten Kula-Schmuckstü-cken zu vergleichen oder den eines solchen Schmuckstücks und eines ebenso berühmten Grünsteinbeils. Daher ist es bei einem streng ausgeglichenen Tausch richtig, das eine für das andere zu geben. So etwas scheint in fast allen marktfreien Gesellschaften vorzukommen: Zumindest kann man hier meistens eine Unterscheidung zwischen einer Sphäre des Alltagskonsums ausmachen, die oft durch ein Ethos freigiebiger Gastfreundschaft geprägt ist,184 und einer »Prestige-Sphäre«, die sich durch sorgfältige Buchführung auszeichnet. Dafür sind die Maori ein gutes Beispiel. Betrachtet man die Dinge auf diese Weise, kommt man zu einigen interessanten Resultaten, insbesondere wenn man, wie Munn, solche Sphären als Sphären menschlichen Handelns ansieht. Gerade in den höheren Sphären wird die Rolle des Akteurs äugen- scheinlich immer unklarer. Im ersten Fall, beim Alltagskonsum, geht es eindeutig um das Tun: Wer mehr gegeben hat, wird nicht verglichen. Im zweiten Fall, in der Prestige-Sphäre, verschiebt sich die Inkommensurabilität ganz auf das Objekt. Das liegt zum Teil natürlich daran, dass das Objekt zur Verkörperung einer Geschichte der Handlungen anderer wird, die sich für gewöhnlich bis in eine ferne Urvergangenheit zurück erstreckt. Welche Gründe es auch haben mag, man kann sagen, je weiter man sich auf der Skala nach oben bewegt, desto stärker werden die Ursprünge des Werts mystifiziert und als innere Eigenschaft des Objekts selbst betrachtet. Diese Mystifizierung findet allerdings nur in einem außerordentlich begrenzten Umfang statt. Mauss hat hier eindeutig übertrieben: Normalerweise sprach man den Kwakiutl-Kupferplatten, Kula-Armreifen, Maori- Kriegskeulen und Ähnlichem kein eigenes Sinnen und Trachten zu. Mit sehr viel größerer Wahrscheinlichkeit stößt man auf den Seiten des Wall Street Journal auf eklatante Subjekt/Objekt- Vertauschungen - wo Geld ständig von einem Markt zum anderen flieht, Bonds dieses tun und Schweinebäuche jenes - als in den Berichten Beteiligter über die Vorgänge in Schenkökonomien. In solchen Gesellschaften wird viel mystifiziert, aber das findet größtenteils an anderen Stellen statt. Zusammenfassung und Ausblick Eine Gabe zu geben heißt, etwas abzutreten, ohne unmittelbar etwas zurückzubekommen und auch ohne eine Garantie zu erhalten, dass es jemals geschieht. Diese Definition findet sich bei MAUSS,185 und viel besser lässt es sich auch kaum ausdrücken. Sie macht deutlich, dass der Begriff der Gabe auf eine enorme Bandbreite von Transaktionen angewendet werden kann und der Begriff der »Schenkökonomie« auf alle nicht nach Marktprinzipien organisierten Ökonomien. Dieses Kapitel soll unter anderem einen Eindruck vermitteln, wie unterschiedlich solche Ökonomien aussehen können. Ohne eine erschöpfende Typologie von Gaben auszuarbeiten, habe ich versucht, mithilfe von Mauss' Thesen ein mögliches Gerüst dafür zu entwickeln. Der Begriff der »totalen Leistung« ist dafür ein guter Ausgangspunkt, wenn man bereit ist, ihn in seine konstitutiven Elemente zu zerlegen. Dazu müssen zeitlose Beziehungen von unabgeschlossener, kommunistischer Reziprozität, ob bei Gruppen wie Moieties oder Stämmen, Mitgliedern einer Familie oder einem Verbund von Individuen (wie in Mauss' »individualistischem Kommunismus«), von solchen mit ausgeglichenem Gabentausch unterschieden werden. Erstere können in Patronage und Ausbeutung übergehen (wobei es sowohl für den Beobachter als auch für den Akteur oft schwer zu sagen ist, wann der Übergang vollzogen ist), während Letztere leicht zu einem regelrechten Wettbewerb ausarten können - meistens solche Überbietungswett-bewerbe, die Mauss »Potlatsch« nannte, aber die man vielleicht besser »agonistischer Tausch« nennen sollte. Stehen dabei eher die Objekte im Blickpunkt, kann ein solcher Wettbewerb in eine Form von Austausch übergehen, der immer mehr einem Tauschhandel gleicht. Als Handlungsstrukturen haben Erstere mit dem Erhalt des Werts von zeitloser menschlicher Verpflichtung zu tun, Letztere mit dem von ephemererer Autonomie. Beides sind Formen des reziproken Tauschs - der hier definiert wird als Tausch, bei dem beide Parteien im Verhältnis zueinander auf äquivalente Weise handeln oder handeln wollen.186 In Beziehungen angenommener Ungleichheit wird auch keine Reziprozität angenommen. Alain Testart führt das schlagende Beispiel an,187 dass ein Bettler, dem man einen Dollar gibt, nicht dazu verleitet ist, einem seinerseits einen Dollar anzubieten, wenn man ihm erneut begegnet; im
- Gegenteil, mit ziemlicher Sicherheit wird er eher versucht sein, einen erneut um einen Dollar anzugehen. Dem liegt vermutlich eine ähnliche Logik zugrunde wie dem Fall, dass ein Star einem Fan ein Autogramm gibt oder ein Kwakiutl-Häuptling einen Potlatch veranstaltet: Die Bereitschaft des Empfängers, ein solches Objekt anzunehmen, entspricht einem Akt der Anerkennung. Das gleicht im Kleinen der Schaffung von Personen, die zumeist auf der Annahme beruht, dass innere Eigenschaften (Talent, Großzügigkeit, Anstand etc.) nur in den Augen anderer zutage treten können. Das nun aber als eine Art von »Reziprozität« zu bezeichnen - oder auch nur davon auszugehen, dass der Wunsch nach Anerkennung das einzige signifikante Motiv seitens des Gebers ist ist gleichermaßen absurd. Damit würde man nur wieder zirkuläre ökonomistische Spielchen spielen. Annette Weiner und Maurice Godelier188 meinen, dass Mauss einen Fehler machte, als er den Tausch so sehr in den Mittelpunkt rückte. Die wertvollsten Besitztümer einer Gesellschaft oder Gruppe sind ihnen zufolge normalerweise jene, die nicht weggegeben werden; es gibt immer Heiligtümer und sie sind der wahre Ursprung der Kraft eben der Objekte, die in den kompetitiven Tausch eingebracht werden. Dahinter steht eine Frage, die von erstaunlich vielen der hier behandelten Autoren formuliert wird: Wie lässt sich eine niedere Sphäre der Selbstüberhöhung mit einer höheren Sphäre der in einer Gesellschaft herrschenden ewigen Wahrheiten in Einklang bringen?189 Ich will meine Position in diesem Punkt deutlich machen. Zweifellos gibt es in jeder menschlichen Gesellschaft viele Situationen, in denen man einen Konflikt zwischen individuellen Belangen und einer wie auch immer definierten höheren Autorität oder dem Wohl der Allgemeinheit ausmachen kann. Aber dieses Argument sollte man auch nicht zu weit treiben, denn sonst tut man meines Erachtens genau das, wovor Mauss gewarnt hat: Unsere eigenen Annahmen über individuellen Eigennutz anderen unterstellen, die sie womöglich gar nicht teilen. Jedenfalls ist klar, dass weder bei den Maori noch bei den Kwakiutl die Hauptobjekte des Tauschs in irgendeinem Sinne subsidiäre Versionen der Heiligtümer waren, die von den Familien bewahrt wurden. Vielmehr haben wir äußerst komplexe Transfersysteme kennengelernt, in denen die Dimensionen von »Gruppen« selten genau umrissen sind und Entwürfe zur kosmischen Reproduktion in ihrem Wesen derart untrennbar mit strategischen Spielen der Selbstüberhöhung zusammenhängen, wie Mauss vorhergesagt hätte, dass man beides kaum entwirren kann. An diesem Punkt angelangt will ich mich noch einmal den politischen und moralischen Implikationen des Werks von Mauss zuwenden. Doch als Erstes eine Warnung: Es besteht die Gefahr einer allzu großen Vereinfachung, insbesondere ist man versucht, »die Gabe« als menschenwürdiges Gegengewicht zu der Unper-sönlichkeit und der sozialen Isolation in der modernen kapitalistischen Gesellschaft zu romantisieren. Gelegentlich passiert nämlich genau das Gegenteil. Dazu ein bekanntes Beispiel, nämlich den in Amerika unter Akademikern verbreiteten Brauch, zu einer Essenseinladung bei Freunden eine Flasche Wein mitzubringen. Genauso ist es in Amerika unter jungen Leuten aus der Mittelschicht verbreitet, dass sie sich, wenn sie von zu Hause ausziehen, nach und nach aus gemeinschaftlichen Lebensformen in immer größere soziale Isolation begeben. In einem Studentenwohnheim ist es völlig normal, dass die Kommilitonen in den Zimmern der anderen ein und aus gehen; ein solches Wohnheim gleicht einem Dorf, in dem jeder mitbekommt, was der andere gerade so macht. Die Apartments in einem College sind schon wesentlich privater, aber es ist immer noch üblich, unangekündigt bei einem Freund vorbeizuschauen. Der Übergang zur normalen bürgerlichen Existenz vollzieht sich schrittweise und er vollzieht sich vor allem durch die Errichtung einer heimischen Schwelle, die irgendwann nur noch unter zeremoniellen Vorkehrungen überschritten werden kann. Wenn man es sich genau überlegt, dann gehört der mitgebrachte Wein zu diesem Ritualisierungsprozess, der Spontanität erschwert. Er ist genauso sehr eine Schranke der Geselligkeit wie deren Ausdruck. Mir geht es dabei nicht darum, ein Plädoyer für irgendeine Art von universeller communitas zu halten, und ich will mich auch nicht beschweren, dass ich nie weiß, welchen Wein ich kaufen soll. Vielmehr möchte ich dazu aufrufen, eine kritische Perspektive einzunehmen. Nimmt man Praktiken oder Institutionen gegenüber nämlich eine solche kritische Perspektive ein (wie ich es gerade getan
- habe), dann verortet man sie für gewöhnlich in einer größeren sozialen Totalität und erkennt, dass sie eine intrinsische Rolle bei der Reproduktion bestimmter Formen von Ungleichheit, Entfremdung oder Ungerechtigkeit spielen. Nicht ganz ohne Grund machen viele Marxisten Mauss zum Vorwurf, dass er das unterlassen hat. Aber darauf können die Maussianer ohne weiteres antworten, dass man, sollte die Kritik einen Zweck haben, auch imstande sein muss, einige Praktiken oder Institutionen in einer imaginären Totalität zu verorten, in der sie nicht an der Reproduktion von Ungleichheit, Entfremdung oder Ungerechtigkeit teilhaben. Solche Fragen standen Mauss' Denken (dem des Genossenschaftlers) natürlich immer nahe und darin ist er für mich am radikalsten. Mauss will uns dazu bringen - um dem Ganzen eine Hegel'sche Wendung zu geben Praktiken und Institutionen im Hinblick auf ihre Möglichkeiten zu sehen, und uns zu einem pragmatischen Optimismus zwingen. Man betrachte zum Beispiel seine eigenwillige Definition von »Kommunismus«, den er eher als eine Sache von Dispositionen und Praktiken und weniger von Besitzrechten betrachtet. Wo die Ideologen und Propagandisten, die über den öffentlichen Diskurs in diesem Land bestimmen, offenbar nie eine Gelegenheit auslassen, zu behaupten, dass etwas, was sie »Kapitalismus« nennen - meist als jedwede Form von eigennützigem finanziellen Kalkül definiert ständig und überall gegenwärtig ist (siehe die Schlagzeile: »Selbst in afrikanischen Flüchtlingslagern blüht der Kapitalismus«), geht Mauss mit seiner Definition den genau umgekehrten Weg. Sie zeigt uns, dass das Gespenst des Kommunismus nicht nur in Familien und Freundschaften lauert, sondern auch in der Organisation von kapitalistischen Großunternehmen und praktisch überall dort, wo Leute sich zu einer gemeinsamen Aufgabe zusammenfinden und Einnahmen und Ausgaben vor allem nach den Fähigkeiten und Erfordernissen der Akteure verteilt werden und weniger nach Bilanzen. Ohne eine kritische Perspektive ist dieser Verweis allerdings genauso sinnlos wie die Gewohnheit, überall »Kapitalismus« zu wittern. Selbst wenn man darin eine Art Kommunismus erkennen sollte, bleibt er innerhalb größerer Strukturen gefangen, die alles andere als egalitär sind. Aber allein die bloße Existenz solcher Praktiken und Institutionen, und auch darauf verweist Mauss, macht es innerhalb der Gesellschaft möglich, solche größeren Strukturen als ungerecht zu erkennen. Ohne dass Mauss, der damals vor allem mit Verwandtschaftsbeziehungen beschäftigt war, das ausdrücklich formulierte, kann man seine Ideen ohne weiteres auf das Argument hin erweitern, dass die konkrete Erfahrung der Arbeitsorganisation in vielen kapitalistischen Unternehmen oft genau der moralischen Grundlage des Lohnarbeitsvertrags widerspricht, auf der das Unternehmen letztlich basiert. Es sei mir ein letztes Wort zu politischen Visionen gestattet. Wer das Verständnis für die Möglichkeiten des Menschen vergrößern und andere - gerechtere, anständigere - Formen der Organisation des wirtschaftlichen und politischen Lebens sucht, wendet sich in der Hoffnung auf Anregungen und neue Ideen oft der Ethnologie zu. Es wäre schön, wenn die Ethnologen etwas bieten könnten außer der Warnung, wie berechtigt sie sein mag, dass auch in Schenkökonomien Menschen unterjocht und zugrunde gerichtet wurden. Das war jedenfalls einer meiner Leitgedanken bei dieser Analyse, und diesbezügliche Fragen hatte ich auch im Hinterkopf, als ich die Zusammenhänge, Ebenen und imaginären Totalitäten gegen Ende des dritten Kapitels und meine (damit zusammenhängenden) Überlegungen zu Wert, Inkommensurabi-lität und Gleichheit in diesem Kapitel entwickelt habe. Die meisten Ausführungen waren allerdings sehr abstrakt. Dennoch lassen sich die einzelnen Ideen in vielerlei Weise zusammensetzen, wenn man auf ihrer Grundlage eine konkretere Vorstellung entwickeln möchte, wie eine egalitärere Gesellschaft funktionieren könnte. Das halte ich auch für die richtige Vorgehensweise. Denn meiner Meinung nach brauchen wir nicht nur eine solche Vorstellung, sondern so viele unterschiedliche wie möglich. Ich hoffe, das ist ganz im Sinne von Mauss.
- Siebtes Kapitel
- Die falsche Münze unserer Träume oder das Fetischproblem
- Dieser Mensch ist z.B. nur König, weil sich andre Menschen als Untertanen zu ihm verhalten. Sie glauben umgekehrt Untertanen zu sein, weil er König ist. Karl Marx, Das Kapital1 Was mich angeht, so liebte ich von all den unzähligen wunderbaren Geschichten, welche mir Mohr erzählte, am allermeisten die Geschichte von Hans Röckle. Sie dauerte Monate und Monate; denn es war eine lange, lange Geschichte und endete nie. Hans Röckle war ein Zauberer, wie sie Hoffmann liebte, der einen Spielwarenladen hatte und viele Schulden. In seinem Laden waren die wunderbarsten Dinge: hölzerne Männer und Frauen, Riesen und Zwerge, Könige und Königinnen, Meister und Gesellen, vierfüßige Tiere und Vögel so zahlreich wie in der Arche Noah, und Tische und Stühle, Equipagen und Schachteln groß und klein. Aber ach! - trotzdem er ein Zauberer war, stak er doch stets in Geldnöten, und so mußte er sehr gegen seinen Willen alle seine hübschen Sachen - Stück für Stück - dem Teufel verkaufen. Nach vielen, vielen Abenteuern und Irrwegen kamen aber dann diese Dinge immer wieder in Hans Röckles Laden zurück. Eleanor Marx über ihren Vater2 Nachdem es bisher hauptsächlich um Wert und Tausch ging, möchte ich an dieser Stelle das im vierten Kapitel angerissene Thema wiederaufgreifen und über soziale Macht sprechen. Auch wenn es nicht als das Naheliegendste erscheint, will ich dazu einen Blick auf den Begriff des Fetischismus werfen; er ist im Verlauf dieses Buches immer mal wieder aufgetaucht, wurde bisher aber etwas stiefmütterlich behandelt. Mauss' Vorhaben, »archaische Formen des Gesellschaftsver-trags« zu untersuchen, klingt unverkennbar nach neunzehntem Jahrhundert, dennoch scheint es mir auch für das einundzwanzigste Jahrhundert noch von einiger Bedeutung zu sein. Zu Beginn dieses Buches habe ich erklärt, dass sich die Gesellschaftstheorie in einer Art Sackgasse befindet, aus der sie insofern nicht mehr herausfindet, als sie sich nicht vorstellen kann, dass die Leute in der Lage sind, die Gesellschaft bewusst zu verändern. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, besteht meiner Ansicht nach darin, soziale Systeme als Strukturen kreativen Handelns und Werts zu betrachten, d.h. sich anzusehen, welche Bedeutung die Leute ihren Handlungen innerhalb solcher Strukturen beimessen. In diesem Fall betrachtet man »Gesellschaft« zwangsläufig als eine bis zu einem gewissen Grad intentionale Angelegenheit. Selbst wenn sie kein wie auch immer geartetes kollektives Projekt verkörpert, setzt sie sich zumindest aus solchen Projekten zusammen und wirkt als deren regulatives Prinzip. Leider stellt im sozialen Denken des Abendlandes praktisch nur die Gesellschaftsvertragstheorie eine Sprache zur Verfügung, in der man auf diese Weise über Gesellschaft reden kann, und noch dazu eine ziemlich unzulängliche. Sich die Gesellschaft als Vertrag vorzustellen heißt, sie sich unter eindeutigen Marktbedingungen vorzustellen. In Anbetracht der gegenwärtig ungeheuren Macht ökonomistischer Ideologien, die uns auf jede erdenkliche Art und Weise eingehämmert werden, sind Begriffe wie »Vertrag« praktisch unbrauchbar geworden, da es kaum möglich ist, sie zu benutzen, ohne dabei an einzelne Individuen zu denken (für gewöhnlich Männer um die vierzig), die eine rationale, auf eigennützigem Kalkül basierende Übereinkunft treffen. Diejenigen, die das anders sehen, verfügen schlichtweg nicht über die Macht oder den Einfluss, um in den Köpfen der Leute andere Vorstellungen entstehen zu lassen, zumindest nicht bei so vielen, dass es ins Gewicht fallen würde. In der »Gabe« hat Mauss versucht, unser Denken über Verträge zu verändern, doch leider blieben seine Bemühungen ohne Erfolg. Damit stehen wir im Grunde ohne eine Sprache da, in der wir über einige sehr wichtige Phänomene reden könnten, was natürlich höchst bedauerlich ist. Seit Marx sind wir es gewohnt, davon zu sprechen, wie sich Gesellschaftsordnungen naturalisieren; davon, wie im Grunde willkürliche Konventionen schließlich als unabdingbare Konstituenten des Universums erscheinen. Aber was ist
- mit dem Bereich, in dem Gesellschaftsordnungen nicht naturalisiert sind? Selbst in den Gesellschaften, die in Mauss' Augen die »archaischsten« wären, gibt es stets bestimmte Übereinkünfte, deren Zustandekommen nach allgemeiner Auffassung auf gegenseitigem Einvernehmen beruht, und dort, davon bin ich überzeugt, sieht man die Gesellschaftsordnung nicht ausschließlich als etwas der kosmologischen Ordnung Inhärentes an, sondern man kann sie als Ergebnis eines beiderseitigen Einverständnisses oder einer Einigung betrachten - und sei es auch nur als eine mögliche Sichtweise von vielen. Auf jeden Fall aber nicht in der Weise, wie Hobbes oder nachfolgende Markttheoretiker es sich vorstellten. Nicht als Ansammlung von Individuen, die einzig und allein danach trachten, so viel wie möglich von den begehrten Dingen zu erwerben, und mit rationalem Kalkül zu dem Schluss kommen, dass ihnen das nur gelingen kann, wenn sie bereit sind, das Eigentum der anderen zu respektieren und sich an Geschäftsvereinbarungen zu halten. Sondern als Leute, die bereits weitreichende und dauerhafte Verpflichtungen mit anderen eingegangen sind, die etwas von gleicher Art auf eine größere Gruppe ausdehnen -was, wie Mauss vielleicht als Erster erkannt hat, tatsächlich eine Art elementaren Kommunismus einschließt, eine Übereinkunft, den Bedürfnissen und Interessen anderer Bedeutung beizumessen und entsprechend damit umzugehen. Bei den Irokesen findet man ein gutes Beispiel für das, was Mauss im Sinn hatte. Die Irokesen betrachteten Gesellschaft nicht als etwas Gegebenes, sondern als menschliche Schöpfung, eine Reihe von Übereinkünften als einzige Alternative zu einem endlosen Kreislauf zerstörerischer Gewalt. Am Anfang der Geschichte über den Ursprung des Bundes steht etwas, das dem Hobbes'schen »Krieg aller gegen alle« sehr ähnlich ist. Der Unterschied bestand darin, dass nach Ansicht der Irokesen die Drohung von Gewalt nicht daher rührte, dass die Menschen lauter Einzelwesen waren, die um knappe Ressourcen kämpften, sondern weil sie bereits Beziehungen mit anderen eingegangen waren - Beziehungen, die so eng und stark waren, dass der Tod eines geliebten Menschen zu verzweifelter, zerstöre- rischer Wut führen konnte. Eine Gesellschaft ließ sich wiederum dadurch schaffen, dass man unbegrenzte gegenseitige Verpflichtungen einging: sei es, dass man die Toten der anderen begrub oder bereit war, auf Eigentumsrechte zu verzichten, wenn sich im Traum eines anderen ein tiefes Bedürfnis offenbarte. Unter den Fünf Nationen gab es natürlich keinen Markt. Aus diesem Grund ist es interessant, die Situation in Nordamerika mit der zu vergleichen, die zur gleichen Zeit, im sechzehnten Jahrhundert, in Westafrika herrschte. Als die europäischen Kaufleute dort ankamen (zunächst auf der Suche nach Gold), trafen sie auf einen Flickenteppich von Gesellschaften, von denen die meisten nicht nur seit Jahrhunderten in größere Handelskreisläufe eingebunden waren, sondern darüber hinaus über eigene Märkte, Zahlungsmittel und Formen des eigennützigen Tausches verfügten. Der Handel mit den Neuankömmlingen wurde durch rituelle Objekte reguliert, von den Europäern als »Fetische« bezeichnet, auf die ein Schwur geleistet werden musste und die eine vertragliche Bindung zwischen Leuten schufen, die ansonsten nichts miteinander verband. Die Kräfte, die solchen Objekten zugeschrieben wurden, ähnelten Hobbes' souveräner Macht: Sie waren nicht allein Zeichen einer Übereinkunft, sie waren überdies in der Lage, die Durchsetzung dieser Übereinkünfte zu erzwingen, da sie im Wesentlichen Formen geronnener Gewalt waren. Zumeist handelte es sich um Verkörperungen von Krankheiten oder anderen Leiden, die herbeigerufen werden konnten, um jemanden zu vernichten, der seinen Verpflichtungen nicht nachkam.3 Während Wampum für das genaue Gegenteil der verheerenden Auswirkungen des Pelzhandels stand, war es hier so, als würden Macht und Abstraktion des Geldes gegen dieses selbst gewandt, eine imaginäre Gewalt, die seine schlimmsten Folgen verhindern konnte. Sucht man nach nicht vollständig naturalisierten Gesellschaftsformen, ist es daher hilfreich, sich die Mechanismen anzusehen, mit deren Hilfe kollektive Übereinkünfte erzielt werden. Das soll nicht heißen, dass es in all diesen Gesellschaften nicht auch Formen gab, die man tatsächlich als durch das Universum gegeben betrachtete oder als vor langer Zeit von Wesen geschaffen, die sich grundlegend von den Menschen unterschieden (oder zumindest von allen Menschen, die man kannte). Meistens wurde das soziale Universum dabei in verschiedene Aspekte unterteilt: Beispielsweise sahen sowohl die Irokesen als
- auch die Kwakiutl Aspekte der persönlichen Identität als in dieser Weise gegeben an, größere gesellschaftliche Arenen mussten dagegen immer wieder neu gebildet werden; die Maori scheinen das genau andersherum gesehen zu haben. Doch selbst das ist eine zu starke Vereinfachung. Was wirklich erstaunt, ist, wie oft die Leute bestimmte Institutionen - oder sogar die Gesellschaft im Ganzen - zugleich als Werk des Menschen und als durch den Kosmos gegeben betrachten, zugleich als etwas, das sie selbst geschaffen haben, und etwas, das sie eigentlich gar nicht selbst geschaffen haben können. Insofern stellt der irokesische »Träger der Erde«, der Schöpfer, der offenbar nicht imstande ist, seine schöpferischen Kräfte richtig zu begreifen, einen Versuch dar, mit diesem Paradoxon klarzukommen. Die schlagendsten Beispiele findet man allerdings in der Literatur über afrikanische »Fetische«, wobei wir hier mein Material zu madagassischen ody und sampy mit einschließen könnten, von denen bereits am Ende des vierten Kapitels kurz die Rede war und über die in der ethnologischen Literatur über Magie mehr zu finden ist - Vorstellungen von Magie, die voller Paradoxa stecken. Ich denke, wenn man die Rituale der Merina vor diesem Hintergrund betrachtet, versteht man besser, wie wenig sich die Menschen in »traditionellen« Gesellschaften von ihren politischen Institutionen hinters Licht führen lassen, in welch erstaunlichem Maß sie diese Institutionen realistisch als menschliche Schöpfungen betrachten, aber warum es oft keine besonders große Rolle spielt, dass sie das tun. Der König und die Münze Außerhalb Madagaskars ist das Merina-Ritual vor allem durch die Arbeit von Maurice Bloch bekannt, der zahlreiche Texte über Begräbnisrituale, Beschneidungszeremonien und Ritualsprache verfasst hat.4 Von ihm stammen außerdem zwei gleichermaßen bekannte Essays über das Königsritual der Merina,5 in deren Mittelpunkt das Königliche Bad steht. Blochs Fazit unterscheidet sich jedoch erheblich von dem meinen im vierten Kapitel. Hinsicht- lieh der Frage, was die Zeremonien tatsächlich über Wesen und Ursprung königlicher Macht aussagen, zieht er sogar eine gegenteilige Schlussfolgerung. Lassen Sie mich mit Blochs Aufsatz »The disconnection between power and rank as a process: an outline of the development of kingdoms in central Madagascar« aus dem Jahr 1977 beginnen. Bloch greift zunächst Louis Dumonts Beobachtungen zum indischen Kastensystem6 auf, insbesondere die strikte Unterscheidung zwischen Kaste, die Dumont zufolge im Wesentlichen eine religiöse Einrichtung ist, und der realen Ordnung von Königtümern, einschließlich Geschmacklosigkeiten und Gewalt als Folgeerscheinungen politischer Macht. Laut Bloch kann man diese Unterscheidung auch im Imerina treffen. Die frühe Monarchie im Hochland von Madagaskar entsprach im Grunde genommen einer Herrschaft von Raubrittern und die »Könige« waren eine Horde von Banditen, die sich in Bergfestungen verschanzten und die Bauern in der Umgebung schröpften. Im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert war das Imerina in mehrere solcher unbedeutenden Königreiche aufgeteilt, während zur gleichen Zeit Sklavenjäger von der Küste die ländlichen Gebiete heimsuchten und die Dorfbewohner verschleppten, um den wachsenden Bedarf an Plantagenarbeitern auf den in europäischer Hand befindlichen Inseln Mauritius und Réunion zu decken. Schon bald mischten auch die meisten einheimischen Herrscher im Sklavenhandel mit. Die offizielle Ideologie dieser Königtümer7 stand in einem auffälligen Gegensatz dazu. Die Gesellschaft erschien als ausgedehnte, vielschichtige Hierarchie, in der etwa ein Drittel der Bevölkerung als »adlig« (andriana) galt und der Rang jeder Gruppe ihrem Besitz an hasina entsprach - von Bloch als eine Art unaussprechlicher Gnade oder intrinsische Überlegenheit bezeichnet, als »Macht, Lebenskraft, Fruchtbarkeit, Leistungsfähigkeit, ja sogar Heiligkeit«.8 Hasina war etwas, das die Menschen allein aufgrund ihres Seins besaßen oder weil sie es von ihren adligen Vorfahren empfangen hatten, nicht wegen irgendwelcher Taten. Außerdem standen die Königsrituale in Einklang mit dem Naturkreislauf, und Menschen, die besonders masina waren (viel hasina besaßen), schrieb man die Fähigkeit zu, die Feldfrüchte zu segnen, so dass »Macht als unveränderliche, eng mit der Natur verbundene und nur an rechtmäßige Inhaber übertragene Wesenheit«9 erschien. Hasina war folglich eine Art inhärenter Gnade, die durch die kosmologische Ordnung an sich gegeben war. Menschen konnten sie nicht hervorbringen; tatsächlich existierte sie weitgehend
- außerhalb des Einflussbereichs irgendwelcher menschlicher Handlungen. Bestenfalls konnten die Leute hasina zeigen oder an ihre Nachkommen weitergeben - und darum ging es bei dem Königsritual in erster Linie. Man kann sich kaum einen größeren Gegensatz denken als zwischen der ideologischen zeitlosen Hierarchie und den schmutzigen Einzelheiten realer Politik, in der Mord, Erpressung und Entführung an der Tagesordnung waren. Bloch führt jedoch weiter aus, dass es für den Begriff hasina noch eine andere Verwendung gab: man bezeichnete damit große Silbermünzen (häufig Maria-Theresia-Taler, später spanische oder mexikanische Dollars), die der König als zeremoniellen Tribut erhielt. Nahezu jeder Auftritt des Königs vor seinen Untertanen begann damit, dass sie ihm »hasina gaben«. Man darf wohl annehmen, dass zwischen diesen beiden Verwendungsarten des Begriffs ein gewisser Zusammenhang bestand. Bloch stellt eine Analogie zu dem Begriff »Ehre« her. Von manchen Leuten heißt es, sie »besäßen« Ehre, sie seien ihrem Wesen nach ehrenwert. Man kann aber auch jemandem »Ehre erweisen«, indem man ihn so behandelt, als sei er ehrenwert. In der Theorie erkennt man durch die Ehrerweisung lediglich etwas an, was diese Leute bereits besitzen; in der Realität besitzen sie es natürlich nur, weil man sie dementsprechend behandelt. Genauso verhält es sich mit hasina. Hasina - im Sinne intrinsischer Überlegenheit (von Bloch als »hasina Typ I« bezeichnet) - zu besitzen ist gleichbedeutend damit, Ehre zu besitzen; das Überreichen der Münzen (hasina Typ II) ist gleichbedeutend damit, jemandem Ehre zu erweisen. Dann geht er noch einen Schritt weiter. Bei den meisten Königsritualen, so Bloch, wird ein Tausch vorgetäuscht. Wenn die Untertanen dem König hasina in Form von Münzen überreichen, revanchiert er sich beispielsweise, indem er sie mit Wasser besprengt, eine Segnung, die für Fruchtbarkeit, Wohlergehen und Gesundheit sorgen soll und die der König nur aufgrund seiner mysteriösen Heiligkeit (sein hasina Typ I) ausführen kann. Das in diesem Zusammenhang bedeutendste Ereignis war die Zeremonie des Königlichen Bades, der große Nationalfeiertag, der im Ritualkalender der Merina ganz oben stand. Hier wird dieses Schema auf das gesamte Königreich ausgedehnt. Zu Beginn des Festes müssen Kinder ihren Eltern und die Leute allgemein den in der Hierarchie unmittelbar über ihnen Stehenden hasina (oder ein ähnliches Zeichen der Ehrerbietung) überreichen; den Höhepunkt bildet eine Zeremonie, bei der Abgesandte der wichtigsten Orden und Gruppierungen des Königreichs dem König Silbermünzen überreichen. Nachdem er die Münzen entgegengenommen hat, verschwindet er hinter einem Wandschirm, badet in warmem Wasser und ruft dabei: »Möge ich masina sein«, dann taucht er wieder auf, um die Abgesandten mit dem Badewasser zu besprengen. Später baden dann auch die Eltern und besprengen ihre Kinder mit dem Wasser, womit sie den Segen über das gesamte Königreich verteilen und die Autorität des Königs weiter naturalisieren, indem eine Verbindung zur Abstammung hergestellt wird. Entscheidend ist für Bloch dabei, dass all diese Rituale dazu dienen, die tatsächliche Quelle königlicher Macht mit einem Geheimnis zu umgeben, wobei diese Macht in der Fähigkeit des Königs besteht, mit der Behauptung, diese Macht stamme aus einem Bereich jenseits menschlichen Handelns, andere dazu zu bringen, ihm Tribut zu zahlen und ihn wie einen Monarchen zu behandeln. Es geht einzig und allein darum, die Verbindung zwischen hasina Typ I und hasina Typ II zu verschleiern. Aber schon bei der ersten Lektüre des Aufsatzes als Student fand ich etwas an diesen Ausführungen ziemlich merkwürdig. Wenn sich alles darum dreht, die Verbindung zwischen den beiden Formen von hasina zu verschleiern, warum verwendet man dann die gleiche Bezeichnung dafür? Ist das nicht eher ein Wink mit dem Zaunpfahl? Als ich dann in Madagaskar lebte und die Möglichkeit hatte, aus erster Hand Wissen über die heutige Ritualsprache der Merina zu sammeln, fiel es mir immer schwerer zu glauben, das sich durch die Verwendung des Begriffs hasina irgendetwas hätte verschleiern lassen. Zugegeben, ich betrieb meine Feldforschung fast hundert Jahre nach der Abschaffung der Monarchie, aber ich habe niemals gehört, dass mit dem Begriff hasina eine Vorstellung von intrinsischer hierarchischer Überlegenheit vermittelt werden sollte. Hasina bedeutet noch immer die Macht, sich bei Handlun- gen unsichtbarer oder nicht wahrnehmbarer Mittel zu bedienen, das Verb manasina (hasina geben, etwas masina machen), das im neunzehnten Jahrhundert für das Überreichen der Münzen an einen
- König verwendet wurde, bedeutet im Grunde genommen so viel wie »ein Ritual durchführen«. Das hört man andauernd. Meistens in einem Zusammenhang, den man als Konsekration bezeichnen könnte: Zum Beispiel brachte man einem bestimmten Baum ein Opfer dar oder auch einem Gewässer, wo nach allgemeiner Überzeugung ein vergessener Geist hauste, oder dem Grab eines früheren Königs. Damit wollte man zum hasina dieser Orte beitragen und zugleich die auf diese Weise geschaffene oder gestärkte Macht anrufen, damit sie irgendetwas bewirkte: sei es die Heilung von einer Krankheit oder die Befreiung von Unfruchtbarkeit, Reichtum oder das Bestehen einer Prüfung. Nach Auskunft der Leute, die ich kennenlernte, wurde hasina immer durch menschliche Handlungen erzeugt. Außerdem musste für seinen Erhalt gesorgt werden. Erkundigte ich mich zum Beispiel nach einem bestimmten Stein, der einst als Opferstätte benutzt worden war, oder einem Baum, der die Felder eines Dorfs vor Hagel schützte, erklärte man mir oft, früher sei besagter Stein oder Baum sehr masina gewesen, weil ihm vor langer Zeit bei Ritualen hasina verliehen worden sei, allerdings hätte man die Rituale schon lange nicht mehr durchgeführt, deshalb könne man nicht sicher sein, ob noch etwas davon übrig sei. Andererseits waren solche Gegenstände oft mit einem Tabu belegt, und allein die Einhaltung dieser Tabus konnte im weitesten Sinn »hasina verleihen«, vielleicht reichte es also schon, die Kraft dieser Dinge anzuerkennen, um sie zu erhalten. Durch manasina erzeugte man auch ody, das madagassische Pendant zu »Fetischen« oder »Amuletten«, von denen ich im vierten Kapitel bereits gesprochen habe. Amulette besitzen ebenfalls hasina, aber auch sie nur deshalb, weil die Leute es ihnen verleihen, indem sie bestimmte Gegenstände (Holzstücke, Perlen, Silberschmuck usw.) und einen namenlosen, unsichtbaren Geist miteinander verbinden. Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, ist es genau diese Uneindeutigkeit, die Geister zu reinen, abstrakten Verkörperungen von Kraft werden lässt. Aber letzten Endes sind es immer menschliche Handlungen, die ody mächtig machen. Im neunzehnten Jahrhundert konnte dies durch Weihegaben erfolgen: Man weihte den unsichtbaren Mächten irgendein kleines materielles Symbol, das für die Handlung stand, die man von ihnen erflehte, und anschließend bewahrte man es als Verkörperung ihrer Kraft an einem verborgenen Ort auf, damit diese Handlung regelmäßig ausgeführt wurde. Das war vielleicht nicht die gebräuchlichste Methode, ody zu erzeugen, aber man begegnete ihr immer wieder, und sie ist deshalb von Bedeutung, weil sie ganz genau der rituellen Übergabe von hasina an den König entspricht: Auf dem Höhepunkt der Zeremonie des Königlichen Bades, nachdem er von allen Münzen erhalten hat, verschwindet der König hinter einem Wandschirm, sagt: »Möge ich manasina sein«, und tritt dann wieder hervor, um die versammelte Menge mit dem Badewasser zu besprengen. Wann immer diese intakten Münzen als Teil eines Talismans auftauchten - was gelegentlich der Fall war standen sie für eine intakte Totalität. Als Opfergaben stehen sie für den Wunsch, etwas intakt zu erhalten, das andernfalls zerbrechen und sich in unzählige winzige Teile auflösen könnte; als Teil eines Talismans stehen sie für die Macht, es zu erhalten. Nach dieser Logik steht die Überreichung einer intakten Münze für den Wunsch des Volkes, das Königreich zu vereinen, aus den einzelnen Individuen und Gruppen, aus denen es besteht, ein Ganzes zu machen - sie zeugt von dem Wunsch der versammelten Untertanen, genau das zu werden, durch die Macht des Königs vereinte Untertanen. Danach verbirgt sich der König und besprengt, aufs Neue mit hasina versehen, alle Anwesenden mit Wasser, was ebenfalls ziemlich genau dem entspricht, was man mit den wichtigsten Talismanen, den sogenannten sampy macht - man »badet« sie in Wasser und besprengt damit dann die Leute, die sie beschützen sollen. So wird der König praktisch zum Talisman, ein Gegenstand mit der Macht, die Einheit des Königreichs zu erhalten. Diese sampy waren nebenbei bemerkt sehr wichtige odyf die eigene Namen und Persönlichkeiten besaßen und für den Schutz ganzer gesellschaftlicher Gruppen sorgten. Das Königreich der Merina beispielsweise wurde von einer Art Pantheon aus königlichen sampy beschützt, gelegentlich als »königliche Palladien«10 bezeichnet, von denen jedes über eine Priesterschaft von Wäch- tern verfügte. Auch sie wurden bei rituellen Anlässen hervorgeholt und dem Volk gezeigt, erhielten hasina, wurden außer Sichtweite gebadet und anschließend erschienen ihre Wächter - manchmal auch der König höchstpersönlich um die Menge mit dem Wasser zu besprengen. Bei der Zeremonie
- des Königlichen Bades spielte der König also in buchstäblichem Sinne die Rolle eines magischen Talismans. Von Blochs These ist inzwischen nicht mehr viel übrig. Hasina bezieht sich nicht auf eine intrinsische Überlegenheit, sondern ist einfach eine Form von Macht.11 Hasina ist dem Wesen der Welt nicht inhärent, sondern wird von Menschen erzeugt. Durch die Überreichung intakter Münzen erzeugen Repräsentanten des Königtums die Macht, die sie als Königtum vereint, sie führen eine gemeinsame Handlung aus, die sie (als Untertanen) und gleichzeitig den König (als König) erschafft. Und das wurde nicht nur stillschweigend durch den Ablauf des Rituals impliziert, die Merina des neunzehnten Jahrhunderts waren offenbar sehr wohl in der Lage, es in bestimmten Zusammenhängen explizit zu formulieren; es gab beispielsweise ein Sprichwort, dem zufolge ein König erst durch die Übergabe von Münzen zum König wurde.12 Damit wären wir wieder bei den Gesellschaftsverträgen. Das Fazit scheint zu lauten: Königsherrschaft entsteht aus einem allgemeinen Konsens. Dieser Konsens muss unablässig bestätigt werden; die Zeremonie zur Erschaffung des Königs muss immer und immer wieder vollzogen werden. Auch hier zeigt sich eine interessante Parallele zu Talismanen. Zumindest einer missionarischen Quelle zufolge glaubte man, dass wichtige ody - vermutlich dachte der Verfasser dabei an diejenigen, die Familien oder größere Gruppen beschützten - durch einen »Treueschwur« geweiht werden müssten, bevor sie über irgendeine Form von Kraft verfügten. »Bevor die Weihe stattgefunden hatte und der Treueschwur geleistet war, war der Talisman, auch wenn er bereits seine endgültige Form und alle sonstigen allgemeinen Merkmale besaß, für sie nichts weiter als ein Stück Holz.«13 Seine Handlungsmacht hing also ebenfalls von einer Art allgemeinem Konsens ab, zumindest bei den Leuten, die er beschützte. Und auch für den Erhalt dieses Konsenses musste man sorgen, indem man ständig »hasina gab«, was im Fall eines Talismans alles bedeuten konnte, ange- fangen damit, dass man ihn mit Honig und Rizinusöl einrieb, bis zur Opferung eines Schafs oder auch einfach nur die Einhaltung bestimmter Tabus. Zumindest scheint immer eine gewisse Vorstellung von Übereinkunft zu existieren und darüber hinaus ein Bewusstsein dafür, dass diese Übereinkunft in erster Linie durch die Macht von Worten zustande gekommen ist - wobei das verbindende Element darin besteht, dass überzeugende Worte wiederum als masina bezeichnet werden können. Der madagassische Begriff, den man in diesem Zusammenhang verwenden würde, ist fanekana, womit entweder »eine Übereinkunft« gemeint sein kann, im Sinne eines Vertrags oder einer Abmachung zwischen zwei oder mehr Parteien, oder der etwas weniger konkrete Zustand eines gemeinsamen Konsenses; in jedem Fall bedeutet es jedoch, dass man gegenseitige Verpflichtungen eingeht oder aufrechterhält, ähnlich denen, wie sie normalerweise innerhalb einer Familie bestehen, nur dass die Beteiligten hier nicht miteinander verwandt sind. Wenn eine solche Übereinkunft getroffen wird, bedeutet das für gewöhnlich zumindest implizit, dass zugleich eine unsichtbare Gewalt geschaffen wird, die sie durchsetzen kann (so wie Ahnen ihre Nachkommen bestrafen, wenn sie ihre wechselseitigen Verpflichtungen nicht erfüllen). Genauso wurde der König gesehen: Ein Großteil seiner Macht bestand darin, dass er aufsehenerregende Strafen verhängen konnte. Auch wurde die Verbindung zwischen der Übergabe von hasina an den König und gewöhnlichen Verträgen nicht allein sprachlich hergestellt. Sie war ziemlich konkret. Wann immer im neunzehnten Jahrhundert im Merina-Königreich jemand einen Vertrag abschloss, sei es nun, dass eine Gemeinschaft Bewässerungsvorschriften zustimmte oder sich zwei Parteien in einem Erbstreit einigten, machte man das Ganze dadurch offiziell, dass man dem Souverän hasina gab.14 Beim Lesen von Aufzeichnungen aus dem neunzehnten Jahrhundert wird rasch klar, dass die Macht des Königs auf diese Weise bis in den Alltag der Leute hinein reichte: durch Gesten, die dazu dienten, die Macht des Königs zur Durchsetzung von Vereinbarungen in jeder Hinsicht aufrechtzuerhalten. Zurück auf Anfang Man könnte an dieser Stelle also einfach die Schlussfolgerung ziehen, dass Bloch sich geirrt hat, und es dabei bewenden lassen. Jedenfalls habe ich das zunächst getan. Dann nahm ich mir noch einmal die Quellen aus dem neunzehnten Jahrhundert vor, auf die Bloch sich hauptsächlich gestützt hatte,15 und fand tatsächlich einige Aussagen, die hasina als quasi-natürliche Macht erscheinen
- lassen, an Fruchtbarkeit gebunden, von königlichen Vorfahren an ihre Nachkommen vererbt, häufig im Besitz bestimmter Gruppen und auch sonst weitgehend Blochs Beschreibung entsprechend. Das trifft insbesondere auf Aussagen in offiziellen Chroniken zu und auf solche zum Ablauf der Königsrituale selbst. Damit wurde es kompliziert. Es bedeutet, dass die Königsrituale zwei völlig entgegengesetzte Dinge aussagten. Auf ganz explizite Weise sagten sie, dass königliche Macht durch das Universum gegeben ist; gleichzeitig scheint der Ablauf des Rituals jedoch zu besagen, dass Könige nur deshalb über Macht verfügen, weil die Leute das so wollen. Wie soll man das verstehen? Wenn Königsrituale dem Zweck dienen, Machtverhältnisse zu naturalisieren, warum wird diese Botschaft dann gleichzeitig untergraben? Und noch merkwürdiger: Warum scheint das nicht die geringste Rolle zu spielen? Wenn wir die verborgene Botschaft einmal als eine Art subtiler interner Kritik an der Monarchie betrachten - was einige zweifellos tun würden -, dann war sie offensichtlich nicht besonders wirkungsvoll, da diese Rituale eine entscheidende Rolle bei der Konstituierung ebenjenes Objekts spielten, gegen das sich die Kritik richten würde. Andererseits, wenn die Vorstellung, dass Könige eine Verkörperung des Volkswillens sind, ihrer Autorität nicht weiter schadet, warum sagt man es dann nicht geradeheraus? Weil es während der Zeremonie nie geradeheraus gesagt wurde. Und wenn es selbstverständlich wäre, würde man auch kein Sprichwort wie »Es ist die Münze, die den König zum König macht« brauchen. Stattdessen haben wir es offenbar mit einem Ritual zu tun, das eine Behauptung aufstellt und sie sofort wieder zurücknimmt, fast so, als würde man erst erklären, Könige seien göttliche, vom Himmel herabgestiegene Wesen, und dann hinzufügen: »Aber natürlich nicht richtig - was sie eigentlich zu Königen macht, ist der Umstand, dass sie uns dazu bringen, bei diesem Unfug mitzuspielen.« (Ich habe dieses Beispiel gewählt, weil ein anderes madagassisches Sprichwort besagt: »Kein König ist wirklich vom Himmel herabgestiegen.«) Wenn sich jemand ein solches Ritual ausdenken würde, würde man sagen, er hat zu viel Phantasie. Aber das hat natürlich niemand getan. Das Königszeremoniell der Merina bestand, wie Bloch selbst betont, aus allen möglichen woanders entliehenen Elementen; es war zusammengeflickt aus Bruchstücken ritueller Praktiken, in die bereits bestimmte Vorstellungen von Macht eingeschrieben waren. Das erklärt zum großen Teil auch die Unterschiede zwischen Blochs Untersuchung und meiner. Bloch hat sich in seiner ethnographischen Arbeit weitgehend auf an Verwandtschaftsverhältnisse und Abstammung gebundene Rituale konzentriert: Beschneidungszeremonien, Ahnenkulte, Grabwachen. Tatsächlich sind dies die einzigen Rituale, die nicht als manasina bezeichnet werden. Blochs besonderes Interesse richtet sich darauf, inwiefern diese Rituale ein bestimmtes Bild zeitloser, unwandelbarer Autorität erzeugen; genauer gesagt definiert er Verwandtschaft selbst als »eine Möglichkeit, die Beziehungen zwischen Menschen als durch Geschlecht und Elternschaft geschaffene Bande zu betrachten, so dass die solcherart dargestellten sozialen Bindungen den Beteiligten als natürlich, unvermeidlich und unveränderlich erscheinen«.16 Manch einer würde zweifellos hinzufügen, dass es bei Verwandtschaft auch noch um andere Dinge geht, aber es stimmt schon, wenn man das Königsritual auf Analogien hin untersucht, wird man genau hier fündig, was die Darstellung von hasina als unwandelbar, natürlich und so weiter betrifft. Ich dagegen interessierte mich für das, was sich allgemeiner als »magische Praxis« beschreiben ließe, bei der es allein darum geht, dass Menschen hasina erzeugen, und die in gewisser Hinsicht Verwandtschaft entgegenzustehen scheint. Daher ist es kaum verwunderlich, dass das Königsritual etwas ganz anderes zu besagen scheint, wenn es sich auf diese Tradition bezieht. Nun könnte man natürlich einwenden, dass das nicht das Geringste zu einer Klärung beiträgt, weil die eigentliche Frage ja lautet, warum das Königsritual überhaupt auf zwei so gegensätz- liehe Traditionen zurückgreifen sollte. Das ist zweifellos richtig, dennoch halte ich die Unterscheidung zwischen diesen beiden Formen ritueller Praxis für einen vielversprechenden Ausgangspunkt. Was mich während meiner Arbeit wirklich erstaunte, um ein Beispiel zu nennen, war der Umstand, dass Bloch in all seinen Schriften kaum etwas zu Talismanen und Medizin zu sagen hat -alles, was man im weitesten Sinn als »Magie« bezeichnen würde. Vielleicht ist das aber gar nicht so
- verwunderlich, da auch keiner der anderen Ethnologen, die sich mit Madagaskar beschäftigten, sehr viel zu diesem Thema zu sagen hatte (die Literatur über madagassische Magie stammt fast ausschließlich aus der Feder von Missionaren und Kolonialbeamten). Was Bloch betrifft, ist es jedoch praktisch der einzige Aspekt des Merina-Rituals, über den er nicht spricht. Ich kam schließlich zu dem Schluss, es läge daran, dass Bloch in seinen Arbeiten der marxistischen Tradition folgt. Marxistische Ethnologen hatten seit jeher ihre Schwierigkeiten mit Magie. Im Gegensatz zur Religion: Dazu hatte die marxistische Theorie, angefangen bei Marx selbst, immer sehr viel zu sagen. Ich halte das für ein interessantes Phänomen. Was ist der Grund dafür? Und wie könnte eine marxistische Theorie der Magie aussehen? Magie und Marxismus Marx setzte sich in seinen frühen Arbeiten - insbesondere in seinen Erwiderungen auf andere Junghegelianer wie Feuerbach und Stirner - häufig mit Religion auseinander. Man könnte sogar sagen, dass es bei seinen Arbeiten über Ideologie hauptsächlich darum ging, für eine Religionskritik entwickelte Begriffe auf den ökonomischen Bereich anzuwenden. Fetischismus ist dabei nur einer der bekannteren dieser Begriffe. Die Logik hinter Marx' Religionskritik war entscheidend für sein Denken über die menschliche Existenz im Allgemeinen. Um eine bekannte These zu wiederholen: Menschen sind Schöpfer. Die soziale (und in einem hohen Maß sogar die natürliche) Welt, in der wir leben, ist etwas, das wir gemacht haben und ständig neu machen. Unser Problem besteht darin, dass wir das selbst nicht ganz durchschauen und diesen Vorgang deshalb auch nicht kontrollieren können, sondern meistens glauben, dass wir von unseren Schöpfungen kontrolliert werden. Insofern wird Religion zum Prototyp aller Formen von Entfremdung, denn sie beinhaltet, dass wir unsere schöpferischen Fähigkeiten nach außen auf Wesen übertragen, die allein der Phantasie entsprungen sind, und uns dann vor ihnen niederwerfen und um Gefälligkeiten bitten. Und so weiter. All das dürfte inzwischen hinlänglich bekannt sein, aber vor diesem Hintergrund versteht man leichter, warum Magie ein solches Problem ist. Werfen wir einen Blick darauf, wie die frühe Ethnologie (Tylor, Frazer u.a.) den Unterschied zwischen Magie und Religion definierte. Für Tyler war Religion eine Glaubenssache (»der Glaube an übernatürliche Wesen«), Magie dagegen waren Praktiken. Es ging darum, etwas zu tun, das eine unmittelbare Wirkung auf die Welt haben sollte, dazu gehörte aber nicht unbedingt die Anrufung irgendeiner vermittelnden Macht. Mit anderen Worten, Magie muss nicht zwangsläufig irgendwelche fetischi-sierten Projektionen einschließen. Frazer wird in dieser Hinsicht noch deutlicher, wenn er darauf beharrt, dass Magie ihre Wirkung »automatisch« entfaltet; selbst wenn ein Magier beispielsweise einen Gott oder einen Dämon anruft, sperrt er diesen für gewöhnlich in ein Pentagramm und kommandiert ihn herum, statt Gefälligkeiten von ihm zu erbitten. Bei Magie geht es demnach darum, die eigenen Absichten zu verwirklichen (wie immer diese auch aussehen mögen), indem man auf die Welt einwirkt. Es geht nicht darum, dass die Absichten und kreativen Fähigkeiten der Leute nach außen auf die Welt projiziert werden und ihnen in seltsamen, entfremdeten Formen erscheinen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Mit anderen Worten: Wenn Religion die Methode ist, (imaginäre) menschliche Persönlichkeiten und Absichten auf (reale) Naturkräfte zu übertragen, dann müsste es sich bei Magie darum handeln, reale menschliche Persönlichkeiten und Absichten mit imaginären Naturkräften auszustatten. Das ist nicht im herkömmlichen Sinn fetischistisch. Vielmehr geht es darum, dass Menschen die Welt aktiv gestalten und sich dabei dessen bewusst sind, was sie tun. Die übliche marxistische Kritik greift hier nicht. Andererseits neigen Magier aber auch dazu, alle möglichen Behauptungen aufzustellen, die ganz offensichtlich falsch sind und zumindest in bestimmten Bereichen zur Stärkung ausbeuterischer Systeme der einen oder anderen Art beitragen. Etwas Derartiges können Marxisten natürlich auch nicht gutheißen. Vielleicht haben sie deshalb das Thema oft gleich ganz gemieden.17 Aber das madagassische Beispiel - und ich bin sicher, dass es noch mehr davon gibt - legt nahe,
- dass Magie genau aus diesem Grund wichtig ist. Weil es gerade diese unfetischisierte Eigenschaft ist, der Umstand, dass Magie die Quelle sozialer Kreativität im menschlichen Handeln ansiedelt und nicht außerhalb, der es ermöglicht, zu einem solchen offenbar realistischen Verständnis von Königtum zu gelangen - das genau genommen dem eines Sozialwissenschaftlers erstaunlich nahe kommt. Das ist natürlich noch keine Erklärung für die offenkundig doppelte Botschaft. Ich denke, an dieser Stelle könnte es von Nutzen sein, einen Blick auf neuere ethnologische Theorien zur Magie zu werfen. Magie und Ethnologie Im zwanzigsten Jahrhundert sahen die wenigsten Ethnologen ihre Arbeit im Kontext einer kritischen Theorie. Seit Anfang des Jahrhunderts gab sich die etablierte Ethnologie beharrlich relativistisch. Während die marxistischen Ethnologen dazu neigen, Magie dessentwegen, was sie nicht entstellt, problematisch zu finden, haben die meisten anderen da Schwierigkeiten mit ihr, wo sie es tut. Wie sich gezeigt hat, sperrt sich Magie hartnäckig gegen jede Relativierung. Für Evolutionisten ist Magie schlicht eine Sammlung von Irrtümern. Für Edward Tylor oder Sir James Frazer fielen all jene Methoden unter die Kategorie »Magie«, die nach Ansicht eines unbeteiligten Beobachters nicht funktionieren konnten. Die Aufgabe des Relativisten besteht also offenkundig darin aufzuzeigen, inwiefern magische Aussagen zutreffen. Das erwies sich jedoch als äußerst schwierig; zum einen hat es Forscher dazu veranlasst, unablässig etwas herunterzuspielen, was andernfalls wohl eines der Hauptmerkmale von Magie wäre: nämlich, dass sie fast immer mit Tricks, Effekthascherei und Skepsis verbunden zu sein scheint. Die ethnologische Literatur zu »Magie« ist nicht besonders umfangreich. Sie besteht im Wesentlichen aus den beiden umfangreichen Monographien von Edward E. Evans-Pritchard und Bronis-law Malinowski.18 Beide entstanden zu einer Zeit, als Ethnologen es zumindest noch der Mühe wert fanden, sich mit alten evolutio-nistischen Fragen zu befassen; damit hat es sich dann aber auch schon. Die Debatten zu diesem Thema - beispielsweise ein Großteil der sogenannten »Rationalitätsdebatte«, die auf Evans-Pritchards Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande folgte - wurden zumeist von Philosophen und anderen Nichtethnologen geführt. In den 1960er Jahren gaben neue linguistische Modelle den Anstoß zu einer Reihe von Essays, wobei hier die größte Bedeutung den Schriften von Stanley Tambiah19 zukommt, vor allem der von ihm konstatierten Analogie von Zaubersprüchen und performativen Sprechakten, d.h. Äußerungen (z.B. »ich entschuldige mich«), die allein dadurch, dass sie gemacht werden, etwas bewirken. Tambiahs Arbeit diente seither als Ausgangspunkt für so gut wie alle der wenigen neuen ethnologischen Schriften über Magie. Tatsächlich haben sich die Ethnologen in ihrer Mehrzahl schon lange von dem Begriff »Magie« abgewandt und ziehen es vor, Daten, die möglicherweise früher einmal darunter fielen, nach Rubriken wie Hexerei und Zauberei, Schamanismus, Heilkunst, Kosmologie und so weiter zu sortieren, von denen jede unterschiedliche Fragen und unterschiedliche Probleme nach sich zieht. Meine Ansicht nach gibt es dafür auch einen guten Grund. Als Instrument der ethnographischen Beschreibung ist der Begriff »Magie« weitgehend nutzlos. In meinen ethnographischen Untersuchungen20 habe ich mir meistens mit dem Begriff »Medizin« beholfen, als direkteste Übersetzung für das Wort, das ein Madagasse im Zusammenhang mit solchen Dingen verwenden würde. Nichtsdestoweniger ist die theoretische Debatte über Magie erhellend. Für einen Relativisten besteht das Problem darin zu zeigen, dass magische Aussagen nicht einfach falsch sind. Wenn Magier behaupten, ihre Magie habe eine soziale Wirkung, haben sie in gewisser Hinsicht zweifellos Recht. Im Allgemeinen ist es so. Sobald ihre Behauptungen darüber hinauszureichen scheinen, steht man vor einem gewaltigen Problem. Ein Beispiel: Wenn jemand sagt, er habe die Macht, Blitze auf die Köpfe seiner Feinde zu lenken, muss ein außenstehender Beobachter geradezu zwangsläufig zu dem Schluss kommen, dass er natürlich nicht dazu in der Lage ist. Die Aussage ist falsch. Entweder irrt sich der Sprecher also oder er lügt. (Die meisten Evolutionisten, einschließlich Missionare, tendierten zu einer etwas voreiligen Kombination aus beidem.) Die einzige Möglichkeit, diesem Dilemma zu entgehen, bestünde darin,
- den Begriff »Wahrheit« in Frage zu stellen: magische Aussagen, so könnte man argumentieren, sollen nicht »wahr« sein, zumindest nicht in dem wissenschaftlichen, empirisch nachweisbaren Sinn, den der Begriff für ein westliches Publikum hat. Sie sind poetisch oder rhetorisch, eher expressiv als instrumentell, illokutionär, performativ und so weiter. Vermutlich gründet Tam-biahs Ruhm vor allem darauf, dass er in seinen frühen Aufsätzen diesbezüglich eine extreme Position vertritt. Sein berühmtestes Beispiel ist eine vilamalia genannte Gartenmagie auf den Trobriand-Inseln, von der Malinowski berichtet.21 Sie soll dazu dienen, die Speicherhäuser für die Yamsknollen zu verankern, indem sie groß, prall und schwer und sowohl die Speicherhäuser als auch die Yamsknollen darin stark und widerstandsfähig gemacht werden. Als Malinowksi die Magier fragte, wie diese Magie funktioniere, lautete ihre Antwort meistens, dass sie nicht direkt auf die Nahrung oder die Speicher wirke. Vielmehr, sagten sie, wirke sie auf die Bäuche der Menschen - der Bauch gilt sowohl als Sitz des Verstandes als auch der magischer Kräfte. Diese Magie bringt die Leute dazu, ihren Hunger unter Kontrolle zu halten, so dass sie sich nicht die Bäuche mit Yams vollschlagen und die Speicher gefüllt bleiben. Daraus lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass es sich bei Magie um eine öffentliche Darbietung handelt, mit der die Leute beeinflusst werden sollen, oder, wie Tambiah schreibt, um »Geist und Empfindungen der Akteure neu zu ordnen und miteinander zu verbinden«,22 und nicht um eine irrige Methode, Dinge zu beeinflussen. Nur handelt es sich dabei leider um einen recht ungewöhnlichen Zauber. Die Trobriander verwendeten Zaubersprüche auch, um den Wind zu beherrschen oder Kanus schneller fahren zu lassen, und es scheint keinen Grund zu der Annahme zu geben, dass die Wirkung dieser Sprüche als rein rhetorisch betrachtet wurde. Aber beachten Sie die Analogie zum Königsritual der Merina. Auch hier haben wir es bei dem Ritual selbst mit Aussagen über scheinbar außergewöhnliche, naturalisierte Kräfte zu tun (dass die Macht von Königen in der Natur wurzelt, dass die Worte von Magiern die materielle Welt beeinflussen können), die dann unmittelbar darauf durch andere Aussagen untergraben werden, denen zufolge es sich nicht so verhält und es in Wirklichkeit bei alldem nur darum geht, Einfluss auf die Absichten der Menschen zu nehmen. Es ist auch bezeichnend, dass es sich bei der trobriandischen Magie selbst in erster Linie um eine öffentliche Darbietung handelt. Die Behauptung, eigentlich glaube niemand daran, dass Magie Einfluss auf die materielle Welt hat, höchstens auf andere Menschen, ist wesentlich schwerer ernst zu nehmen, wenn man es etwa mit Evans-Pritchards Material über die Zande zu tun hat oder auch mit zeremonieller Magie, wie sie im Altertum23 praktiziert wurde, wo die meisten Rituale im Geheimen stattfanden. Zum Teil hängt das davon ab, wie man »Darbietung« definiert. Wenden wir uns noch einmal dem Beispiel des Blitzschlags zu. Zu der Zeit, als ich in der Kleinstadt Arivonimamo lebte, blätterte ich während eines Besuchs in der Wohnung eines medialen Heilers namens René in einem Notizbuch mit Rezepten für ody, das sicher nicht zufällig auf dem Tisch lag. René verwies mich daraufhin auf eine Seite, die, wie er sagte, Anweisungen für einen Blitzzauber enthielt. »Sie müssen wissen, dass ich selbst so etwas nie machen würde«, sagte er. »Das ist zutiefst unmoralisch. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, habe ich es einmal gemacht. Vor vielen Jahren. Aber da wollte ich Rache an dem Mann nehmen, der meinen Vater getötet hat. Ich weiß, ich hätte das nicht tun sollen, aber ...« Er hielt inne und zuckte ergeben die Schultern. »Es war immerhin mein Vater!« Wie soll man diesen Vorfall deuten? Es war zweifellos eine Darbietung. Aber sie wurde in normaler Alltagssprache gegeben, die nach den Kriterien wahr und falsch beurteilt werden sollte. Man kann nicht sagen, die Frage, ob René tatsächlich jemanden mit einem Blitzschlag bestraft hatte oder nicht, sei »unangemessen«. Dann muss man sich aber tatsächlich zwischen Irrtum und Lüge entscheiden. Mir kommt es hier jedoch in erster Linie auf die Feststellung an, dass praktisch jeder Madagasse, dem ich von diesem Vorfall erzählte, diese Entscheidung ohne zu zögern traf. Offensichtlich log René. (Wenn man wirklich über solche furchteinflößenden Kräfte verfügt, gibt man damit nicht vor Fremden an.) Andererseits hielten es wohl die meisten nicht für ganz ausgeschlossen, dass er tatsächlich wusste, wie man einen Blitz auf jemanden lenkte, jedenfalls genügte es, um es sich zweimal zu überlegen, bevor man etwas tat, was ihn richtig sauer machte,
- und das war ganz offensichtlich die eigentliche »soziale Wirkung«, die seine Darbietung haben sollte; das bedeutet wiederum, dass ihm die Leute in dem Maß nicht glaubten, wie sie annahmen, dass er mit seiner Äußerung lediglich eine soziale Wirkung bezweckte. Ethnologen nehmen diese Art von Skepsis - die Aura latenter Ungläubigkeit, die alle Phänomene zu umgeben scheint, die unter die Kategorie »Magie« fallen - nur zur Kenntnis, um sie sofort als unerheblich abzutun. Evans-Pritchard beispielsweise stellte fest, dass die meisten ihm bekannten Zande der Meinung waren, die Medizinmänner seien in der Mehrzahl Betrüger und lediglich eine Handvoll davon »vertrauenswürdige Fachleute«. »Daher sind sie nie ganz sicher, ob sie den Aussagen eines bestimmten Medizinmanns vertrauen können oder nicht.«24 Ähnliches wird fast überall über Heiler berichtet. Das Fazit ist aber jedes Mal das gleiche: Da jeder, oder fast jeder, zustimmt, dass es zumindest einige seriöse Heiler gibt, fällt die Skepsis nicht ins Gewicht. Ähnlich verhält es sich mit den Kniffen, Täuschungen und Taschenspielertricks von Zauberkünstlern wie Schamanen oder Medien (die angeblich Gegenstände aus den Körpern von Leuten saugen, bauchreden, Glas essen). Ein Klassiker zu diesem Thema ist natürlich Lévi-Strauss' Aufsatz »Der Zauberer und seine Magie« von 1971 über einen jungen Kwakiutl, der sich schamanistische Künste aneignet, um deren Anwender als Betrüger zu entlarven, zu guter Letzt jedoch selbst zu einem erfolgreichen Heiler wird. Der springende Punkt ist also, dass Heiler (um ein Beispiel zu nennen) zwar wissen, dass das, was sie tun, zumeist Bühnenzauber ist, zugleich aber glauben, dass irgendwie auch was dran sein muss, weil sie tatsächlich Menschen damit heilen. Wieder sind die Tricks ohne Bedeutung. Historisch gesehen gibt es gute Gründe dafür, warum Ethnologen diese Haltung einnehmen - im Fall von Missionaren dürfte es klar sein aber was passiert, wenn wir den Spieß umdrehen und erklären, gerade die Skepsis ist interessant? Nehmen wir einmal die Haltung gegenüber Heilern. Evans-Pritchard berichtet, dass bei Seancen der Zande keiner der Anwesenden »ganz sicher war«, ob der Heiler, dem er zusah, ein Scharlatan war oder nicht; die gleiche Erfahrung machte ich in Madagaskar. Die Leute änderten ständig ihre Meinung, was bestimmte Heiler anging. Man muss sich nur einmal überlegen, was das bedeutet. Heiler, ob echt oder nicht, sind zweifellos sehr mächtig und einflussreich. Das bedeutet, jeder, der einer Darbietung beiwohnte, war sich bewusst, dass die Kräfte der Person vor ihm möglicherweise lediglich auf seiner Fähigkeit beruhten, andere davon zu überzeugen, dass er sie besaß. Und das gewährt meiner Ansicht nach tiefe Einblicke in das Wesen sozialer Macht. Natürlich bedeutet das nicht, dass solche Möglichkeiten zwangsläufig auch irgendwie genutzt wurden. Aber man kann durchaus behaupten, dass es häufig so war. Gaunergeschichten zum Beispiel erscheinen oft als ziemlich unverblümte Betrachtungen über die Beziehung zwischen Betrug, Tricks und sozialer Kreativität. In Madagaskar stehen in diesen Geschichten entweder herumziehende Hochstapler (die sich oft als Magier ausgeben) im Mittelpunkt oder politische Figuren wie Könige, die gewaltsam die Macht an sich reißen. Oder ein Beispiel aus dem Alltagsleben: Für die meisten Leute, die ich in Madagaskar kennenlernte, war es eine Sache des gesunden Menschenverstands, dass die Medizin jemandem, der nicht richtig daran glaubte, auch nicht half. Eine der ersten Geschichten, die ich hörte, war die eines italienischen Priesters, der eine Gemeinde übernehmen sollte und an seinem ersten Tag im Land bei einer wohlhabenden madagassischen Familie eingeladen war. Mitten während des Essens verloren auf einmal alle das Bewusstsein. Wenige Minuten später kamen zwei Einbrecher durch die Tür geschlendert und ergriffen gleich darauf erschrocken die Flucht, als sie merkten, dass noch jemand wach war. Wie sich herausstellte, hatten sie im Haus ein ody versteckt, das um sechs Uhr abends alle einschlafen lassen sollte, aber da der Priester ein Ausländer war, der nicht an solchen Unfug glaubte, hatte es keine Wirkung auf ihn. Das wusste jeder. Manche Leute gingen sogar noch einen Schritt weiter und behaupteten, auch wenn jemand eine Medizin benutzte, um einem anderen zu schaden, würde sie nicht wirken, solange der Betreffende nichts davon wusste. Das erste Mal hörte ich das von verhältnismäßig gebildeten Leuten und ich hatte den starken Verdacht, dass sie mir einfach nur etwas erzählten, von dem sie dachten, dass ich es hören wollte. Immerhin beschreibt es ziemlich genau die Einstellung vieler Amerikaner: Wenn ein Zauber
- funktioniert, dann allein durch die Kraft der Suggestion. Im Lauf der Zeit lernte ich jedoch einige Astrologen und Heiler kennen, Leute, die fast keine Schulbildung hatten und ganz bestimmt keine Ahnung, was Amerikaner im Allgemeinen so dachten (einer von ihnen hielt mich sogar für einen Afrikaner), und sie erzählten mir genau das Gleiche. Und fast jeder, den man rein theoretisch dazu befragte, pflichtete bei. Für gewöhnlich folgten dann aber sofort alle möglichen Einschränkungen, ja, es stimmte, es sei denn natürlich, es handelte sich um etwas, das einem ins Essen getan wurde. Oder um einen dieser wirklich mächtigen Liebeszauber. Oder, oder ... Das Befremdliche daran ist, dass Prinzip und Praxis in krassem Widerspruch zueinander standen. Jeder pflichtete bei, aber keiner verhielt sich jemals so, als würde es auch zutreffen. Wenn man krank war, ging man zu einem Heiler. Der Heiler erklärte einem für gewöhnlich, die Ursache der Krankheit sei irgendeine Medizin, die jemand gegen einen verwendet habe, und verriet dann, wer es war und wie er es gemacht hatte. Es liegt auf der Hand, dass diese Prozedur keinen Sinn ergibt, wenn einem eine Medizin nur dann Schaden zufügen kann, sofern man weiß, dass sie jemand zu diesem Zweck benutzt hat. Theorie und Praxis sind also zwei Paar Stiefel. Aber wenn sich nie jemand so verhielt, als würde sie zutreffen, warum gab es die Theorie dann überhaupt? In gewisser Weise handelt es sich um denselben Widerspruch, mit dem wir es bereits beim Königsritual und bei Tambiahs Yams-zauber zu tun hatten, nur diesmal in einer Verkehrung. Die Leute warten zunächst mit einer Interpretation auf, wonach magische Handlungen lediglich eine soziale Wirkung haben, unmittelbar darauf fangen sie jedoch an, Einschränkungen zu machen und zu relativieren. Dennoch hat man die gleiche schiefe Beziehung zwi- sehen zwei Prämissen, die einander ganz offensichtlich widersprechen, in der Praxis jedoch voneinander abhängig zu sein scheinen. Denn wie würde die madagassische Gesellschaft aussehen, wenn sich jeder so verhielte, als würde eine Medizin nur dann wirken, wenn man an sie glaubt oder wenn man will, dass sie wirkt? Schwarze Magie - die verbreitetste Form von Magie - würde es dann einfach nicht mehr geben. Aber es gab sie ganz offensichtlich. Wie mir eine Frau ziemlich bekümmert erklärte: »Ich muss wohl daran glauben, denn seit ich hierher aufs Land gezogen bin, bin ich dauernd krank.« Vielleicht ließe sich etwas Ähnliches über das Wesen politischer Macht sagen oder zumindest über Zwangsformen wie die Organisation eines Staates. Macht ist in einem hohen Maß lediglich die Fähigkeit, andere Leute davon zu überzeugen, dass man sie besitzt (und wenn nicht das, dann besteht sie in der Fähigkeit, die Leute davon zu überzeugen, dass man sie besitzen sollte).25 Einmal abgesehen von der Frage, ob das bedeutet, dass Macht ihrem Wesen nach auf eine etwas paradoxe Weise zirkulär ist, könnte es tatsächlich eine Gesellschaft geben, in der die Leute sich so verhalten, als wären sie sich dessen bewusst? Würde das nicht bedeuten, dass es Macht selbst - zumindest in ihren hässlicheren, eindeutig schädlichen Erscheinungsformen - einfach nicht mehr geben würde, ähnlich wie schwarze Magie? Man sieht beinahe einen madagassischen Bauern früherer Zeiten vor sich, der hinsichtlich Blochs Banditen-Königen zu dem gleichen Schluss gelangt wie meine Bekannte bei der Medizin: Na ja, ich muss wohl an sie glauben; oder in diesem Fall: Sie sind wohl tatsächlich Emanationen meines Wunsches nach einer einenden Macht, die uns alle zu Angehörigen ein und desselben intakten Königtums macht, schließlich gebe ich ihnen ja weiter intakte Münzen. Magisches und religiöses Verhalten Einer der Gründe, warum Ethnologen den Begriff »Magie« nicht besonders mögen, ist der, dass er so stark mit bewusster Täuschung und Tricks assoziiert wird. Es ist kein Zufall, dass in Amerika heutzutage die meisten Leute an Männer in Fräcken denken, die Kaninchen aus Zylindern ziehen, wenn sie »Magie« hören. Mei- ner Meinung nach ist allerdings genau das das Interessante daran. Der Begriff »Magie«, insofern er noch von irgendeinem Nutzen für die Ethnologie ist, lässt sich am besten anhand zweier Merkmale definieren. Erstens ist Magie nicht inhärent fetischistisch, da sie erkennt, dass die Macht, die Welt zu verändern, letztlich auf menschliche Intentionen zurückgeht. Das heißt, selbst wenn fremde Kräfte oder unsichtbare Geister der einen oder anderen Art daran beteiligt sind, steht am Anfang jeder Handlung immer eine menschliche Intention und an ihrem Ende ein greifbares Ergebnis. Zweitens schließt Magie immer ein gewisses Maß an Skepsis ein, ein Schwanken zwischen der
- Feststellung, dass die beteiligte Macht geheimnisvoll und außergewöhnlich ist, und der Feststellung, dass es sich lediglich um »soziale Effekte« handelt, was manchmal bedeutet, sich einfach dessen bewusst zu sein, dass diese Macht eine Art Schwindel ist, ohne dass sie deshalb weniger real oder bedeutungsvoll wird. Nun könnte man vor diesem Hintergrund viele der in diesem Kapitel angeführten Beispiele noch einmal neu untersuchen. Boas* Kwakiutl-Informanten aus der Zeit der Jahrhundertwende, die ein und dasselbe Wort für »Ritual« und »Schwindel« oder »Täuschung« verwendeten, ließen in ihrem Verständnis von sozialer Macht einige höchst magische Neigungen erkennen. Gleichzeitig war der letzte Ursprung dieser Kräfte hochgradig fetischisiert. Die Maori-Quellen über verborgenes mauri schwanken zwischen einer magischen und einer theologischen Erklärung: In manchen Versionen sind die Kräfte des verborgenen Talismans die der Götter, in anderen (insbesondere bei Ranapiri) die von Priestern. In jedem Fall handelt es sich um ein entfremdetes Bild der menschlichen Kräfte, die eigentlich für die Bildung sozialer Gruppen verantwortlich sind. Dies ließe sich weiter fortsetzen. Diese Anmerkungen sollen keinen neuen Vorwand für akademische Debatten über die Frage, ob eine bestehende Praxis »magisch« oder »religiös/theologisch« ist, liefern. Man sollte diese Dinge besser als Haltungen betrachten, das heißt, die an einem Ritual Beteiligten können dazu völlig unterschiedliche Meinungen haben. Entscheidend ist, dass eine solche Haltung zumindest die Möglichkeit für etwas eröffnet, was man nur als erstaunlich realistische Denkweise über das Phänomen sozialer Macht bezeichnen kann. Ich habe bereits beschrieben, wie das im Königsritual der Merina Form annimmt und sich dabei einer magischen Praxis nähert. Allerdings war diese Haltung gegenüber Macht nicht auf Rituale beschränkt. Ein bekanntes Beispiel dafür ist König Radama I., der Anfang des neunzehnten Jahrhunderts regierte und als erster Merina-Herrscher engeren Kontakt zu Europäern pflegte. Den meisten Berichten zufolge war Radama durch und durch ein Zyniker. Zu seinen Lieblingsbeschäftigungen gehörte es, die Tricks seiner Hofmagier aufzudecken. Der Umgang mit Missionaren war ihm offenbar nicht besonders angenehm, dafür verstand er sich bestens mit Freidenkern wie dem französischen Maler Copalle, mit dem er in den meisten Dingen einer Meinung war. So erklärte er Copalle zum Beispiel, er halte Religion lediglich für eine politische Institution, und in Anbetracht seiner Entscheidung, das Königsritual aufzugeben, kaum dass er über ein modernes stehendes Heer verfügte, scheint er tatsächlich davon überzeugt gewesen zu sein. Viele ethnologische Theorien hätten Schwierigkeiten damit, allein die Existenz eines solchen Mannes zu erklären. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass dies insbesondere auf eine Richtung der ethnologischen Theorie zutrifft, die sich unmittelbar aus den Debatten über Magie herleitet: Anstoß dazu gab Evans-Pritchards Behauptung, die Azande seien nicht in der Lage, die Grundlagen ihrer Denkweise zu hinterfragen,26 und ihre extremste Form erreicht sie in einigen Thesen von Robin Horton, wonach Menschen, die an Magie glauben, in einem geschlossenen geistigen Universum voller unwiderlegbarer Aussagen leben, die niemals durch die empirische Realität in Frage gestellt werden können (anders als die Menschen im Westen natürlich, die wissenschaftlich denken und aufgeschlossen sind). Ich habe dagegen eher den Eindruck, als ob gerade jemand wie Radama aus einem von Magie bestimmten Umfeld kommt - das heißt voll von Geschichten über Wunder und Täuschungen und ständigen Spekulationen über verschiedene Formen persönlicher Macht und Manipulation, ein Umfeld, in dem die Mechanismen der Macht, die Falltüren und Spiegel, hinter den Kulissen sichtbar sind. Mir wäre daran gelegen, einen Teil der künstlichen Distanz aufzuheben, die viele ethnologische Theorien oft unabsichtlich zwischen Beobachtern und Beobachteten errichten. Ich bezweifle ernsthaft, dass es irgendwo jemanden gibt, der nicht in der Lage ist, die Grundlagen seiner Denkweise in Frage zu stellen; selbst wenn wahrscheinlich die überwältigende Mehrheit der Menschen auf dieser Welt keinen Grund sieht, warum sie das tun sollten. Wenn es denn eine Antwort auf die Frage gibt, warum das Königsritual der Merina zwei so widersprüchliche Dinge zu sagen scheint, muss sie hier zu finden sein. Man könnte sagen, dass man mit einer Aussage wie »Es ist noch kein König vom Himmel
- herabgestiegen (jedenfalls nicht so richtig)« so weit geht, wie man gehen kann, um Macht zu entfetischisieren, ohne einen Diskurs in Gang zu setzen, eine Art des Denkens und Sprechens über Macht, die nicht selbst wiederum untrennbar mit Praktiken der Macht verflochten ist - oder die zumindest versucht, sich davon fernzuhalten. Um diese machtfernen Räume zu schaffen, muss man das jedoch wollen. In der Praxis schließt das eine Art bewusstes Programm des gesellschaftlichen Wandels ein. Fehlt ein solches Programm, hat man wahrscheinlich nicht viel mehr zu erwarten als paradoxe oder zynische Bemerkungen über die Überheblichkeit der Mächtigen. Es mag irreführend sein, wenn man wie ich sagt, das Merina-Ritual komme einem unfetischisierten oder gesellschaftswissenschaftlichen Verständnis des wahren Wesens des Merina-König-tums nahe, da das so aufgefasst werden könnte, als versuche es, zu einem solchen Verständnis zu gelangen, was es natürlich nicht tut. Ein Ritual versucht nicht, über sich selbst hinaus zu gelangen. Für die Beteiligten ist es letztlich nicht besonders wichtig, ob Könige tatsächlich vom Himmel herabgestiegen sind oder nicht; was zählt, ist, dass sie es getan haben könnten. Cthulhus Baumeister Wenn ich von den Grenzen des Analysierens spreche, will ich damit nicht sagen, dass im achtzehnten oder neunzehnten Jahrhundert die Leute in Madagaskar nicht in der Lage waren, sich völlig andere politische Alternativen vorzustellen und den Versuch zu ihrer Umsetzung zu unternehmen. Es gab Revolutionen, Volksaufstände, in deren Verlauf die herrschenden Eliten gestürzt wurden. An der Westküste gibt es Gruppen wie die Vezo und die Tsimihety, denen es nicht nur gelang, sich einer Eingliederung in die Königtümer dieser Region zu widersetzen, darüber hinaus schufen sie offenbar Gesellschaftsordnungen, die praktisch als egalitäres Experiment in Opposition dazu angelegt waren. Selbst die ländlichen Merina, denen Beobachter im neunzehnten Jahrhundert bedingungslose Loyalität gegenüber der Königin bescheinigten, haben ihre Meinung über königliche Macht offenbar sofort nach der Abschaffung der Monarchie im Jahr 1896 geändert und bezeichnen diese und jede andere Form von Macht, die einigen Leuten das Recht gibt, anderen willkürliche Befehle zu erteilen, inzwischen als zutiefst unmoralisch.27 Soweit die Leute weiterhin mythischem Denken verhaftet blieben, scheint es in der Praxis keine große Rolle gespielt zu haben. Ich wollte vielmehr auf eine reflektierte Auffassung von gesellschaftlicher Realität hinaus (darauf komme ich gleich noch zurück). Jedenfalls führt es zu der ziemlich verblüffenden Schlussfolgerung, dass man sich auf der Suche nach einem nichtfetischisierten Bewusstsein in nichtwestlichen Gesellschaften am ehesten in der Umgebung von Gegenständen umsehen sollte, die man im Westen als »Fetische« bezeichnen würde. Ich vermute, einer der Gründe dafür hat mit dem Wesen revolutionären Handelns an sich zu tun - bei weitestmöglicher Auslegung des Begriffs »revolutionär«. Betrachten wir beispielsweise die seltsame Ambiguität in Marx' Denken über revolutionäres Handeln. Wie bereits im dritten Kapitel erläutert, geht Marx davon aus, dass menschliche Kreativität und Kritikfähigkeit letztlich auf einem reflexiven Vorstellungsvermögen beruhen. Das ist es, was uns zu Menschen macht. Daher auch das bekannte Beispiel des Baumeisters, der, anders als die Biene, die Zelle erst in seinem Kopf baut und dann in Wachs. Daher rührt jedoch auch die Ambiguität: Unsere Fähigkeit zur Revolution rührt zwar von ebenjener Kritikfähigkeit her, aber der Revolutionär darf Marx zufolge niemals auf die gleiche Weise vorgehen wie der Baumeister. Es war nicht die Aufgabe des Revolutionärs, fertige Pläne für eine zukünftige Gesellschaft vorzulegen und dann zu versuchen, sie umzusetzen, oder sich auch nur einzelne Aspekte dieser zukünftigen Gesellschaft vorzustellen. Das wäre Utopismus und für revolutionäre Theoretiker, die so vorgehen, hat Marx nichts als Verachtung übrig. Warum die Unterscheidung? Weil der revolutionäre Umbruch so allumfassend sein sollte, ein Sprung in eine völlig neue Phase der Geschichte? Vermutlich ist das die einfachste und gängigste Erklärung. Man könnte sagen, ein Revolutionär, der versucht, eine neue Gesellschaft zu entwerfen, gleicht einem Baumeister, der versucht, ein Gebäude zu entwerfen, das in einem Universum mit völlig anderen physikalischen Gesetzen errichtet werden soll. Oder einem Scholastiker aus dem Mittelalter, der versucht, sich die Vorgänge an der New Yorker Börse vorzustellen. Dieser Ansatz führt zu einer Reihe bekannter Fragen: Wie relativistisch war Marx eigentlich? Welche Art von
- radikalem Umbruch erwartete er vom Sozialismus? Glaubte er an die Existenz irgendwelcher gesellschaftlicher oder moralischer Prinzipien, die über bestimmte historische Epochen hinausreichten? Über all das wurden bereits endlose Debatten geführt. Vielleicht wäre es interessanter, wenn man die Vorstellung eines radikalen Umbruchs beiseitelässt und die Frage unter dem Aspekt des Maßstabs betrachtet. Immerhin ist jeder schöpferische Akt bis zu einem gewissen Grad neu und beispiellos. Nur ist das zumeist ein sehr geringer Grad. Das Gleiche gilt für Baumeister: Jeder neue Entwurf ist zwar bis zu einem gewissen Grad einzigartig und kann daher als Ausdruck der persönlichen, schöpferischen Vision(en) des Baumeisters betrachtet werden - und das trifft sogar auf ein gemeinsam errichtetes traditionelles Haus in einer traditionellen Gesellschaft zu -, in anderer Hinsicht ist es jedoch lediglich die Wiederholung einer vertrauten Tätigkeit. Es werden ununterbrochen neue Häuser entworfen und gebaut. Hinzu kommt, dass ein solches Projekt stets in verschiedene übergeordnete praktische Kategorien fällt, die im Wesentlichen ebenfalls Handlungsmuster sind. Was den Entwurf angeht, genießt ein Baumeister vielleicht eine große künstlerische Freiheit, er kann sogar einen völlig neuen Stil anvisieren; sollte er jedoch feststellen, dass ihn die bürgerliche Unterscheidung zwischen Wohnhaus, Garage und Kaufhaus zu Tode langweilt, würde er schnell merken, dass die in seiner Vorstellung entstandenen Entwürfe nicht darüber hinausgekommen sind oder es zumindest nicht weiter als bis zu Blaupausen oder Zeichnungen in Avant- garde-Zeitschriften geschafft haben. Kreatives Handeln, so könnte man sagen, wird auf allen Ebenen von einem übergeordneten Handlungssystem umschlossen, innerhalb dessen es gesellschaftlich bedeutsam wird - das heißt gesellschaftlichen Wert erlangt. Jede kreative Handlung in einem gewissen Maß revolutionär, um aber in einem relevanten Maß revolutionär zu sein, muss sie die Struktur, in die sie eingebunden ist, verändern. An diesem Punkt angelangt, kann man sich nicht länger einbilden, dass man nur an Gegenständen arbeitet, sondern man muss sich eingestehen, dass man auch an Menschen arbeitet. Und dieses Handlungsund Bedeutungssystem wird natürlich wieder von einem anderen umschlossen. Wir haben es also mit einem Kontinuum zu tun. Das heißt nicht, dass ein revolutionärer gesellschaftlicher Wandel mit ähnlich kreativen, intentionalen Qualitäten wie denen des Baumeisters nicht möglich ist. Es bedeutet, dass es sehr viel schwieriger ist, ihn in den Griff zu bekommen, weil er über sehr viel subtilere kollektive Medien erfolgt. Man könnte das Problem auch aus einer entgegengesetzten Perspektive betrachten. Wenn jeder schöpferische Akt revolutionär ist (und sei es auch nur in einem sehr geringen Maß, in etwa so, wie ein Fisch ein einzigartiges Individuum ist), woraus besteht dann diese revolutionäre Qualität? Vermutlich bemisst sie sich daran, inwiefern dieser Akt beispiellos ist und deshalb das alleinige Werk seines oder seiner Schöpfer ist. Das bedeutet aber auch, dass der revolutionäre oder kreative Aspekt einer Handlung zugleich ihr historischer Aspekt ist: zumindest wenn man - wie ich es tue28 - anerkennt, dass man eine Handlung insoweit als historisch betrachten kann, als sie vor ihrer Ausführung nicht vorhersagbar war. In jeden Fall sprechen wir über etwas, das aus der Perspektive eines Systems »Willkür« zu sein scheint, aus der Perspektive des Individuums jedoch »Freiheit«. Insofern jedes Handlungssystem zugleich historisch ist, befindet es sich in dauernder Transformation oder zumindest potentieller Transformation. Im dritten Kapitel habe ich behauptet, dass man Marx' Fetischismus als eine Unterart des Piaget'schen Egozentrismus betrachten könnte, im Sinne einer Verwechslung der eigenen, individuellen Perspektive innerhalb eines übergeordneten Systems mit dem System als Ganzem - das Versäumnis, die relevanten Sichtweisen zu koordinieren. Das impliziert jedoch vor allem, dass diese größere Totalität existiert und dass es möglich ist, etwas darüber zu wissen. Ich habe vorsorglich darauf hingewiesen, dass dies allenfalls in einem begrenzten Umfang zutrifft. Es ist praktisch unmöglich, dass sich jemand aller Perspektiven bewusst ist, die er in einer bestimmten Situation einnehmen kann oder auch nur derer, die alle an einer bestimmten Situation Beteiligten einnehmen (jedes Mitglied einer Familie oder eines Kegelclubs, von einem Markt gar nicht zu reden). In den meisten Fällen spielt das jedoch keine Rolle, weil man es mit Dingen zu tun hat, die praktisch immer wieder auf die gleiche Weise ablaufen. Auch wenn man nicht wissen kann, wie die einzelnen Akteure auf dem Markt eine Sache
- sehen, versteht man, sofern man die Logik des Systems versteht, genug, um zu begreifen, warum ein bestimmtes Produkt den Wert hat, den es hat. Daraus wiederum folgt, dass dies umso weniger zutrifft, je mehr die mit einer Situation verbundene historische Kreativität zunimmt. In einem Augenblick tiefgreifenden historischen Wandels kann keiner der Beteiligten wissen, woraus das fragliche System genau besteht. Man ist in dem gefangen, was ein Hegelianer als Augenblick dialektischer Entfaltung bezeichnen würde. Wissen ist zwangsläufig fragmentarisch, und die Totalitäten, mit denen die Akteure operieren, sind zwangsläufig imaginär oder prospektiv oder zahlreich und widersprüchlich. Welche Folgen hat das für eine Fetischismustheorie? Oder eine Werttheorie? Was die Bestimmung von Wert betrifft, wird in solchen verwirrenden Situationen häufig ein Feld für eine minimale faktische »Gesellschaft« abgesteckt, sozusagen eine Art Mikrototalität. Ein Beispiel wäre der Potlatch, den ich im vorangegangenen Kapitel beschrieben habe. Ein anderes die von Beidelman untersuchten Homerischen Spiele:29 Wagenrennen oder andere Wettkämpfe, bei denen Krieger um alle möglichen, für gewöhnlich den Feinden abgenommene Preise miteinander stritten: wertvolle Waffen, Kessel aus kostbarem Metall, hübsche Sklavinnen. Turner30 merkt hierzu an, es sei in einem solchen Fall unmöglich, eine gemeinsame Wertgrundlage zu schaffen, zum Beispiel auf Arbeit basierend, die es erlaubt, diese Gegenstände als unterschiedliche Proportionen zu behandeln. Die endlosen - und andernfalls etwas sinnlos wir- kenden - Spiele und Wettkämpfe, die sich die Heerführer während der Belagerung von Troja lieferten, dienten (sicher neben anderen Dingen) dazu, ein Feld abzustecken, eine Art imaginäre Miniaturausgabe der homerischen Gesellschaft zu schaffen, in der man sie in ein Verhältnis zueinander setzte, indem man sie als erster Preis, zweiter Preis und so weiter einstufte. Wie beim Potlatch ist das erst durch die Anwesenheit eines Publikums möglich. Man könnte eine solche Analyse noch auf eine ganze Reihe anderer klassischer Fälle der Ethnologie ausdehnen. Ich möchte mich hier auf die eigentümliche Rolle von Objekten im Zusammenhang mit historischer Wirkungskraft konzentrieren - insbesondere auf jene, die wie Geld als Medium dienen, um genau das hervorzubringen, was sie repräsentieren. Kehren wir noch einmal zur Untersuchung des Geldes im dritten Kapitel zurück. In einem Lohnarbeitssystem steht Geld für den Wert (die Bedeutsamkeit) produktiver Handlungen, während gleichzeitig das Verlangen nach seinem Erwerb zu dem Mittel wird, das diese Handlungen hervorbringt. Was den Kapitalismus angeht, trifft das lediglich aus der spezifischen, subjektiven Perspektive des Lohnarbeiters zu; in der Wirklichkeit - das heißt in der sozialen Wirklichkeit - rührt die Macht des Geldes von einem gigantischen System her, das der Koordination menschlichen Tuns dient. In einer Situation radikalen Wandels jedoch, einem revolutionären Augenblick, in dem das übergeordnete System selbst transformiert wird oder in dem, wie es bei westafrikanischen Fetischen oder einer großen Zahl madagassischer Talismane der Fall ist, überhaupt erst soziale Übereinkünfte zwischen völlig verschiedenen Akteuren getroffen werden, verhält es sich anders. Die übergeordnete soziale Realität existiert noch nicht. Das einzig Reale ist die Fähigkeit des Akteurs, sie zu schaffen. In solchen Situationen erwecken Gegenstände das, was sie repräsentieren, tatsächlich in einem gewissen Sinn zum Leben. Sie werden sozusagen zum Scharnier zwischen Vorstellung und Realität. Wenn eine Gruppe von Leuten den Schwur leistet, neue Rechte und Verpflichtungen untereinander festzulegen, und dann ein Objekt anruft, es möge sie erschlagen, falls sie diesen Verpflichtungen nicht nachkommen, dann erlangt dieses Objekt dadurch nicht die Macht, das auch zu tun. In anderer Hinsicht hat es - oder der Glaube, den die Leute in es setzen - jedoch tatsächlich die Macht, eine neue gesellschaftliche Ordnung ins Leben zu rufen. Vielleicht lag Mauss hier nicht völlig daneben, als er Subjekt-Objekt-Umkehrungen als integralen Bestandteil bei der Schaffung sozialer Bindungen und Verpflichtungen sah: die Art von Gesellschaftsverträgen, deren untergründige Geschichte er zutage fördern wollte. Fazit Meine Ausführungen zum Königsritual der Merina endeten mit der Feststellung, dass magisches Verhalten zwar manchmal etwas hervorbringt, das einer gesellschaftswissenschaftlichen Betrachtungsweise sozialer Macht erstaunlich nahe kommt, dass es aber unsinnig ist, tatsächlich so
- etwas wie eine Sozialschaftswissenschaft davon zu erwarten, irgendeinen systematischen Versuch, das Wesen der sozialen Realität zu entschlüsseln - das heißt einen Diskurs in Gang zu setzen, der versucht, außerhalb von Machtpraktiken zu stehen es sei denn als Teil einer ganz speziellen Art von sozialem Projekt. Man könnte sogar sagen eines »utopischen Projekts«. Die Vorstellung, es könnte einen Diskurs geben, der nicht an den Praktiken von Macht und Ungleichheit teilhat, war historisch eng mit der Vorstellung verbunden, es könnte eine Welt geben, die das nicht tut. Nur in solchen historischen Epochen - etwa während der Aufklärung, in den Jahren vor der Französischen und der Amerikanischen Revolution -, wenn man die Idee einer neue Gesellschaftsordnung für möglich (oder genauer gesagt, für legitim) hält und diese dann verwirklicht, scheint auch eine Idee von sozialer »Wirklichkeit« zu entstehen; sozusagen als Kehrseite der Überzeugung, dass man (um ein bekanntes Schlagwort von Mai 1968 zu verwenden) die Phantasie an die Macht bringen kann. Dieser Punkt wird von denen, die Ethnologie im Großen und Ganzen für ein Produkt des Imperialismus halten, gern übersehen. Das, was wir als »Sozialwissenschaft« bezeichnen (in Ermangelung eines besseren Begriffs), entstand in einem intellektuellen Milieu, das nicht nur von einem weltweiten Imperialismus geprägt war, sondern außerdem besessen von der Möglichkeit der Revo- lution, der eigenen plötzlichen und radikalen Verwandlung in etwas anderes. Zweifellos verdankt die moderne Ethnologie ihre Entstehung der Bildung riesiger europäischer Imperien, die sich eine Vielzahl von Gesellschaftssystemen einverleibten. Aber das allein reicht als Erklärung nicht aus. In der Menschheitsgeschichte hatte es schon zuvor multikulturelle Reiche gegeben, und soweit wir wissen, hat sich keines davon jemals mit dem systematischen Vergleich kultureller Unterschiede beschäftigt. Selbst wenn wir uns auf die abendländische Tradition beschränken, deutet vielmehr alles in die entgegengesetzte Richtung. Geht man zurück bis in die Antike, könnte man sagen, dass im fünften Jahrhundert v. Chr. in Griechenland so etwas wie Ethnologie entstand, und als Beleg die Werke von Geografen wie Hekataios und Geschichtsschreibern wie Herodot anführen. Zweifellos entwickelten diese Gelehrten Ideen dazu, wie sich Sitten und Bräuche systematisch miteinander vergleichen ließen.31 Das war zu einer Zeit, in der die hellenistische Welt noch keine politische Einheit war, geschweige denn Mittelpunkt eines ausgedehnten multikulturellen Reichs. Mit der Entstehung solcher Imperien verschwand diese Art von Literatur: Weder der Hellenismus noch das Römische Reich konnte mit etwas der Ethnologie Vergleichbarem aufwarten. Eine einleuchtende Erklärung wäre wohl, dass in Griechenland das fünfte vorchristliche Jahrhundert eine Epoche politischer Möglichkeiten war: reich an gesellschaftlichen Experimenten, Revolutionen, utopischen Plänen zur Gründung idealer Städte. Der Vergleich von Gesellschaftsordnungen war eine Möglichkeit, über das potentielle Aussehen einer politischen (für die Griechen gleichbedeutend mit »menschlichen«) Gesellschaft zu sprechen. Während der mehrere Jahrhunderte dauernden römischen Herrschaft war das anders. Genau genommen sieht es so aus, als hätte gerade die politische Zersplitterung Griechenlands im fünften Jahrhundert diese Art von Denken gefördert. Mit dem Stadtstaat, einer relativ kleinen Gemeinschaft, als politischer Grundeinheit bot sich ein riesiges Feld für politische Experimente: Ständig wurden neue griechische Kolonien und damit politische Einheiten gegründet, neue Verfassungen entworfen und umgesetzt, alte Systeme gestürzt. So wird die Geschichte für gewöhnlich jedoch nicht erzählt. Ich vermute, dass die meisten Wissenschaftler, wenn sie von den ersten Regungen ethnographischer Forschung überhaupt Notiz nähmen, diese lediglich als einen Aspekt der aufkommenden wissenschaftlichen Forschung betrachten würden: der gleiche Geist systematischen Vergleichs, den griechische Denker auch auf die Physik oder die Geometrie anwandten. Ich halte das nicht unbedingt für falsch, aber wie es häufig der Fall ist, zieht die Nennung des Begriffs »Wissenschaft« so viele andere Fragen nach sich, dass es wahrscheinlich eher der Verwirrung als der Erhellung dient. Interessanter wäre es, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass die Bereitschaft, die menschliche Phantasie an die Macht zu bringen, es ihrerseits erfordert, eine aus irgendeiner Art von resistenter »Wirklichkeit« bestehende Grundlage anzuerkennen (die dann untersucht werden muss). Das sind gewissermaßen die beiden Seiten ein und desselben Vorgangs. Dann würde man zumindest besser verstehen, warum in der jüngeren Vergangenheit so
- viele ausgesprochen idealistische Menschen darauf bestanden haben, sich selbst als »Materialisten« zu bezeichnen, oder wenigstens, warum die waghalsigsten utopischen Projekte so oft an irgendeine Art von Materialismus gebunden waren. Vielleicht könnte man für die letzten fünfhundert Jahre europäischer Geschichte zumindest eine lose Verbindung zwischen ethnographischer Neugier und einem Bewusstsein für politische Möglichkeiten aufzeigen. Man könnte im sechzehnten Jahrhundert beginnen, in dem in den Schriften Montaignes zum ersten Mal die Rede von etwas war, das später zum modernen Relativismus werden sollte, und gleichzeitig eine Utopie und eine revolutionäre Bewegung die nächste jagte. In den folgenden hundert Jahren ließ die Neugier nach und man sah nicht mehr überall neue Möglichkeiten, bis es in der Zeit vor der Französischen Revolution zu einer plötzlichen Wiederbelebung kam, auf die ein erneuter Rückgang in den Jahren der Restauration nach Napoleons Abdankung und eine umso stärkere Wiederbelebung nach den Revolutionen von 1848 folgten. In diese letzte Epoche fiel die Entstehung der Ethnologie als Disziplin. Man vergisst leicht, wie sehr die europäische Gesellschaft jener Zeit vom Gespenst der Revolution verfolgt wurde: selbst wackere Viktorianer wie Edward Tylor oder Sir James Fra-zer waren sich der Möglichkeit, dass sich ihre Gesellschaft von heute auf morgen in etwas völlig anderes verwandeln könnte, nur allzu bewusst. Diese Aussicht machte den meisten frühen Ethnologen zweifellos Angst, einige wenige fanden sie möglicherweise auch aufregend,32 aber ignorieren konnte sie keiner. Die frühe Ethnologie versank also nicht nur in voyeuristischen Betrachtungen eines völlig fremden und fernen Anderen, sondern wurde zumindest zum Teil von der Vorstellung beflügelt, man könnte eines Tages aufwachen und feststellen, dass man selbst zum Anderen geworden war. Vielleicht haben wir es hier mit einem Bündel von Komponenten zu tun: ein Bewusstsein für gesellschaftliche Möglichkeiten; das Gefühl, dass die Menschen in der Lage sein sollten, nur in der Phantasie existierende Pläne auf die eine oder andere Weise Wirklichkeit werden zu lassen; ein damit verbundenes Interesse, die volle Bandbreite menschlicher Möglichkeiten zu verstehen wie auch die »Wirklichkeit« selbst. Es dürfte kaum ein Zufall sein, dass in den 1980er und 1990er Jahren all das gleichzeitig ins Kreuzfeuer geriet. In einigen Disziplinen lief der Postmodernismus darauf hinaus, den Traum von Massenaktionen zum Zweck revolutionärer Veränderungen und den Glauben an irgendeine Art von »Fundamentalismus«, irgendeine Verankerung in einer resistenten Wirklichkeit, aufzugeben; in der Ethnologie lief er darauf hinaus, ebenjenes Vergleichsprojekt in Frage zu stellen. Damals hielt man das weithin für radikal - und insofern »radikal« bedeutet, zu den Wurzeln von etwas vorzudringen, dann war es zweifellos radikal. Die Frage, die ich im Verlauf dieses Buches wiederholt gestellt habe, lautet jedoch, ob es wirklich dieser Wurzelstrang ist, den wir ausreißen sollten. Ich für meinen Teil bin der Ansicht, dass sich ein anderer Strang sehr viel besser als intellektueller Widerpart eignet: eine Konvergenz zwischen Parmenides' festen Formen, einem gewissen extremen Individualismus, der die abendländische Tradition lange Zeit verfolgt hat, und der Annahme, dass die menschliche Natur auf einem unaufhörlichen, unstillbaren Begehren beruht, weshalb wir uns alle in einem ständigen Konkurrenzkampf miteinander befinden.33 Das waren jedenfalls meine wichtigsten intellektuellen Gegenspieler in diesem Buch. Und sie erscheinen mir als wesentlich größere Herausforderung, weil sie alle sehr viel tiefer in unser Alltagsdenken eingebettet sind. Marx gegen Mauss - zweite Runde Die größte Herausforderung von allen ist vielleicht die Betrachtung der Welt aus, wie ich es genannt habe, heraklitischer oder, wenn Ihnen das lieber ist, dialektischer Sicht. Im Verlauf dieses Buches habe ich dargelegt, dass Kategorien- oder Wissenssysteme tatsächlich nur die eine Seite eines Handlungssystems sind; dass Gesellschaft daher in einem gewissen Sinn immer ein aktives Projekt oder eine Menge von Projekten ist; dass Wert die Art und Weise bezeichnet, wie Handlungen für die Handelnden Bedeutung erlangen, indem sie in ein übergeordnetes gesellschaftliches Ganzes eingebunden werden, sei dieses nun real oder imaginär. Einen dialektischen Ansatz zu verfolgen bedeutet, Dinge nicht nach der Vorstellung zu definieren, die man in einem bestimmten abstrakten Moment, außerhalb der Zeit, von ihnen hat, sondern wenigstens partiell nach dem Potential, das in ihnen steckt. Diese Denkweise konsequent zu verfolgen ist ausgesprochen schwierig. Aber wenn
- man es schafft, lösen sich alle möglichen vermeintlich unlösbaren Probleme auf. Ich möchte das an einem Beispiel zeigen, bevor ich den Versuch unternehme, eine allgemeinere Verbindung herzustellen. Lévi-Strauss hat vor vielen Jahren in Zusammenhang mit dem ethnologischen Relativismus auf ein solches grundlegendes Problem hingewiesen: Während wir die Vorstellung ablehnen, dass manche Völker Barbaren sind, und darauf beharren, dass die Sichtweisen verschiedener Gruppen alle gleichberechtigt sind, ist es in den meisten dieser Gruppen einer der obersten Glaubenssätze, dass dem nicht so ist.34 Deshalb verwendeten die meisten indigenen Gesellschaften in Nord- und Südamerika für sich selbst eine Bezeichnung, die so viel wie »menschliches Wesen« bedeutete, während die Bezeichnungen für ihre Nachbarn (Menschenfresser, Mörder, Esser von rohem Fisch usw.) nahelegten, dass sie das nicht waren. Lévi-Strauss' Schlussfolgerung, die wahren Barbaren seien diejenigen, die andere für Barbaren halten, ist so offensichtlich zirkulär, dass man annehmen muss, sie war als Scherz gemeint. Auf der Grundlage der gleichen Art von Strukturalismus erklärte Michel Foucault in der Archäologie des Wissens, dass es sich bei der Vorstellung von »Mensch« oder Menschsein, auf der die Humanwissenschaften gründen, nicht um eine universelle Kategorie handele, sondern um eine bestimmte Doktrin der Aufklärung, die sich eines Tages erledigt haben wird. Damit erregte er eine Menge Aufmerksamkeit. Aber kaum jemand hat darauf hingewiesen, dass dieses Argument auf einer ausgesprochen parmenidei-schen, ja sogar positivistischen Denkweise hinsichtlich begrifflicher Kategorien beruht. Die amerikanischen Gesellschaften, von denen Lévi-Strauss sprach, mögen sich als »menschliche Wesen« bezeichnet und keinen Zweifel daran gelassen haben, dass sie andere Gesellschaften für zurückgeblieben hielten, die meisten (wie die Irokesen) waren jedoch zugleich stolz darauf, dass sie Kinder und selbst Erwachsene aus anderen Gesellschaften adoptieren und richtige menschliche Wesen aus ihnen machen konnten. Es gibt keinerlei Beleg dafür, dass sie glaubten, sie könnten dasselbe auch mit Fischen oder Schnecken machen. Also existierte tatsächlich eine universelle Kategorie des Menschseins, aber als Menge von Potentialen, so wie universalistische Religionen wie Christentum, Zoroastrismus oder Islam - lange vor der Aufklärung - in Lebewesen, die über das Potential verfügten, zum Christentum oder zum Zoroastrismus zu konvertieren, eine universelle Kategorie des Menschseins erkannten. Diese Logik lässt sich auf alle möglichen anderen Probleme anwenden. Bei universellen Ideen handelt es sich nicht um Ideen, die von allen auf der Welt geteilt werden, das ist lediglich falscher Positivismus; universelle Ideen sind Ideen, die jeder auf der Welt verstehen könnte. Entsprechend sind universelle moralische Normen keine Normen, über die sich im Augenblick alle auf der Welt einig sind - offensichtlich gibt es nichts, worüber sich alle einig sind -, sondern Normen, die wir aufgrund der Fähigkeit zu moralischem Denken und bereits geteilter Erfahrungen mit Formen moralischer Praxis gemeinsam entwickeln und anerkennen könnten (was wir wahrscheinlich auch tun müssen, wenn wir alle überleben wollen). Und so weiter. Da die Ethnologie in meinen Augen notwendigerweise Teil eines moralischen Projekts ist - in der Vergangenheit oft kein besonders gutes, aber potentiell immer sehr gut -, steht in diesem Buch an vielen Stellen die Dichotomie zwischen Marx und Mauss im Mittelpunkt, zwei Männern, die beide von kultureller Differenz fasziniert waren und sich der revolutionären Transformation ihrer jeweiligen Gesellschaft verschrieben hatten. Davon abgesehen hatten sie kaum Gemeinsamkeiten. Mauss suchte eine universelle moralische Grundlage für eine Kapitalismuskritik und hielt in anderen Gesellschaften Ausschau nach Hinweisen auf die Gestalt von Institutionen, die den Kapitalismus ersetzen könnten. Marx lehnte jede derartige Kritik ab, da sie unweigerlich etwas von der »kleinbürgerlichen« Moral von Handwerkern und Bauern an sich hatte, und beharrte darauf, dass die Rolle, die Wissen im revolutionären Prozess spielte, nahezu ausschließlich kritisch war: Für ihn ging es darum, die inneren Widersprüche und Bewegungsgesetze des Kapitalismus selbst zu verstehen. Sein Ansatz war tatsächlich so erbarmungslos kritisch, dass er kategorisch erklärte, es sei unmöglich, in der bestehenden Gesellschaftsordnung etwas zu finden, das als Grundlage für eine Alternative dienen könnte, einmal abgesehen von der revolutionären Praxis des Proletariats, dessen historische Rolle
- jedoch daher rührte, dass es sich als die eine Klasse, die in der herrschenden kapitalistischen Ordnung absolut nichts zu sagen hatte, nur durch deren vollständige Negation befreien konnte.35 Fünfundsiebzig Jahre später hatte Mauss die Gelegenheit zu beobachten, wie leicht aus der Ablehnung kleinbürgerlicher Moral die Verdammung »bürgerlicher Sentimentalität« werden konnte - ein Ausdruck, dessen sich die bolschewistische Führung bediente, um jeden, der sich aus Prinzip weigerte, andere kaltblütig zu ermorden, zu disqualifizieren. Er gelangte offenbar zu der Schlussfolgerung, dass es gerade Marx' Weigerung war, die gängige moralische Kapitalismuskritik ernst zu nehmen, welche so viele seiner Anhänger in einen hartherzigen, zynischen Utilitarismus verfallen ließ, der seinerseits eine leicht veränderte Variante der auf dem kapitalistischen Markt herrschenden Moral war. Andererseits bewegte Mauss sich so weit in die entgegengesetzte Richtung, dass seine Schlussfolgerungen manchmal verblüffend naiv gerieten: beispielsweise, dass aristokratische Gesellschaften wirklich so funktionierten, wie die Aristokratie vorgab, oder dass sich Kapitalisten, angetrieben vom eigenen Konkurrenzdenken, zu guter Letzt von ihrem Kapital trennen würden, wenn man sie nur oft genug dazu ermunterte. Das Interessante an dieser Dichotomie ist, dass sie unsterblich zu sein scheint. Ich habe bereits einiges zum Schicksal der kritischen Theorie in den 1970er Jahren gesagt - was geschieht, wenn man ernsthaft versucht, die von Marx begonnene Entwicklung einer, wie er es in einem Brief nennt, »rücksichtslosen Kritik alles Bestehenden«, zu ihrem Ende zu führen. Dabei käme vermutlich das Bild einer derart trostlosen Welt heraus, dass letzten Endes die Kritik selbst sinnlos erscheint. Wie andererseits die Debatten über die Ausbeutung von Arbeiterinnen in Melanesien zeigen, um ein Beispiel zu nennen, haben Neo-Maussianerinnen wie Marilyn Strathern oder Annette Weiner in dieser Hinsicht nicht unbedingt sehr viel mehr zustande gebracht.36 Wo man in der Verfolgung des Marx'schen Ansatzes geneigt wäre, die Bedeutung jedes sichtbaren Zeichens von weiblicher Autonomie oder Macht letztlich daran zu messen, in welchem Maß sie zur Aufrechterhaltung eines übergeordneten Systems, in dem Frauen unterdrückt werden, beiträgt, bestreiten die Maussianer letzten Endes, dass es irgendein übergeordnetes System von Bedeutung gibt. Auch wenn feministische Ethnologinnen natürlich zu Recht auf die seit jeher bei ihren männlichen Kollegen bestehende Neigung hinweisen, weibliche Belange und Autonomiebereiche außer Acht zu lassen, wird es, wenn man diesen Ansatz bis zu seinem logischen Schluss weiterverfolgt, statt diese Probleme als unlösbar zu begreifen, ziemlich schwierig aufzuzeigen, dass überhaupt ein Problem existiert.37 Die Frage lautet offensichtlich nicht, ob es notwendig ist, einen Kompromiss zwischen diesen extremen Standpunkten zu finden, die Frage lautet, wie man ihn findet. Oder sie sollte vielmehr lauten: Was veranlasst normalerweise vernünftige Gesellschaftstheoretiker dazu, solche merkwürdig extremen Standpunkte einzunehmen? Schließlich fällt es den meisten von uns nicht übermäßig schwer, im Alltagsleben einen Mittelweg zwischen Zynismus und Naivität zu finden. Warum sollte uns die Gesellschaftstheorie, die uns die Augen für so viele Phänomene öffnen kann, denen gegenüber der gesunde Menschenverstand blind ist, Problemen gegenüber blind machen, für die der gesunde Menschenverstand tatsächlich Lösungen findet? Ich hoffe, dass ich es im Verlauf dieses Buchs zumindest geschafft habe, einen Hinweis darauf zu geben, wo man nach einer Lösung suchen könnte: dass das Problem groß- tenteils auf der parmenideischen Logik hinter den Vorstellungen von »Gesellschaft« oder »Kultur« beruht, die zu unlösbaren Widersprüchen zwischen individueller Motivation und gesellschaftlicher Form führen, und dass ein Ansatz, der stattdessen von den Fragen nach Wert, Kreativität und der unaufhörlichen Überlagerung von realen und imaginären gesellschaftlichen Totalitäten ausgeht, viel zu einer Lösung beitragen könnte.38 Perspektiven: Von der Bedeutung zum Begehren Die Anziehungskraft marktwirtschaftlicher Ideologien ist nicht besonders schwer zu verstehen. Sie bedienen sich eines Bildes der menschlichen Natur und der menschlichen Motivation, das tief in der religiösen Tradition des Abendlandes verwurzelt ist und in unserer marktwirtschaftlich orientierten Gesellschaft durch die Alltagserfahrung unablässig bestätigt wird. Darüber hinaus hat es den Vorteil, dass es ein paar ganz einfache Aussagen trifft. Wir sind einzigartige Individuen mit einem grenzenlosen Begehren; da es
- kein natürliches Limit gibt, wann jemand genug Macht, Geld, Spaß oder materiellen Besitz hat, und die Ressourcen knapp sind, bedeutet das, dass wir uns immer in einem zumindest stillschweigenden Wettstreit befinden. Was wir »Gesellschaft nennen«, ist, wenn nicht eine reine Behinderung, dann ein Instrumentarium, das das Streben nach Glück erleichtert, den Vorgang steuert und hinterher vielleicht das Chaos beseitigt. Zum Ausgleich von Marktprinzipien kann dann gegebenenfalls ihr Gegenteil dienen: Familienwerte, selbstlose Nächstenliebe, altruistische Hingabe an einen Glauben oder eine Sache - allesamt Prinzipien, die gewissermaßen als Gegenstück zur reinen Psychologie eines rationalen, eigennützigen Kalküls entstanden. Sie sind, wie Mauss uns erinnert, im Grunde nur die beiden Seiten derselben falschen Münze. Der entscheidende Schritt, der wichtigste ideologische Schachzug besteht demnach darin, die grundlegenden Fragen des Begehrens aus der Gesellschaft zu extrahieren, so dass sich Glück vor allem als Beziehung des Einzelnen zu Gegenständen begreifen lässt (oder bestenfalls zu Menschen, die man wie Gegenstände behandelt): in dem Augenblick, in dem uns Rousseau daran erinnern muss, dass es sinnlos wäre, alle ande- ren umzubringen und sich ihres Besitzes zu bemächtigen, weil es dann niemanden mehr gäbe, der wüsste, dass er jetzt uns gehört, haben wir das ideologische Spiel längst verloren. Und es ist natürlich genau dieses Extrahieren, das den Befürwortern des Marktes die Behauptung erlaubt, sie würden im Namen der menschlichen Freiheit handeln, da sie dem Individuum die Möglichkeit geben, sich darüber klar zu werden, was es vom Leben will; und dabei merkt keiner, dass die meisten dieser Individuen den größten Teil ihrer wachen Zeit nach der Pfeife von anderen tanzen. Eigentlich ein genialer Trick, wenn man genauer darüber nachdenkt. Die Macht der Markttheorie beruht zum großen Teil auf ihrer Einfachheit. Sie schließt eine Theorie der menschlichen Natur in sich ein, eine Theorie des Begehrens, des Vergnügens, der Freiheit und sogar auf ihre Art eine Theorie der Gesellschaft. Der Umstand, dass die Argumentation in all diesen Bereichen so grob gestrickt ist, dass sie praktisch nur aus Löchern besteht, ist für ideologische Zwecke kaum von Bedeutung, insbesondere wenn niemand mit einer überzeugenderen Alternative aufwarten kann. Vielmehr sieht es manchmal fast so aus, als hätte die andere Seite (abgesehen von jeder erdenklichen spitzfindigen Kritik) wenig mehr zu bieten als eine zusammengewürfelte Sammlung vereinzelter Einsichten, die, so brillant sie auch sein mögen, aus so unterschiedlichen theoretischen Traditionen hergeleitet werden, dass es unmöglich ist, eine kohärente Argumentation daraus aufzubauen. Ein Problem, dem ich mich beispielsweise bei der Arbeit an diesem Buch ziemlich oft gegenübersah, war das Fehlen einer theoretischen Sprache, in der man über Begehren sprechen kann. Man steckt ganz schön in der Klemme, wenn man sich nicht einreden kann, es gäbe einen zwingenden Grund zu glauben, dass eine besondere Beziehung zwischen der Sprache und dem Penis des eigenen Vaters besteht, und infolgedessen die Ideen von Jacques Lacan zu übernehmen bereit ist, oder wenn man nicht willens ist, sich Autoren wie Deleuze oder Foucault anzuschließen und den Ansatz Nietzsches zu übernehmen, der das Begehren oder die Gier nach Macht zum konstitutiven Prinzip der Wirklichkeit erklärt -eine Position, die, treibt man sie weiter, ausnahmslos zu ziemlich absonderlichen Ergebnissen führt, zum Beispiel wenn linke Akademiker ein Loblied auf Marquis de Sade singen. Natürlich ist es möglich, Einsichten aus solchen Theorien zu gewinnen, ohne sie im Ganzen gutzuheißen, wie ich es am Ende des vierten Kapitels getan habe, als ich mich an einer nichtfreudianischen Version von Lacan versucht habe. Allerdings muss ich gestehen, dass es sich dabei um eine Verzweiflungstat handelte. Bestimmt gibt es andere Alternativen. Eine Anregung zu diesem Gedankengang lieferte ein früher Text Jean Baudrillards über Fetischismus, von dem man sagen könnte, dass er Lacans Vorstellung vom gespiegelten Begehren zu ihrem logischen Schluss führt. Baudrillard stellte die Frage, warum bestimmte Formen von Körperschmuck einen so starken sexuellen Reiz ausüben, zum Beispiel (wie Lévi-Strauss behauptet) die Tätowierungen, die die Gesichter der Caduveo-Frauen mit Arabesken überziehen? Liegt es nicht daran, dass das, was wirklich Begehren weckt, wie bei allen Fetischen, die Existenz einer Form von Perfektion ist, ein in sich geschlossenes Zeichensystem? Was uns fasziniert, ist stets das, was uns durch seine Logik oder seine innere Perfektion radikal
- ausschließt: eine mathematische Formel, ein paranoisches System, eine Steinwüste, ein nutzloser Gegenstand oder ein glatter Körper ohne Öffnungen, vom Spiegel verdoppelt, der perversen Selbstbefriedigung geweiht. Dadurch dass sich die Striptease-Tänzerin selbst streichelt, durch ihre selbstbefriedigenden Gesten regt sie die Lust am meisten an.39 Vielleicht ist das weniger eine Theorie des Begehrens als eine Theorie des enttäuschten Begehrens. Es war in erster Linie eine Reaktion auf diese Art von autoerotischem Modell, das Gilles Deleuze anregte, den Blick stattdessen auf das polymorph-perverse Kind zu richten; für ihn wird Begehren zu einer Art universeller ursprünglicher Produktivkraft, die in allen Richtungen zwischen Körpern und zwischen Körpern und der Welt fließt.40 Was wir als »Wirklichkeit« bezeichnen, ist tatsächlich ein Nebeneffekt. Doch selbst wenn man die oben genannten nietzscheschen Probleme beiseitelässt, ist das keine echte Theorie des Begehrens - es ist eher eine Erklärung, weshalb keine Theorie notwendig ist.41 Zu Beginn dieses Buches habe ich gesagt, dass eine Werttheorie vielleicht aus sich eine Alternative hervorbringen könnte. Ich denke, dass eine solche Theorie zumindest in einige vielversprechende Richtungen zeigt. Eines meiner Hauptargumente in diesem Buch zielt darauf, dass das, was wir als »Struktur« bezeichnen, keine feste Menge statischer Formen oder Prinzipien ist, sondern das Muster, nach dem Veränderungen - oder, im Fall der Sozialstruktur, Handlungen -erfolgen; sie besteht, um mit Piaget (oder Turner) zu sprechen, aus den unveränderlichen Prinzipien, die ein System von Transformationen steuern.42 Als solche ist sie schwer zu greifen. Und zwar nicht nur deshalb, weil wir leicht den Überblick verlieren, inwiefern unsere Handlungen dazu beitragen, uns selbst und unser soziales Umfeld zu reproduzieren und zu verändern. Sie ist auch deshalb schwer zu greifen, weil soziales Auftreten für gewöhnlich in dem Maß als kunstvoll und kultiviert - oder sogar kompetent -betrachtet wird, in dem es diese Strukturen - die Muster oder Schemata oder wie immer man es nennen will -, die dahinter stehen, verschwinden lassen kann. Doch selbst dann neigen diese Muster oder Schemata dazu, in der dislozierten geisterhaften Form imaginärer Totalitäten wieder aufzutauchen, und diese Totalitäten wiederum neigen dazu, eingeschrieben in eine Reihe von Objekten zu enden, die, insofern sie zu Vermittlern von Wert werden, auch zu Objekten des Begehrens werden - in erster Linie dadurch, dass sie für den Handelnden den Wert seiner Handlungen darstellen. Das fragliche Objekt kann dabei alles Mögliche sein: eine rituelle Darbietung, ein Erbstück, ein Spiel, ein Titel samt dazugehöriger Regalien. Der springende Punkt ist, dass man, egal worum es sich handelt, sagen kann, dass es auf einer bestimmten Ebene alles einschließt. Solche Objekte verweisen innerhalb ihrer eigenen Struktur auf all jene Prinzipien der Bewegung, die den Bereich abstecken, in dem sie Bedeutung erlangen - so wie sich beispielsweise in einem Haushalt alle elementaren Beziehungsformen finden, die in einem größeren Verwandtschaftssystem im Spiel sind, wenn auch manchmal in einer seltsam verkehrten Form. Auf jeden Fall werden sie zu Standbildern jener Handlungsmuster, die in der Praxis dadurch entstehen, dass ihnen die Leute Wert beimessen - sie sind, wie gesagt, Spiegel unserer manipulierten Absichten. Normalerweise sind diese mikrokosmischen Symbole von einer merkwürdigen Dualität. Einerseits stehen sie für eine in sich geschlossene Perfektion, die, wie Baudrillard meint, an sich reizvoll ist, und neben der der Handelnde nur als Mangel, als Wunde, als Abwesenheit, als abstrakter Inhalt erscheinen kann, der durch diese konkrete Form vervollständigt wird. Hinter diesem strahlenden Bild der Perfektion verbirgt sich jedoch fast immer das Bewusstsein für etwas nicht Wahrnehmbares, eine angedeutete Abwesenheit (deshalb erscheinen Begriffe für das Sehen oft ziemlich passend - eine sichtbare Oberfläche impliziert immer etwas Unsichtbares dahinter). Diese Abwesenheit wird oftmals nicht als Mangel, sondern als eine Art Kraft verstanden. Die ultimative Illusion, der ultimative Trick, der dem Spiel der Spiegel zugrunde liegt, besteht jedoch darin, dass diese Kraft überhaupt keine Kraft ist, sondern eine geisterhafte Reflexion des Handlungspotentials des Einzelnen; seiner »kreativen Energie«, wie ich es etwas vage genannt habe. Fest steht jedenfalls, dass allein das kreative Potential zählt. Man könnte es in einem gewissen Sinn
- sogar als ultimative gesellschaftliche Realität bezeichnen. Das ist für mich das wirklich Bezwingende an Bhaskars »kritischem Realismus«. Bhaskar zufolge sind die meisten Philosophen deshalb nicht in der Lage, mit einer angemessenen Theorie zur physischen Realität aufzuwarten, weil diese für sie lediglich aus Objekten besteht und nicht aus dem, was er als »Kräfte« bezeichnet - Potentiale, Fähigkeiten, Dinge, die grundsätzlich undarstellbar sind und für Ereignisse in den »offenen Systemen« des realen Lebens meistens auch unvorhersagbar43 So verhält es sich meiner Ansicht nach auch mit den Kräften sozialer Kreativität. Was Kreativität sowohl für den Handelnden als auch für den Beobachter so verwirrend macht, ist der Umstand, dass diese Kräfte - ja, genau - grundlegend sozial sind. Und zwar deshalb, weil sie zum einen das Ergebnis eines fortdauernden Prozesses sind, bei dem sich die Strukturen der Beziehung zu anderen untrennbar mit unserem Sein verbinden, und zum anderen weil dieses Potential sich nicht selbst verwirklichen kann - zumindest nicht auf irgendeine bedeutsame Weise -, es sei denn im Zusammenwirken mit anderen. Nur so verwandeln sich Kräfte in Wert. Viele der verblüffenden Rituale, die in diesem Buch beschrieben wurden, vom irokesischen Traumdeuten bis zum Wirken von madagassischem sorona und faditra, könnten als Meditation über diese komplizierte Wirklichkeit aufgefasst werden. Es ist meines Erachtens genau dieser soziale Aspekt, der den Weg frei macht für das, was in den meisten Theorien fehlt. Noch deutlicher tritt das zutage, wenn man sich nach den Theorien des Begehrens den Theorien des Vergnügens zuwendet. Sowohl bei Mauss als auch bei Marx finden sich reizvolle Hinweise (wenn auch nur Hinweise), wie eine Gesellschaftstheorie des Vergnügens aussehen könnte: bei Marx im Geiste nicht entfremdeter Arbeit die Überlegung, dass es in der Natur der sozialen Beziehungen, in die Kreativität eingebettet ist, begründet liegt, ob man Vergnügen daraus zieht oder sie als Qual empfindet; bei Mauss, indem er »das Gefallen an ästhetischem Luxus; das Vergnügen der Gastfreundschaft und des privaten oder öffentlichen Festes«44 hervorhebt. Wenn man sich eines davon als Ausgangspunkt für eine Theorie des Vergnügens vorstellt, kann man schon erkennen, dass sich bei der Form von Vergnügen, die Markttheoretiker offenbar im Sinn haben, wenn sie ihre Modelle menschlichen Verhaltens entwickeln, um eine ziemlich einsame Angelegenheit handelt. Wenn Markttheoretiker an eine vergnügliche, bereichernde Erfahrung denken, scheint ihnen dabei das Bild eines essenden Menschen (»Konsum«) vor Augen zu stehen - und zwar nicht bei einem privaten oder einem öffentlichen Fest, sondern für sich allein. Man könnte meinen, es ginge um eine mehr oder weniger verstohlene Aneignung, bei der Gegenstände, die Teil der äußeren Welt waren, dem Ich des Konsumenten einverleibt werden. Im Grunde genommen muss man gar nicht zu Marx oder Mauss zurückgehen: Es reicht, sich vorzustellen, wie diese Theorie aussehen würde, wenn ihr Ausgangspunkt irgendeine andere vergnügliche Erfahrung wäre, beispielsweise mit jemandem schlafen, ein Konzert besuchen oder auch ein Spiel spielen. Es ist ein Gemeinplatz, dass Vergnügen einen gewissen Ichverlust bedeutet. Da es sich bei Schmerz um ein Phänomen handelt, das alles außer dem schmerzenden Ich verdrängt, meinen manche sogar, man sollte Vergnügen am besten als Gegenstück dazu begreifen:45 Wenn man mit der Hand die Haut eines anderen Menschen berührt, empfindet man Vergnügen, weil man die Haut des anderen spürt; wenn man die eigene Hand spürt, ist es Schmerz. Das hört sich vielleicht ein wenig extrem an, aber für einen Irokesen im siebzehnten Jahrhundert wäre es grundsätzlich wohl absolut logisch gewesen, da man in den irokesischen Kulturen Schönheit und Vergnügen vor allem mit der Überwindung jener Hindernisse assoziierte, die das Ich davon abhalten, sich zu öffnen, sich in die Welt hinaus auszudehnen und in Austausch mit anderen zu treten. Von besonderer Bedeutung erscheint mir dabei das Vorhandensein eines Schöpfungsprinzips. Bei Dankesreden werden nicht nur der Reihe nach die Besonderheiten des Kosmos aufgezählt, es wird auch ihre Entstehung beschrieben, der Umstand ihrer Erschaffung. Vielleicht kann man sogar so weit gehen zu sagen, dass Vergnügen in seinen vollendetsten Formen letztlich nicht nur die Auslöschung des Ichs einschließt, sondern auch den Anteil, den diese Auslöschung an einer unmittelbaren Erfahrung jenes am schwierigsten zu fassenden Aspekts der Wirklichkeit hat, des reinen kreativen Potentials (sei es nun biologischer, gesellschaftlicher oder ästhetischer Art - obwohl ich vermute, dass es im besten Fall an allen drei teilhat) - jenes Phänomens, das, wie der
- Träger der Erde feststellte, auch beispielloses Leid hervorrufen kann, wenn man nichts über den sozialen Kontext weiß, in dem es stattfindet.
- Anmerkungen
- Erstes Kapitel Drei Spielarten des Wertbegriffs 1 In Entangled Objects (1991) gibt Nicholas Thomas sogar einem Abschnitt die Überschrift »value: a surplus of theories« (S. 30), führt dann aber doch nur drei Theorien an. 2 Saussure: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, 1967. 3 Kluckhohn: »A Comparative Study of Values in Five Cultures«, 1951; ders.: »Towards a Comparison of Value-emphases in Different Cultures«, 1956; und Vogt u.a. (Hg.): The People of Rimrock, 1966. 4 Kluckhohn: »Values and Value-orientations in the Theory of Action«, 1951, S. 395. 5 Kluckhohn: »The Philosophy of the Navaho Indian«, 1949, S. 358-359. 6 Albert: »The Classification of Values«, 1956; dies.: »Value Systems«, 1968; Kluckhohn: »Values and Value-orientations in the Theory of Action«, 1951; ders.: »The Study of Values«, 1961; und F. Kluckhohn u.a.: Variations in Value Orientation, 1961. 7 Edmonson: »The Anthropology of Values«, 1973; Dumont: Individualismus, 1991, S. 249- 286. 8 Malinowski: Argonauten des westlichen Pazifik, 1979, S. 88. 9 Ebd., S. 88-89. 10 Auf alle Fälle ist die Chance, dass Prognosen zutreffen, umso größer, je stärker die Forschung eingreift. 11 Vgl. Boas: »The Social Organization and Secret Societies of the Kwakiutl Indians«, 1897; Malinowski: Argonauten des westlichen Pazifik, 1979. 12 Ich sollte besser anmerken, dass diese simplifizierende Darstellung wie ein Scheinargument aussehen mag, und kluge Wirtschaftswissenschaftler sind in ihren Ausführungen auch weitaus scharfsinniger. Doch wer zum Beispiel eine Einführung in die Theorie der rationalen Entscheidung besucht hat, dürfte einer derartigen Argumentation schon mal begegnet sein. 13 In ähnlicher Weise wird Macht oft als Fähigkeit definiert, die Handlungen anderer zu beeinflussen, obwohl das nicht viel Ähnlichkeit mit Privatbesitz hat. 14 In der ethnologischen Literatur wird ein solches Denken nach Marshall Sahlins {Kultur und praktische Vernunft, 1981) oft auch als »utilitaristisch« bezeichnet. Ich ziehe jedoch den Begriff »ökonomistisch« vor, da darin der Sinn besser zum Ausdruck kommt und man ihn auch nicht so leicht mit der spezifischen Denkströmung des neunzehnten Jahrhunderts verwechseln kann. 15 Allerdings muss man zugeben, dass diese im ökonomistischen Denken häufig sehr weit gefasst werden. Dabei zeigt schon ein Minimum an Reflexion, dass das menschliche Bedürfnis nach Nahrung oder der Sexualtrieb an sich recht wenig bedeuten; schließlich kann sich jeder problemlos kulinarische Genüsse 35 Dumont: Individualismus, 1991; vgl. auch Tcherkezoff: Le Roi Nyamwezi, la droite et la gauche, 1983. 36 Die Kritik daran ist vielfältig; meine eigene findet sich in Graeber: »Manners, Deference and Private Property«, 1997. 37 Insofern hat er dem einfachen Modell Saussures den Aspekt der Rangordnung hinzugefügt (jedoch keine Proportionalität). 38 Dies ist lediglich ein simples Beispiel und besagt nicht, dass es nach Dumont in allen Gesellschaften genau diese Sphären gibt. 39 Um auch ein symbolisches Beispiel aus der westlichen Tradition anzuführen: Während in der Sphäre des Säkularen die Frauen die Männer zur Welt bringen (eindeutig eine Geste des »Umfassens«), ist das Verhältnis in der Sphäre des Kosmologischen, in der Eva aus der Rippe Adams geformt wird, genau umkehrt.
- 40 Dumont: From Mandeville to Marx, 1977; ders.: Individualismus, 1991. 41 In traditionellen Gesellschaften kann im Grunde gar nicht von »Individuen« gesprochen werden. Es gibt keine scharfe Trennung zwischen Subjekten und Objekten; vielmehr bestehen Handelnde aus unterschiedlichen Aspekten oder Elementen mit unterschiedlichen hierarchischen Werten. 42 Das bekannteste Beispiel dafür ist Edmund Leach: Political Systems of Highland Burma, 1954 (auch wenn Leach im Übrigen kein Formalist war). In Indien ist Macht (artha) keineswegs implizit, sondern ein bewusst formulierter Wert (vgl. Dumont: From Mandeville to Marx, 1977, S. 152-166), obwohl er mir dennoch zu einer anderen Ordnung zu gehören scheint als Reinheit. 43 Coppet: »Cycles de meurtres et cycles funéraires«, 1969; ders.: »1, 4, 8; 9, 7. La monnaie: présence des morts et mesure du temps«, 1970; ders.: »The Life-giving death«, 1982; ders.: »Land Owns People«, 1985; ders.: »'Are'are Society: A Melanesian Socio-Cosmic Point of View«, 1995. 44 Barraud: Tanebar-Evav, 1979. 45 Iteanu: Le ronde des échanges, 1983; ders.: »Idéologie patrilinéaire ou idéologie de l'anthropologue?«, 1983; ders.: »The Concept of the Person and the Ritual System«, 1990. 46 Jamous: Honneur et Baraka, 1981. 47 Fairerweise muss man einräumen, dass Dumont selbst anmerkt, ein Vorteil seines hierarchischen und holistischen Ansatzes sei der Verzicht auf derart eindeutige Entweder-oder- Unterscheidungen, weil Hierarchien inklusiv und nicht exklusiv sind und von ihren Zentren her bestimmt werden, nicht von ihren Rändern (Dumont: Individualismus, 1991, S. 237-248). Das scheint jedoch eher eine philosophische Überlegung, die sich kaum in der ethnologischen Praxis niederschlägt. 48 Dumont: From Mandeville to Marx, 1977, S. 219. 1 Ein weiterer Faktor war die verspätete Veröffentlichung von Marx' Formen die der Kapitalistischen Produktion vorausgehen bzw. der Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie, die ebenfalls eine viel flexiblere Haltung offenbart, als sich nachfolgende Marxisten vorgestellt hatten. 2 In der französisch- und spanischsprachigen Welt ist seine intellektuelle Bedeutung bis heute aber wesentlich größer. 3 Im Grunde stritten Marxisten und Strukturalisten darüber, welche analytische Methode mehr Berechtigung hatte. Dabei nahmen die Strukturalisten eine relativistische Position ein und behaupteten letztlich, der Marxismus sei ethno-zentrisch. Wie unten dargelegt, setzt Marilyn Strathern diese Linie fort. 4 Zu Marx' »Gebrauchswert« und »Tauschwert« gibt es reichlich Literatur (z. B. Godelier: Ökonomische Anthropologie, 1973, insbes. »>Salzgeld< und Warenzirkulation bei den Baruya in Neuguinea«, S. 207-240; Modjeska: »Exchange value and Melanesian trade reconsidered«, 1985; und vor allem Taussig: The Devil and Commodity Fetishism in South America, 1980). Ich teile die Ansicht, dass »Gebrauchswert« und »Tauschwert« vor allem zur Funktionsbeschreibung innerhalb des kapitalistischen Systems verwendet werden sollten, nicht außerhalb. 5 Vgl. Miller: Material Culture and Mass Consumption, 1987; ders. (Hg.): Ack-nowledging Consumption, 1995. 6 Mauss: »Die Gabe«, 1975 [1925], S. 12. 7 Diese Schlussfolgerung war bereits in Dürkheims »organischer Solidarität« angelegt, bei der gesellschaftliche Solidarität eine Folge der Arbeitsteilung und der durch sie verursachten wechselseitigen Abhängigkeit aller war. 8 Bourdieu: Entwurf einer Theorie der Praxis, 1976, S. 336. 9 Bourdieu verweist bezüglich Gesellschaften, die »keinen >self-regulating market< (Polanyi) [...] aufweisen«, sogar explizit auf ihn (ebd., S. 357). 10 Bourdieu macht keinen Hehl daraus, dass er ökonomische Analysemethoden auf beinahe jedes Feld menschlichen Handelns anwendet. Damit werden diese Felder jedoch nicht notwendig auf das der Ökonomie reduziert, meint er; nur haben diejenigen, die das Feld der Ökonomie untersuchen, bestimmte Prozesse und Phänomene (wie Wettbewerbsstrategien, die Bildung
- bestimmter Kapitalformen usw.), die im Verborgenen in jedem anderen Feld ebenfalls von- stattengehen, bislang am besten beschrieben. 11 Bourdieu: Entwurf einer Theorie der Praxis, 1976, S. 345. Dagegen lässt sich der übliche Einwand machen: Wenn sich Reichtum oder ein Lächeln so einfach vermehren lassen, warum sollte man das dann überhaupt als eine »Gewinn-maximierung« verstehen? 12 Gnostisch in dem Sinne, dass die Welt, in der wir leben, zutiefst und unrettbar verkommen ist und dass die einzig mögliche Erlösung in dieser Erkenntnis besteht. Allerdings muss man fairerweise einräumen, dass Bourdieu vor nicht allzu langer Zeit Derrida wegen der Behauptung kritisiert hat, echte Geschenke seien per definitionem unmöglich, und er meint, »die rein spekulative und aka- demische Frage, ob Großzügigkeit und Uneigennützigkeit möglich sind, sollte der politischen Frage Platz machen, welche Mittel notwendig sind, um Welten zu schaffen, in denen Menschen wie in Schenkökonomien ein Interesse daran haben, großzügig zu sein und uneigennützig zu handeln.« (Bourdieu: »Marginalia - Some Additional Notes on the Gift«, 1997, S. 240.) 13 Wie sich rasch zeigte, ging es dabei um den individuellen Konsum, der ohnedies eine Lieblings-Freizeitbeschäftigung wohlhabender Akademiker ist. Bourdieu dagegen blieb sich treu, rannte gegen den Trend an und kritisierte in Die feinen Unterschiede (1982 [1979]) den Konsum als Reproduktion von Ungleichheit. 14 Appadurai, »Introduction: commodities and the politics of value«, 1986, S. 13. 15 Ebd., S. 14-15. 16 Kopytoff: »The Cultural Biography of Things«, 1986; vgl. auch Parry und Bloch (Hg.): Money and the Morality of Exchange, 1989. 17 Appadurai: »Introduction: commodities and the politics of value«, 1986, S. 12; vgl. auch Carrier: »Gifts in a World of Commodities«, 1990; und ders.: »Gifts, Commodities, and Social Relations«, 1991. 18 Das betont etwa Marilyn Strathern: »Qualified Value«, 1992; vgl. auch Comaroff und Comaroff: Ethnography and the Historical Imagination, 1992, S. 151. 19 Ferguson: »Cultural Exchange: New Developments in the Anthropology of Commodities«, 1988. 20 »In erstaunlich vielen Gesellschaften [...] dient es dem Interesse der Herrschenden, wenn der freie Fluss der Waren vollständig zum Erliegen kommt und ein in sich geschlossener Warenkreislauf an seine Stelle tritt, bei dem ein strenges Reglement darüber entscheidet, wie diese Waren bewegt werden dürfen.« (Appadurai: »Introduction: commodities and the politics of value«, 1986, S. 57) Beispiele dafür, wie die Mächtigen das Ausmaß des Tauschs zu steigern oder die Machtlosen ihn zu beschränken versuchen, nennt er keine. 21 Thomas: Entangled Objects, 1991, S. 28. 22 Andere Texte des Bandes erlauben dies durchaus, vor allem Patrick Gearys ausgezeichnete Darstellung der Zirkulation mittelalterlicher Reliquien (»Sacred Commodities«, 1986). 23 Weiner: »Inalienable Wealth«, 1985; dies.: Inalienable Possessions, 1992; und dies.: »Cultural Difference and the Density of Objects«, 1994. 24 Vgl. Weiner: »The Reproductive Model in Trobriand Society«, 1976, S. 180-183. 25 Weiner: Inalienable Possessions, 1992, S. 8-12. 26 Ähnlich wie für Lévi-Strauss Gesellschaft dadurch entsteht, dass Männer, indem sie heiraten, untereinander Schwestern tauschen (Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft, 1981 [1949]), betont Weiner die enge Geschwisterbeziehung, den Grad, zu dem sich Männer sogar nach der Heirat weigern, ihre Schwestern aufzugeben (»Inalienable Wealth«, 1985). 27 Vgl. Weiner: »The Reproductive Model in Trobriand Society«, 1976; dies.: »Reproduction: A Replacement for Reciprocity«, 1980; und dies.: »Sexuality among the Anthropologists«, 1982. 28 Vgl. Gregory: »Gifts to Men and Gifts to God«, 1980; ders.: Gifts and Commodities, 1982. 29 Vgl. Strathem: »Culture in a Netbag«, 1981; dies.: »Subject or object?«, 1984; dies.: »Marriage Exchanges«, 1984; dies.: »Conclusion«, 1987; dies.: The Gender of the Gift, 1988; und dies.: »Qualified Value«, 1992.
- 30 Vermutlich beginnt sie mit Roy Wagners The Invention of Culture (1975), auch wenn sich das nicht mit Sicherheit sagen lässt. Ich stelle im Folgenden zum Beispiel Gregorys Bedeutung für Marilyn Stratherns Modelle heraus, obwohl Gregory selbst Stratherns frühen ethnographischen Arbeiten einen großen Einfluss auf sein eigenes Werk zuschreibt (Gregory: Savage Money, 1998, S. 10). 31 Prinzipielle Einwände gegen ein derartiges Projekt muten seltsam an. Die Gefahr liegt eher darin, das Modell mit der Wirklichkeit zu verwechseln und zum Beispiel der Deutung einer speziellen melanesischen Tauschform mit dem Argument zu widersprechen, »Melanesier« könnten nicht so denken - obwohl man zugeben muss, dass fast niemand, der ein solches Modell entwickelt (Strathern eingeschlossen), dieser Versuchung ganz zu widerstehen vermag. 32 Meiner Meinung nach stört sich die feministische Kritik vor allem daran, dass Strathern in einem 344-seitigen Werk über Gender dies erst auf Seite 325 offen ausspricht. 33 Strathern: The Gender of the Gift, 1988, S. 144-159. 34 Vgl. Josephides: Suppressed and Overt Antagonism, 1982; dies.: »Equal but different? The Ontology of Gender among the Kewa«, 1983; dies.: The Production of Inequality: Gender and Exchange among the Kewa, 1985; und Bloch: »The Symbolism of Money in Imerina«, 1990, S. 172. 35 Vgl. MacPherson: The Political Theory of Possessive Individualism, 1962. 36 Strathern: The Gender of the Gift, 1988, S. 142 [Hervorhebung des Verfassers, D.G.]. 37 Ebd., S. 142-143. 38 Mir ist nicht klar, welche der beiden Haltungen Strathern präferiert; vermutlich letztere, da es ziemlich eindeutige Hinweise gibt, dass auch die Melpa, die Stratherns wichtigstes Beispiel sind, einen einzigartigen kreativen Wesenskern kennen (vgl. A. Strathern: »Gender, Ideology and Money in Mount Hagen«, 1979). 39 Bei der Lektüre von Stratherns Schriften ist es hilfreich, sich ein kleines Glossar ihrer Terminologie anzulegen und sie in Begriffe zu übersetzen, wie sie ein etwas konventionellerer Wissenschaftler verwenden würde. Bei mir sind es zum Beispiel: entlocken - wahrnehmen; Wert - Bedeutung (oder Bedeutsamkeit); im Vergleich zu - im Unterschied zu; Anbindung - Verpflichtung; nötigen - überreden oder jemanden dazu bringen, sich zu etwas verpflichtet zu fühlen. 40 Diese Überlegung ist zum Teil einer besonderen Verwendung von »Grund« und »Ursprung« in der Melpa-Sprache geschuldet (vgl. Errington und Gewertz: »The Remarriage of Yebiwali«, 1987). Der Schenkende ist der »Grund« der Gabe, ihre »Quelle« bzw. ihr »Ursprung« ist das, was sie im jeweiligen Kontext veranlasst hat. Diese unterschiedlichen Quellen oder Ursprünge erklären auch, warum Schweine, die an sich gleich groß sind oder einander auch sonst körperlich gleichen, als verschieden betrachtet werden und verschiedenen Wert haben. 41 Nach Strathern unterscheiden die Melpa zwischen Arbeit und Tausch. Während sich in der Arbeit der unsichtbare »Geist« oder vielleicht der »Wille« einer Person ausdrückt, ist der Tausch die Veränderung von Objekten, die per se sichtbar sind, sich »auf der Haut« befinden. Deswegen können durch Tausch neue soziale Beziehungen entstehen, Arbeit dagegen kann nur die bestehenden festigen. 42 Gregory: Gifts and Commodities, 1982, S. 47-51. 43 Meggit: »From Tribesmen to Peasants«, 1971. 44 Gregory: Gifts and Commodities, 1982, S. 50. 45 Strathern: »Qualified Value«, 1992; Gewertz: Sepik River Societies, 1983. 46 Das sagt Gregory zwar gar nicht, aber das ist unwichtig, weil Strathern sagen könnte, dass er es eigentlich hätte tun sollen. 47 Strathern: »Conclusion«, 1987, S. 286. 48 Oder sogar, dass sie in einem historischen oder produktiven Verhältnis zueinander stehen. 49 Obwohl Menschen ständig so handeln, dürften die Aussichten gering sein, dass Sozial Wissenschaftler je die exakten Gründe ihrer Entscheidungen ermitteln, genauso wenig wie man ein theoretisches Modell wird entwickeln können, mit dem sich vorhersagen lässt, welche Erbstücke jemand wahrscheinlich aus einem brennenden Haus retten wird.
- 50 Beidelman: »Agnostic Exchange«, 1989; Bourdieu: Entwurf einer Theorie der Praxis, 1976. Während Herrschaft für das westliche Denken eher darin besteht, dass eine Partei eine andere in ihrer subjektiven Freiheit unterdrückt und sie am Handeln hindert, besteht sie (nach Strathern) für die Melanesier eher darin, andere zum Handeln zu bewegen. Deswegen nennt Strathern das Überreden -insbesondere das Überreden eines anderen zu einer Tauschhandlung - erstaunlicherweise einen Akt des »Zwangs«, so als wäre es die gröbste Gewalttat. 51 Munn: »The Spatiotemporal Transformations of Gawan canoes«, 1977; dies.: »Gawan Kula«, 1983; und dies.: The Farne ofGawa, 1986. 52 Munn: The Farne of Gawa, 1986, S. 11-12, 49-73. 53 Bzw. ihr »transformativer Wert«, wie Munn bisweilen sagt. 54 So bemerkt Strathern über die Schweinezucht in Mount Hagen: »Das Futter, mit dem die Ehefrau die Schweine aufzieht, wird auf einem Stück Land angebaut, das dem Clan des Ehemanns gehört, es wird vom Ehemann gerodet und von der Ehefrau bestellt, und nur eine von außen kommende Theorie der Ausbeutung von Arbeitskraft kann diese wechselseitigen Investitionen hierarchi-sieren.« (Strathern: The Gender of the Gift, 1988, S. 162-163) Diese Aufzählung von Einflussfaktoren ließe sich beliebig verlängern, etwa um die Energie, die in die Ernährung des Paares oder die landwirtschaftliche Ausbildung geflossen 55 Und wer es dennoch tut, beschäftigt sich eher mit ihrer phänomenologischen Methode als mit ihrer Werttheorie (z.B. Thomas: Entangled Objects, 1991; vgl. Weiss: The Making and the Unmaking of the Hay a Lived World, 1996, R. Foster: »Value without Equivalence«, 1990; ders.: Social Reproduction and History in Melanesia, 1995.) Drittes Kapitel Wert als die Bedeutsamkeit von Handlungen 1 Turner: »The Social Skin«, 1980; ders.: Value, Production and Exploitation in Non- Capitalist Societies, 1984; ders.: The Kayapo of Southeastern Para, 1987. 2 Turner: »Anthropology and the Politics of Indigenous Peoples' Struggles«, 1979; ders.: »Dual Opposition, hierarchy and value«, 1984. 3 Z. B. Turner: »The Ge and Bororo Societies as Dialectical Systems«, 1979, S. 171; ders.: »Animal Symbolism, Totemism, and the Structure of Myth«, 1985, S. 52. 4 Heraklits genaue Position zu bestimmen fällt der modernen Wissenschaft nicht leicht, weil seine Ideen aus Fragmenten oder Kurzfassungen zusammengestückelt werden müssen, die sich in den Werken späterer, ihm widersprechender Autoren erhalten haben. So ist nicht völlig klar, ob er jemals wirklich »Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen« gesagt hat. Kirk (.Herac- litus: The Cosmic Fragments, 1962) meint nein, Vlastos (»On Heraclitus«, 1970) und Guthrie (A History of Greek Philosophy, 1971, S. 488-492) meinen ja und behaupten, der Satz »Wer in dieselben Flüsse hinabsteigt, dem strömt stets anderes Wasser zu« entspreche nicht seinen ursprünglichen Worten. Die Diskussion geht aber, wie Jonathan Barnes bemerkt (The Presocratic Philosophers, 1982, S. 65-69, vgl. Guthrie: A History of Greek Philosophy, 1971, S. 449-450), ziemlich an der Sache vorbei, da diese spätere Randbemerkung tatsächlich eine korrekte Beschreibung von Heraklits Position ist, wie sich durch den Vergleich mit anderen Fragmenten rekonstruieren lässt (vor allem mit seiner Feststellung, dass der »Gerstentrank«, der aus Wein, Gerste und Honig bestand, »nur dann existierte, wenn er gerührt wurde«). Heraklit leugnete nicht die kontinuierliche Existenz von Objekten in der Zeit, hob aber hervor, dass sie alle letztlich Ver- änderungs- und Tranformationsmuster seien. Die erstgenannte Interpretation wurde offenbar durch Piatons Kratylos populär, wo sich die Behauptung findet, man könne, wenn Heraklit Recht habe, keinem Ding je einen Namen geben, da es ja keine fortdauernde Existenz habe (McKirahan, Philosophy Before Socrates, 1994, S. 143). 5 Heraklit wiederum war der geistige Vorfahr von Demokrit, dem Begründer des Atomismus, der behauptete, alle Objekte könnten in unteilbare, sich ständig bewegende Einheiten zerlegt werden. Marx, der via Hegel auf diese Tradition zurückgriff, schrieb seine Dissertation über Demokrit. 6 Ricoeur: Geschichte und Wahrheit, 1974, S. 195-196. Vgl. Sahlins: Kultur und praktische Vernunft, 1981, S. 121, Fußnote 21.
- 7 Diesem »epistemischen Irrtum« unterliegt seiner Ansicht nach der Großteil der westlichen Philosophie; zwei Hauptschuldige in diesem Zusammenhang seien Descartes und Hume. 8 Vielleicht ist das einer der Gründe, weshalb die Marx'sehe Dialektik, in wie revidierter Form auch immer, so große Anziehungskraft entwickeln konnte. Jedenfalls betrachtete Hegel Modelle als relativ »abstrakt« und daher »einseitig« und unvollständig im Vergleich mit den »konkreten Totalitäten« der Realität. Die gesamte dialektische Tradition geht davon aus, dass Objekte immer komplexer sind als jede Beschreibung, die wir von ihnen anfertigen können. 9 Bhaskar: The Possibility of Naturalism, 1979; ders.: Scientific Realism and Human Emancipation, 1986; ders.: Reclaiming Reality, 1989; ders.: Philosophy and theldea of Freedom, 1991; ders.: Dialectic: The Pulse of Freedom, 1993; ders.: Plato etc., 1994; Collier: Critical Realism, 1994. Archer: Critical Realism, 1998. 10 Was übrigens nicht bedeutet, dass solche Ereignisse nicht ex post facto erklärt werden können; Bhaskar widerspricht auch der positivistischen Annahme, Erklärung und Vorhersage seien letztlich dasselbe bzw. sollten es sein. 11 Mit dem Kauf der Arbeitskraft erhält der Kapitalist letzten Endes natürlich die »konkrete Arbeit«, egal was er seinen Arbeitern tatsächlich aufträgt, und zieht daraus Profit, weil Arbeiter unter dem Strich viel mehr als die reinen Kosten der Reproduktion ihrer Arbeitskraft produzieren können; das spielt hier aber im Moment keine Rolle. 12 Dies alles ist nur möglich, weil es Standards für das gibt, was Marx die »sozial notwendige Arbeitszeit« nennt, die zur Herstellung einer bestimmten Sache erforderlich ist, also kulturelle Übereinkünfte über den Grad an Anstrengung, Organisation usw., die bestimmen können, was als vernünftige Dauer gilt, innerhalb derer eine bestimmte Aufgabe erfüllt wird. Das Ganze wird auf S. 53-54 des Kapitals Bd. 1, 1968, in aller Klarheit dargelegt. 13 Das trifft schon dann zu, wenn man mit einem Begriff wie »Arbeit« (also einem kulturbedingten Begriff) operiert, und erst recht, wenn man einen abstrakteren Begriff wie »kreative Energie« verwendet, der an sich unquan-tifizierbar ist. Man kann schon deshalb nicht sagen, eine Gesellschaft habe eine feststehende Menge davon, die dann im bekannten ökonomischen Sinn vom »Sparen« knapper Güter aufgeteilt werden müsste, weil die Menge des in Umlauf befindlichen kreativen Potentials nie vollständig realisiert wird. Eine Gesellschaft, in der alle ständig bis an die Grenzen ihrer geistigen und körperlichen Möglichkeiten produzieren, lässt sich schwer auch nur vorstellen, und ganz bestimmt würde niemand freiwillig in ihr leben. 14 Marx: Die deutsche Ideologie, 1969, S. 28-31. 15 Ebd., S. 30. 16 Marx: Das Kapital, Band I, 1968, S. 193. 17 Turner: Value, Production and Exploitation in Non-Capitalist Societies, 1984, S. 11. Fajans: »Exchanging Products: Producing Exchange«, 1993, S. 3. 18 Und zwar kraft seiner Identität oder schlicht durch Lernen oder aber indem er sich bestimmte Fähigkeiten im Verlauf des Handlungsprozesses aneignet. »Indem er durch diese Bewegung auf die Natur außer ihm wirkt und sie ver- ändert, verändert er zugleich seine eigne Natur.« (Marx: Das Kapital, Band I, 1968, S. 192.) 19 Natürlich ist man sich bei vielen Alltagshandlungen nicht einmal dessen richtig bewusst. Aber Turner konzentriert sich wie Marx auf Handlungen, bei denen man sich seiner selbst so sehr bewusst ist, dass man ihre Grenzen ausloten kann. 20 Vgl. Taussig: »Maleficium: State Fetishism«, 1993. 21 Die freudianischen natürlich auch. Vielleicht werden beide Ansätze deshalb so oft als ungemein mächtige kritische Methoden betrachtet. 22 Eines falschen allerdings insofern, als die Träger dieses unvollständigen Bewusstseins seine Unvollständigkeit nicht erkennen. 23 Piaget: Der Strukturalismus, 1973. Turner: »Piaget's Structuralism«, 1973. 24 Piaget zufolge beging der Strukturalismus in den Sozialwissenschaften einen gravierenden Fehler, als er Saussures Linguistik als Modell übernahm, weil die Sprache so gut wie die einzige soziale Ausdrucksform ist, die auf einem ganz und gar arbiträren Kode basiert, der sich damit völlig
- abseits jeder Praxis befindet. Nur deshalb lässt sich ja Saussures berühmte Unterscheidung zwischen langue und parole überhaupt treffen. In fast jedem anderen Bereich menschlichen Handelns könnte man unmöglich von einem »Kode« auch nur sprechen, ohne Bezug auf die Praxis zu nehmen (Piaget: Der Strukturalismus, 1973, S. 74-76). 25 Beispielsweise Sahlins: Kultur und praktische Vernunft, 1981, S. 177, Fußnote 49. Bloch: »The Ritual of the Royal Bath in Madagascar«, 1989, S. 115-116) zeigt sich nur ein klein wenig großzügiger. 26 »(...) zunächst aus senso-motorischer Handlung, dann aus praktischer und technischer Intelligenz, während erweiterte Denkformen diesen aktiven Charakter in der Beschaffenheit von Operationen wiederentdecken, die wirkungsvolle und objektive Strukturen zwischen ihnen bilden.« [Sociological Studies, 1995, S. 282.) Wie viele solcher Autoren entwickelt Piaget seine eigene Terminologie, die man sich erst mühsam aneignen muss, wenn man sie vollständig beherrschen will. 27 Piaget: Der Strukturalismus, 1973, S. 34. 28 Bourdieu: Entwurf einer Theorie der Praxis, 1976. 29 Vygotsky: Mind in Society, 1978, S. 79-91. Abgeleitet von einer pädagogischen Theorie mit der Prämisse, dass Kinder immer in der Lage sind, auf einer Stufe Tätigkeiten zu erlernen bzw. überhaupt zu operieren, die einen Schritt weiter ist als die, die sie selbst erklären können bzw. vollkommen internalisiert haben. 30 Victor Turner: The Forest of Symbols, 1967. 31 Turner: »Transformation, Hierarchy and Transcendence«, 1977; ders.: The Poetics ofPlay, 1993, S. 22-26. 32 Turner (»Anthropology and the Politics of Indigenous Peoples' Struggles«, 1979, S. 32) stellt fest: In unserer Gesellschaft wird in Bezug auf Hochzeiten üblicherweise davon ausgegangen, dass die individuelle Ehe zwar zwischen zwei realen Menschen geschlossen wird, die Institution der Ehe aber von Gott geschaffen wurde. 33 Oilman, Alienation, 1971. 34 Vgl. Turner und Fajans, Where the Action Is, 1988. Piaget selbst ging nie ausführlich auf die Parallelen zwischen seinen Anschauungen und denen von Marx ein (vgl. allerdings »Egocentric and Sociocentric Thought«, in: Sociological Studies, 1995, S. 276-86), sah sich jedoch klar in derselben dialektischen Tradition. Dass der Egozentrismus meist eine ähnliche Umkehrung von Subjekt und Objekt beinhaltet, wie Marx sie als typisch für den Fetischismus erachtete, ist ein immer wiederkehrendes Thema in Piagets Werk. So macht er beispielsweise die interessante Beobachtung, dass Kinder systematisch dazu neigen, fast jeden Bestandteil der physischen Welt so zu beschreiben, als wäre er von einer wohlwollenden Intelligenz zu ihrem Nutzen geschaffen worden - was aus marxistischer Sicht natürlich gar nicht so falsch ist, da ja genau die Instrumente, mittels derer alles in der uns umgebenden Welt zu unserem Nutzen entworfen wurde, durch den Markt unsichtbar gemacht werden, was bei vielen Erwachsenen zu einer ganz ähnlichen Einstellung führt. 35 Vgl. Piaget: Der Strukturalismus, 1973, S. 112-113. 36 Z.B. Hallpike: The Foundations of Primitive Thought, 1979. 37 In diesem Fall der, fachsprachlich gefasst, »abstrakten Arbeit« bzw. der Wert der Arbeitskraft des Arbeiters, deren Entstehung in der Sphäre des Hauswesens von der Produktionssphäre aus betrachtet praktisch unsichtbar ist, so wie die Arbeit, durch die das Produkt erzeugt wurde, von der anderen Seite her unsichtbar wird (vgl. untenstehendes Diagramm). 38 Vgl. Turner: »Anthropology and the Politics of Indigenous Peoples' Struggles«, 1979, S. 20- 21. 39 Turner: Value, Production and Exploitation in Non-Capitalist Societies, 1984. 40 Turner: »Anthropology and the Politics of Indigenous Peoples' Struggles«, 1979. 41 Fajans: »The Alimentary Structures of Kinship«, 1993; dieselbe: They Make Themselves, 1997; Turner und Fajans: Where the Action Is, 1988. 42 Die einzige Ausnahme bilden kunstvolle, wunderschöne Maskeraden, über deren Bedeutung die Baininger allerdings keine Auskunft geben; das Ganze wird von ihnen als »nur ein Spiel«
- abgetan. Nebenbei möchte ich anmerken, dass die Baininger innerhalb des Spektrums der anarchistischen Gesellschaften am äußersten kollektivistischen (im Gegensatz zum individualistischen) Ende anzusiedeln sind. 43 Fajans: »The Alimentary Structures of Kinship«, 1993, S. 59-75; dieselbe: They Make Themselves, 1997, S. 75-78, 88-100. 44 Dieser Rückgriff erfolgte beispielsweise in der Debatte innerhalb der russischen Psychologie über die kleinsten Analyseeinheiten, angefangen bei Vygotsky, und durchzog auch die spätere »Tätigkeitstheorie« (vgl. Turner und Fajans: Where the Action Is, 1988). 45 Turner spricht bekanntlich von der »kleinsten modularen Artikulationseinheit«, was zugegebenermaßen nicht besonders elegant klingt. Turner zufolge ist die Beschäftigung mit der kleinsten Struktureinheit eine mögliche Erklärung für Marx' Vorgehensweise im Kapital, wo die Fabrik eine ähnliche Funktion erfüllt. 46 Turner: »Kinship, Household and Community Structure among the Kayapo«, 1979; ders.: »The Social Skin«, 1980; ders.: Vahle Production and Exploitation in Non-Capitalist Societies, 1984; ders.: »Dual Opposition, hierarchy and value«, 1984; ders.: The Kayapo of Southeastern Para, 1987. 47 Turner: The Kayapo of Southeastern Para, 1987, S. 25-28. 48 »Schönheit« schreiben die Kayapó Dingen oder Handlungen zu, die insofern vollständig sind, als sie ihre wesenhafte Beschaffenheit, ihr Potential oder ihren intendierten Zweck vollkommen verwirklichen. »Vollständigkeit« hat also diesem Verständnis nach sowohl die Konnotation »Perfektion« als auch, auf Handlungen bezogen, die Konnotation »Geschicklichkeit«. Eine ordnungsgemäß und vollkommen durchgeführte zeremonielle Handlung ist »schön«, aber die Fähigkeit, bestimmte der für die Gesellschaft wichtigsten und am höchsten spezialisierten Funktionen zu erfüllen - etwa das Verteilen der angesehensten Wertgegenstände -, ist nicht gleichmäßig in der Gesellschaft verbreitet. (Turner: The Kayapo of Southeastern Para, 1987, S. 42.) 49 Der mit »Häuptling« übersetzte Begriff lautet wörtlich »die, die singen dürfen«. 50 Turner: Value, Production and Exploitation in Non-Capitalist Societies, 1984. 51 Der neue Status des Paars kann als Anteil an der gesamten sozialen Arbeitszeit, gemessen anhand besagter Zeiteinheiten, betrachtet werden, wenn auch, in diesem Fall, in einem wesentlich weniger komplizierten Sinn. Der Grund dafür ist, dass die jungen Erwachsenen die Produkte zweier, die Älteren aber dreier aufeinanderfolgenden Zyklen der sozialen Produktion sind. 52 Myers: Pintupi Country, Pintupi Seif, 1986. 53 Turner: The Kayapo of Southeastern Para, 1987, S. 28. Was übrigens nicht heißt, dass alle Wertsysteme sozial ungerecht sein müssen; es heißt nur, dass eine Unterscheidung vorgenommen werden muss. Der Vergleich könnte ebenso gut mit einem zeitlichen Bezug angestellt werden, etwa zwischen einem früheren Zustand, in dem man besagten Wert noch nicht besaß, und einem zukünftigen, in dem man ihn vielleicht nicht mehr hat. 54 Turner: »Anthropology and the Politics of Indigenous Peoples' Struggles«, 1979, S. 31-34. 55 In den meisten Gesellschaften fühlen sich die Menschen auch nicht selbst verantwortlich dafür. 56 Ein Prozess, der, wie wir gesehen haben, in den meisten Fällen emergente Eigenschaften aufweist, die den beteiligten Akteuren nicht völlig begreifbar sind. Dies ähnelt Roy Bhaskars »Transformationsmodell sozialen Handelns« (Bhaskar: The Possibility of Naturalism, 1979, S. 32- 41), auch wenn dieses wesentlich weiter gefasst ist. 57 Strathern räumt das in gewisser Hinsicht ein, wenn sie sagt, dass die »ästhetischen« Regeln, denen zufolge bestimmte Sachen als wertvoll gelten und andere nicht, in einer Schenkökonomie meist unsichtbar werden. Das, so Strathern, mache sie zum Gegenteil einer Warenökonomie, in der nur die äußere Form der Objekte hervorgehoben werde, während die an ihnen beteiligten menschlichen Beziehungen verschwänden. Diese Behauptung ist meiner Meinung nach zwar faszinierend, ja geradezu brillant, weicht aber der Frage aus, wie der ästhetische Kodex überhaupt erst geschaffen und reproduziert wird. Dieses Ausweichen ist aber wohl unvermeidlich, wenn man bedenkt, dass die britische
- Tradition der Sozialanthropologie, aus der Strathern kommt, immer auf eine klare Unterscheidung zwischen »Kultur« im Sinne eines aus Ausdrucksbedeutungen bestehenden Komplexes und »Gesellschaft« im Sinne eines aus interpersonalen Beziehungen bestehenden Netzwerks gepocht hat, während »Kultur« und »Gesellschaft« in der Tradition der amerikanischen Sozialanthropologie gemeinhin als zwei Aspekte ein und derselben Sache betrachtet werden. Strathern kann weder mit »Gesellschaft« noch mit »Kultur« als eindeutigem Begriff viel anfangen, reproduziert dann aber die Unterscheidung, indem sie differenziert zwischen den sozialen Beziehungen, die die Menschen bewusst zu reproduzieren versuchen, und den verborgenen »Konventionen der Verdinglichung«, die festlegen, welche Formen (ein Schwein, eine Muschel, ein Frauenkörper) bestimmte Arten von sozialen Beziehungen verkörpern können und welche nicht (vgl. z.B. Leach: Political Systems of Highland Burma, 1954). 58 Oder, eher wahrscheinlich, verschiedene Totalitäten, die auf unterschiedlichen sozialen Ebenen existieren. 59 Turner: Value, Production and Exploitation in Non-Capitalist Societies, 1984, S. 56-58. 60 Wie das Beispiel verdeutlichen soll, ist hier nicht nur von den physischen Eigenschaften der Medien die Rede (obwohl diese durchaus stark ins Gewicht fallen), sondern auch von der Art und Weise ihrer Nutzung. »Abstraktion« ist keine physische Eigenschaft. 61 Das ist natürlich stark vereinfacht. Im Grunde verschmelze ich alle möglichen sozialen Organisationen, in denen Menschen sich persönlich realisieren, zur »Sphäre des Hauswesens« und ignoriere die Tatsache, dass die schulische Bildung außerhalb des Hauses stattfindet usw. Solche Simplifikationen sind aber manchmal nützlich, solange man sie nicht mit der Wirklichkeit verwechselt. 62 Turner: »Anthropology and the Politics of Indigenous Peoples' Struggles«, 1979, S. 34-35. 63 Alle anderen, weniger theatralischen Handlungen, die dabei im Spiel sind, werden, um es mit Strathern zu sagen, von ihnen »in den Hintergrund gedrängt«. 64 Vgl. Turner: »Transformation, Hierarchy and Transcendence«, 1977, S. 59-60. 65 Bourdieu: Entwurf einer Theorie der Praxis, 1976. 66 Bloch: »Death, Women and Power«, 1982. 67 Wilson: »Witch Beliefs and Social Structure«, 1970. 68 Graeber: »Dancing with Corpses Reconsidered«, 1995. 69 Bei den Bainingern handelt es sich offenbar um ungewöhnlich nonindividualistische Egalitaristen, und für die Kayapö scheint Egalitarismus keine besonders große Rolle zu spielen. 70 Z. B. Meillassoux: Die wilden Früchte der Frau, 1976; Godelier: Ökonomische Anthropologie, 1973. 71 Und zwar fast per definitionem, da Staaten normalerweise durch die systematische Anwendung von Gewalt definiert sind. 72 Turner: The Kayapo of Southeastern Para, 1987. 73 Turner: »Kinship, Household and Community Structure among the Kayapo«, 1979, S. 210. 74 Turner: »The Kayapo of Central Brazil«, 1978; ders.: »Anthropology and the Politics of Indigenous Peoples' Struggles«, 1979, S. 1-43. Vgl. Myers und Brenneis: »Introduction: Language and Politics in the Pacific«, 1991, S. 4-5. 75 Dumont hat es ganz offensichtlich mit Hierarchien und hält die modernen, individualistischen/egalitären Gesellschaften in gewisser Hinsicht für abnormal oder gar pervers - meint gleichzeitig aber wohl, dass es unmöglich ist, sie loszuwerden (vgl. Robbins: »Equality as a Value«, 1994, S. 21-70, vor allem sein amüsantes Fazit: »Was will Dumont eigentlich?«). 76 Vgl. Turner: The Poetics of Play, 1993. Viertes Kapitel Handlung und Reflexion, oder Annäherung an eine Theorie des Reichtums und der Macht 1 Dorfman und Mattelart: Walt Disneys »Dritte Welt«, 1977, S. 61-62. 2 Leach: Political Systems of Highland Burma, 1954, S. 142. 3 Munn: The Farne ofGawa, 1986, S. 55-73, 111-118. 4 Foucault: Überwachen und Strafen, 1977, S. 221-250.
- 5 Ebd., S. 241. 6 Ebd., S. 248. 7 Ebd., S. 241-244. 8 In der ethnologischen Literatur zum Thema »Meidungsbeziehungen« und zu formalen Gehorsamsbeziehungen überhaupt stößt man immer wieder darauf, dass Autoritätspersonen nicht offen bzw. überhaupt nicht angesehen werden durften, zumindest nicht, bevor sie den anderen angesehen hatten. Dieses Prinzip taucht in der einen oder anderen Form vermutlich überall auf - obwohl es auch Situationen gibt, in denen der Blick auf solche Personen wiederum erwartet wird. Vgl. Graeber: »Manners, Deference and Private Property«, 1997. 9 Zitiert in Silverman: »Fragments of a Fashionable Discourse«, 1985. 10 Turner: »The Social Skin«, 1980, S. 50-56. 11 Berger: Sehen, 1976, S. 43. 12 Ebd. 13 Daher, so Berger, auch das bildnerische Stereotyp der sich im Spiegel betrachtenden Frau. 14 Lacan: »Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion«, 1991. 15 Tylor: Die Anfänge der Cultur, 1873, S. 423-450. 16 Hobbes: Leviathan, 1996, S. 537; vgl. Pye: »The Sovereign, the Theatre, and the Kingdom of Darkness«, 1984. 17 Ein aufschlussreiches Beispiel findet sich in Nancy Munns Analyse der auf Gawa herrschenden Vorstellung von »Schönheit« und deren Rolle beim Kula-Tausch (Munn: The Fame of Gawa, 1986, S. 101-103). Bei den Gawanern, so Munn, gilt die Zurschaustellung an sich als etwas Überzeugendes: »Der verschönerte Mensch überzeugt, indem er seine Überzeugungskraft als sichtbare Fähigkeit seines Ichs zeigt« (S. 103). In diesem Fall sollen andere dazu gebracht werden, dem verschönerten Menschen Kula-Wertgegenstände zu schenken -Schmuckobjekte wie die, mit denen man sich selbst verschönert. Diese Analyse stimmt mit der Untersuchung der aristokratischen Zurschaustellung weiter unten vollkommen überein. 18 Berger: Sehen, 1976, S. 44. 19 Zumindest lautet so das aristokratische Ideal. In Wirklichkeit hat sich natürlich kein König jemals ausschließlich auf die Zurschaustellung verlassen, um seine Autorität zum Ausdruck zu bringen. Solche Methoden funktionieren nur in Verbindung mit aktiveren Formen des Überzeugens. Mir ist durchaus bewusst, dass die theoretischen Dichotomien, die ich hier entwerfe, wie die meisten theoretischen Dichotomien nirgends in Reinform existieren - dass die Ausübung von Macht in der Realität immer die Fähigkeit erfordert, sowohl auf andere einzuwirken als auch sich selbst zu definieren. Aber es gibt Abstufungen. Und natürlich identifizieren sich bestimmte Menschentypen - ob nun bürgerliche Männer, Feudalherrscher oder was auch immer - mit bestimmten charakteristischen Arten der Machtausübung mehr (oder werden mehr damit identifiziert) als mit anderen. 20 Weber: Wirtschaft und Gesellschaft, 1976, S. 298-299. 21 Turner und Fajans: Where the Action Is, 1988. 22 Marx: Das Kapital, Bd. % 1968, S. 56-61. 23 Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie, 1971, S. 104-114. 24 Ebd., S. 108, Hervorhebung im Original. 25 Engels: Der Ursprung der Familie«, 1975, S. 161. 26 Shell: The Economy of Literature, 1978, S. 62. 27 Ebd. 28 Ebd., S. 21, Fußnote 25. 29 Vernant: Myth and Thought among the Greeks, 1983, S. 54. 30 Finley: Die antike Wirtschaft, 1993, S. 195-199; Austin und Vidal-Naquet: Gesellschaft und Wirtschaft im alten Griechenland, 1984. 31 Finley weist darauf hin, dass »kein Geldwechsler [...] einen besseren Kurs für ein syrakusanisches Vier-Drachmen-Stück [gab], nur weil es von [dem berühmten Künstler] Euainetos signiert war«. Die antike Wirtschaft, 1993, S. 196.
- 32 Oder die Dominanz hinter der Schönheit usw. 33 Wer in den Spiegel schaut, sieht das Bild seiner selbst in einem Objekt. Es besteht demnach eine unmittelbare Ähnlichkeit zwischen einem Spiegelbild und dem »Schmuck der Person« in dem von mir gemeinten Sinn des Wortes: Beides stellt eine Erweiterung des Ichs oder der Person in einem außerhalb des Körpers befindlichen Gegenstand dar, die nur erkannt werden kann, indem sie gesehen wird. (Zu Glasperlen und Spiegeln vgl. Comaroff: Ethnography and the Historical Imagination, 1992, S. 170-197; Hamell: »Trading in Metaphors«, 1983.) 34 Ong: Interfaces of the Word, 1977, S. 121-144. 35 Vérin: The History of Civilisation in North Madagascar, 2004. 36 Madagaskar wurde als Quelle von Arbeitskräften für europäische Plantagen in Mauritius und Réunion ausgebeutet. 37 Perlen waren zu dieser Zeit im Imerina offenbar nicht mehr als Tauschmedium in Gebrauch - wenn sie es dort überhaupt je gewesen waren. 38 Edmunds: »Charms and Superstitions in Southeast Imerina«, 1897. 39 Ellis: History of Madagascar, 1838, Bd.2, S. 302-303. 40 Ebd., S. 304. 41 Vgl. Edmunds: »Charms and Superstitions in Southeast Imerina«, 1897. 42 Berg: »Royal Authority and the Protector System«, 1986. 43 Vgl. Callet: Tantara ny Andriana eto Madagascar, 1908, S. 179, 190-191. 44 Vgl. Bernard-Thierry: »Perles magiques à Madagascar«, 1959, S. 84. 45 Délivré: L'histoire des rois d'Imerina, 1974, S. 144-145. 46 Vig: Charmes, 1969, S. 59-60; Callet: Tantara ny Andriana eto Madagascar, 1908, S. 84; vgl. Ruud: Taboo, 1960, S. 218. 47 Callet: Tantara ny Andriana eto Madagascar, 1908, S. 82-85. 48 Ottino: »La mythologie malgache des Hautes Terres«, 1981, S. 36. 49 Vig: Charmes, 1969, S. 70-72. 50 Ebd., S. 71. 51 Richardson: A New Malagasy-English Dictionary, 1885, S. 591. 52 Die Bezeichnung dafür lautete volatsy vaky. Wie erinnerlich, wurde Geld normalerweise in kleinere Teile zerstückelt. 53 Callet: Tantara ny Andriana eto Madagascar, 1908, S. 51-52. 54 Vgl. Sibree: Madagascar. The Great African Island, 1880, S. 302-303. 55 Ellis: History of Madagascar, 1838,1. Bd., S. 435. 56 Callet: Tantara ny Andriana eto Madagascar, 1908, S. 56; Chapus und Rat-simba: Histoires des Rois, 1953, S. 91, Fußnote 134. 57 Vgl. Berg: »Royal Authority and the Protector System«, 1986; Bloch: »The Ritual of the Royal Bath«, 1989. 58 Das gilt für die tatsächliche Geschichte des Objekts wie für die Geschichte, die ihm von denjenigen zugeschrieben wird, die es als wertvoll erachten. 59 Ich würde nicht behaupten, dass alles Begehren zwingend fetischistisch ist. Vielleicht wird man sogar irgendwann eine Unterscheidung zwischen metaphorischem und metonymischem Begehren treffen können. Dann würde das begehrte Objekt nur beim Erstgenannten eine imaginäre Repräsentation der Ganzheit des Besitzer-Ichs werden. Räumte man die Möglichkeit der zweiten Art von Begehren ein, dann ließe sich auch die Möglichkeit des Wunsches in Betracht ziehen, sich mit anderen Menschen oder Dingen aufgrund ihrer tatsächlichen Unterschiede statt aufgrund ihrer imaginierten Ähnlichkeiten zu vereinen. Dies stünde in Einklang mit Lacans Denken: Er behandelte das Imaginäre oder »Spiegelhafte« als eine nachrangige, präödipale Stufe des Begehrens im Vergleich zur stärker indexikalisch geprägten, die mit der Sprache einhergeht. 60 Turner: Value, Production and Exploitation in Non-Capitalist Societies, 1984. Fünftes Kapitel Wampum und soziale Kreativität bei den Irokesen 1 Hamell: »Trading in Metaphors: The Magic of Beads«, 1983. 2 Ceci: The Effect of European Contact and Trade on the Settlement Pattern of the Indians in
- Coastal New York, 1977; dies.: »The Value of Wampum among the New York Iroquois«, 1982; und Beauchamp: Wampum and Shell Articles Used by the New York Indians, 1901. 3 Weeden: Indian Money as a Factor in New England Civilization, 2009 [1884]; Martien: Shell Game: A True Account of Beads and Money in North America, 1996. 4 »Mohawk« geht auf ein algonkisches Wort zurück, das »Menschenfresser« bedeutet. »Irokese« scheint sich von einem Wort für »Mörder« abzuleiten. 5 Zu dieser Zeit spielte Wampum bei den Siedlern keine Rolle mehr als Zahlungsmittel: Etwa von 1652-1654 an wurde es in den englischen Kolonien nicht mehr als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt. Die Holländer verwendeten es weiterhin, doch dann begannen die Engländer, die Bestände gegen Felle und holländische Waren zu verschleudern, um in Neu-Niederlande eine gewaltige Inflation herbeizuführen. 6 Thwaites (Hg.): The Jesuit Relations and Allied Documents: Travels and Explorations of the Jesuit Missionaries in New France, 1610-1791, 1970 [1896-1901], Bd. 22, S. 287-289. Ä 7 Goldenweiser: »On Iroquois Work 1912«, 1914; ders.: »On Iroquois Work 1913-14«, 1914; Parker: »An Analytical History of the Seneca Indians«, 1926; Shimony: Conservatism among the Six Nations Iroquois Reservation, 1961; Heidenreich: Huronia: A History and Geography of the Huron Indians 1600-1650, 1971, S. 371-372. Zu den Huronen vgl. Tooker: An Ethnography of the Huron Indians, 1615-1649, 1964, S. 44-45. 8 Zumindest bei den Huronen gab es einen Aspekt der »Seele« einer Person, der angeblich wiedergeboren wurde, wenn der Name wiederauferstand; ein anderer stieg in die Unterwelt hinab in ein Totendorf, vgl. Heidenreich: Huronia, S. 374-375. In irokesischen Quellen war dazu nichts Entsprechendes zu finden. 9 Fenton: »An Iroquois Condolence Council for Installing Cayuga Chiefs in 1945«, 1946, S. 116. 10 Hewitt und Fenton: »The Requickening Address of the Iroquois Condolence Council«, 1944, S. 65-66; Beauchamp: Wampum and Shell Articles; Fenton: »An Iroquois Condolence Council«, 1946, S. 118; Druke: »The Concept of Per-sonhood in Seventeenth and Eighteenth Century Iroquois Ethnopersonality«, 1980. 11 Später kam noch eine sechste Nation dazu, die Tuscarora, allerdings in untergeordneter Stellung und ohne Stimmrecht. 12 Richter: »War and Culture: the Iroquois Experience«, 1983; ders.: The Ordeal of the Longhouse: The Peoples of the Iroquois League in the Era of European Colonization, 1992, S. 32- 38. 13 Richter: The Ordeal of the Longhouse, 1992, S. 35. 14 Starna und Watkins: »Northern Iroquoian Slavery«, 1991. 15 Quain: »The Iroquois«, 1937. 16 Vgl. Lafitau in Fenton: »Northern Iroquois Culture Patterns«, 1978, S. 315. 17 Wir erfahren nicht, ob dies dadurch geschah, dass man ihm den Namen des Opfers gab (wie bei den Huronen) oder einen Gürtel. 18 Smith: »Wampum as Primitive Valuables«, 1983, S. 236; Morgan: League of the Ho-de'-no- sau-nee, or Iroquois, 1962 [1851], S. 331-334; Parker: An Analytical History of the Seneca Indians, 1926. 19 Eric Wolf geht ausführlich darauf ein, dass es keine größere Auseinandersetzung gab, bei der alle Nationen des Bundes auf derselben Seite standen. Wolf: Die Völker ohne Geschichte: Europa und die andere Welt seit 1400,1986 [1982], S. 240-244. 20 Vgl. Beauchamp: Wampum and Shell Articles, 1901; Smith: »Wampum as Primitive Valuables«, 1903, S. 231-232. War kein Wampum verfügbar, konnten andere Geschenke wie Beile oder Biberfelle als Ersatz dienen (vgl. Snyderman: »The Functions of Wampum«, 1954, S. 474; Druke: »Iroquois Treaties: Common Forms, Varying Interpretations«, 1985). Das Entscheidende war, dass irgendein Gegenstand den Besitzer wechseln musste. Alle Quellen stimmen jedoch darin überein, dass das angemessene Geschenk Wampum war; wenn eine Partei bei Verhandlungen kein Wampum zur Hand hatte, wurden Stöcke als Pfand für das später nachzureichende Wampum
- übergeben. 21 Brice iifHolmes: »Art in Shell of the Ancient Americans«, 1883, S. 242. 22 Heckewelder: Nachricht von der Geschichte, den Sitten und Gebräuchen der Indianischen Völkerschaften, welche ehemals Pennsylvanien und die benachbarten Staaten bewohnten, 1821, S. 133. 23 Vgl. Michael K. Foster: »Another Look at the Function of Wampum in Iroquois-White Councils«, 1985. 24 Vgl. Tooker: The Iroquois Ceremonial of Midwinter, 1970, S. 7; Chafe: Seneca Thanksgiving Rituals, 1961. 25 Die förmlichen Ansprachen standen möglicherweise bis zu einem gewissen Grad unter missionarischem Einfluss (Gespräch mit W. Fenton, 1999), aber auf die eine oder andere Weise kann man jedes irokesische Ritual als Dankesritual auffassen. 26 Hamell: »Trading in Metaphors: the Magic of Beads«, 1983. 27 Ebd., S. 19. 28 Scarry: Der Körper im Schmerz. Die Chiffren der Verletzlichkeit und die Erfindung der Kultur, 1992 [1985]. 29 Vgl. Converse: Myths and Legends of the New York State Iroquois, 1974 [1908]; Hale: The Iroquois Book of Rites, 1963 [1883]; Hewitt: »Legend of the Founding of the Iroquois League«, 1892; Parker: The Constitution of the Five Nations, or the Iroquois Book of the Great Law, 1916. Zwei Untersuchungen mit ausführlichen Hintergrundinformationen zu den verschiedenen überliefer- ten Versionen aus jüngerer Zeit sind Dennis: Cultivating a Landscape of Peace: Iroquois-European Encounters in Seventeenth-Century America, 1993, Kapitel 3; Fenton: The Great Law and the Longhouse: A Political History of the Iroquois Confederacy, 1998, Kapitel 5-6. 30 Vgl. Hewitt: »Legend of the Founding of the Iroquois League«, 1892, S. 138-140. 31 Vgl. Hale: The Iroquois Book of Rites, 1965 [1883]; Hewitt: »The Requicken-ing Address of the Iroquois Condolence Council«, 1944; Parker: »An Analytical History of the Seneca Indians«, 1926; Tooker: »The League of the Iroquois: Its History, Politics, and Ritual«, 1978, S. 437-440. 32 Hale: The Iroquois Book of Rites, 1963 [1883], S. 54-55. 33 Loskiel: Geschichte der Mission der evangelischen Brüder unter den Indianern in Nordamerika, 1789, S. 38; vgl. Parker: The Constitution of the Five Nations, 1916, S. 48. 34 Morgan: League of the Ho-dee-no-sau-nee, or Iroquois, 1962 [1851], S. 120-121; vgl. Druke: »Iroquois Treaties«, 1985. 35 Ein lila Gürtel war doppelt so viel wert wie ein weißer, da lila Perlen seltener waren. Beim Handel mit den Europäern galt weiterhin das Prinzip von Angebot und Nachfrage, deshalb waren weiße Perlen weniger wert, obwohl sie aus irokesischer Sicht den höchsten Wert darstellten. Im Lauf der Zeit erhielten sie auch die meisten Felle als Tribut. 36 Holmes: »Art in Shell of the Ancient Americans«, 1883, S. 244. 37 Vgl. Michelson: »Upstreaming Bruyas«, 1974; Fenton: The Great Law and the Longhouse, 1998, S. 128; Beauchamp: »Wampum Used in Council and as Currency«, 1898, S. 11. 38 Vgl. Morgan: League of the Ho-de'-no-sau-nee, or Iroquois, 1962 [1851], S. 387-388. 39 Parker: The Constitution of the Five Nations, 1916, S. 37. 40 Vgl. Morgan: League of the Ho-de'-no-sau-nee, or Iroquois, 1962 [1851], S. 333. 41 Hewitt: »Legend of the Founding of the Iroquois League«, 1892, S. 146-148. 42 Hallowell: »The Ojibwa Self in its Behavioral Environment«, 1967, S. 177. 43 Ebd., S. 180, Hervorhebung im Original. 44 Davon gehen sowohl Hallowell als auch Tooker aus. Vgl. Hallowell: »Ojibwa Ontology, Behavior, and World View«, 1960, S. 52; Tooker: »The League of the Iroquois: Its History, Politics, and Ritual«, 1978. 45 Chafe: Seneca Thanksgiving Rituals, 1961, S. 17-24. 46 Vgl. Erminnie A. Smith: »Myths of the Iroquois«, 1883; Hewitt: »Iroquoian Cosmology: First Part«, 1903, S. 167; ders.: »Iroquoian Cosmology: Second Part, with Introduction and Notes«,
- 1928, S. 479; Converse: »Myths and Legends of the New York State Iroquois«, 1974 [1908]; Lévi- Strauss: Die eifersüchtige Töpferin, 1987 [1985], S. 209-217. 47 Hewitt: »Iroquoian Cosmology: First Part«, S. 167-168. 48 Ebd., S. 171. 49 Vgl. Jennings u. a.: »Glossary of Figures of Speech in Iroquois Political Rhetoric«, 1985, S. 122. 50 Vgl. hierzu Anthony Wallace: »Dreams and Wishes of the Soul: A Type of Psychoanalytic Theory among the Seventeenth Century Iroquois«, 1958. Wallace führt zahlreiche solche Berichte über irokesische Theorien an, die er aus naheliegenden Gründen mit denen von Freud vergleicht. 51 Zitiert nach Lévi-Strauss: Die eifersüchtige Töpferin, 1987 [1985], S. 212. 52 Vgl. A. Wallace: »Dreams and Wishes of the Soul«, 1958; Tooker: The Iroquois Ceremonial of Midwinter, 1970; Blau: »Dream Guessing: A Comparative Analysis«, 1963. 53 Manche Träume stellten nicht nur eine Gefahr für den Träumenden dar, sondern für die gesamte Gemeinschaft. Es kam auch vor, dass man sie als Prophezeiung betrachtete: Wenn ein Mann träumte, seine Feinde würden ihn verbrennen, hielt man oft eine abgeschwächte Form dieses Schicksals für erforderlich, um zu verhindern, dass es tatsächlich eintrat. Meiner Meinung nach handelte es sich in diesem Fall nicht um eine Begierde der Seele des Träumenden, sondern der des Schöpfers. 54 Thwaites: The Jesuit Relations, Bd. 10, S. 175-177. 55 Ebd., Bd. 42, S. 155-156. 56 Ebd., Bd. 17, S. 170. 57 Ebd., Bd. 42, S. 165. 58 Étienne de Carheil, ebd., Bd. 54, S. 65-67. 59 Tooker: The Iroquois Ceremonial of Midwinter, 1970, S. 86-88. 60 Thwaites: The Jesuit Relations, Bd. 10, S. 169. 61 Vgl. Wallace: The Death and Rebirth of the Seneca, 1969. 62 Vgl. Le Jeune in Thwaites: The Jesuit Relations, Bd. 17, S. 165-187. 63 Vgl. Dablon, ebd., Bd. 42, S. 195-197.' ' ^^ ^ÄS^&^r- 64 Tooker: The Iroquois Ceremonial of Midwinter, 1970. 65 Vgl. Blau: »Dream Guessing: A Comparative Analysis«, 1963; Beauchamp: »Onondaga Customs«, 1888. 66 Wallace merkt an, dass die »Seele«, der innere, unsichtbare Teil der Person, mit Absichten und Begierden gleichgesetzt wird, wobei die Begriffe dafür denen für die Talismane entsprechen, die zu ihrer Befriedigung überreicht werden; vgl. Hewitt: »The Iroquian Concept of the Soul«, 1895. 67 Hale: »The Iroquois Sacrifice of the White Dog«, 1885; Hewitt: »White Dog Sacrifice«, 1910; ders.: »The White-dog Feast of the Iroquois«, 1910; Speck: Midwinter Rites of the Cayuga Long House, 1949; Blau: »The Iroquois White Dog Sacrifice: Its Evolution and Symbolism«, 1964; Tooker: »The Iroquois White Dog Ceremony in the Latter Part of the Eighteenth Century«, 1965; dies.: The Iroquois Ceremonial of Midwinter, 1970, S. 41-47, S. 102-103, S. 128-141. 68 Fenton: Songs from the Iroquois Longhouse, 1942, S. 17. 69 A. Wallace: »Dreams and Wishes of the Soul«, 1958, S. 247. 70 A. Wallace: The Death and Rebirth of the Seneca, 1969. 71 Das ist am deutlichsten bei den Onondaga zu sehen (vgl. Blau: »Dream Guessing: A Comparative Analysis«, 1963), es scheint jedoch selbst dort, wo das Traumdeuten bei Zeremonien keine so große Rolle mehr spielt, ein grundlegendes Prinzip zu sein (vgl. z. B. Fenton: »An Iroquois Condolence Council for Installing Cayuga Chiefs in 1945«, 194; Speck: Midwinter Rites of the Cayuga Long House, 1949, S. 122; Shimony: Conservatism among the Six Nations Iroquois Reservation, 1961, S. 182-183). 72 In neueren Quellen ist davon kaum die Rede; es kommt vor allem bei den Falschgesichterbünden vor, deren Mitglieder mithilfe von Träumen moietyüber-greifend rekrutiert
- wurden (vgl. z. B. Fenton: »An Iroquois Condolence Council for Installing Cayuga Chiefs in 1945«, 1946). 73 Morgan: League of the Ho-de'-no-sau-nee, or Iroquois, 1962 [1851], S. 83; Fenton: The Roll Call of the Iroquois Chiefs: A Study of a Mnemonic Cane from the Six Nations Reserve, 1950; Tooker: The Iroquois Ceremonial of Midwinter, 1970, S. 23. 74 Vgl. Ceci: » »The Value of Wampum among the New York Iroquois«, 1982, S. 102-103; E. Smith: »Myths of the Iroquois«, 1883, S. 78-79. 75 Ceci: »The Value of Wampum among the New York Iroquois«, 1982, S. 103. 76 Beispielsweise wurden die Brüder einen jungen Mannes auf mehrere Clans verteilt, während der Vater wiederum der anderen Moiety angehörte. 77 Obwohl Frauen natürlich unmittelbar einen Krieg auslösen konnten, da es für gewöhnlich die weiblichen Verwandten waren, die einen »Mourning War« forderten, wenn jemand starb, vgl. Dennis: Cultivating a Landscape of Peace, 1993, S. 109-110. 78 Parker: The Constitution of the Five Nations, 1916, S. 46. 79 Vgl. Holmes: »Art in Shell of the Ancient Americans«, 1883, S. 241; Hamell: »The Iroquois and the World's Rim: Speculations on Color, Culture, and Contact«, 1992. 80 Die offensichtlichen Ausnahmen bildeten Namensgürtel und -schnüre; ein Austausch der generischeren Formen, die am engsten mit der Macht, politische Gegebenheiten zu schaffen, verknüpft waren, scheint jedoch fast ausschließlich zwischen Männern stattgefunden zu haben. 81 Turgeon: »The Tale of the Kettle: Odyssey of an Intercultural Object«, 1997. 82 Paul Wallace: The White Roots of Peace: The Iroquois Book of Life, 1946, S. 7. 83 Deläge: Bitter Feast: Amerindians and Europeans in Northeastern North America, 1600-64, 1993, S. 52-53. 84 A. Wallace: »Revitalization Movements«, 1956. 85 Richter: The Ordeal of the Longhouse, 1992, S. 85. 86 Vgl. Dennis: Cultivating a Landscape of Peace, 1993. Sechstes Kapitel Zurück zu Marcel Mauss 1 Dumont: Individualismus: Zur Ideologie der Moderne, 1991 [1976]. 2 Sahlins: Stone Age Economies, 1972. 3 Davy hatte 1922 La Foi jurée veröffentlicht, eine Studie über die rechtliche Grundlage des Potlatch an der Nordwestküste. An anderer Stelle behauptete Mauss, sie hätten lange vor dem Ersten Weltkrieg angefangen, an dem Thema zu arbeiten (vgl. Mauss: »Une forme ancienne de contrat chez les thraces«, 1969 [1921], S. 35). 4 Mauss: »Die Gabe«, 1975 [1925], S. 13. 5 Diese Überlegung wird von einigen Forschern auf Ralph Waldo Emersons 1844 erschienenen Essay »Gifts« zurückgeführt, in dem er das Gefühl des Empfängers beschreibt, eine Art Angriff erlitten zu haben, der nur durch ein gleichwertiges Gegengeschenk wettgemacht werden kann. Mauss verbindet beides miteinander. 6 Lévi-Strauss: »Einleitung in das Werk von Marcel Mauss«, 1974 [1946]. 7 Mauss: »Die Gabe«, 1975 [1925], S. 43. 8 Ebd., S. 83. 9 Ebd., S. 102. 10 Fournier: Marcel Mauss, 1994. 11 Maurice Godelier beschreibt Mauss in Das Rätsel der Gabe, 1999 [1996], als strammen Antibolschewisten und Sozialdemokraten. Aber zu diesem Urteil kam Godelier vor der Wiederveröffentlichung von Mauss' politischen Schriften im Jahr 1997, die zeigen, dass er ein ambivalentes Verhältnis zur Russischen Revolution hatte und dass seine politischen Ziele in vielerlei Hinsicht denen von Anarchisten wie Proudhon ähnlicher waren als denen seines Mentors Jaurès. 12 Zugleich hielt Mauss sie für ein taktisches Desaster: »Niemals wurde Gewalt so schlecht eingesetzt wie von den Bolschewisten. Was ihren Schrecken in erster Linie kennzeichnet, ist seine Dummheit, sein Wahnwitz.« (Mauss: »L'obligation à rendre les présents«, 1923.)
- 13 Mauss: »Socialisme et bolchevisme«, 1997 [1925], S. 708-709. 14 Mauss: »La vente de la Russie«, in: La Vie Socialiste vom 18. November 1922; Fournier: Marcel Mauss, 1994, S. 472-476. 15 Mauss: »Die Gabe«, 1975 [1925], S. 127. 16 Mauss: »Les idées socialistes. Le principe de la nationalisation«, 1997 [1920]; »Intervention à la suite d'une communication d'Aftalion: >Les fondements du socialisme«<, 1969 [1924]. 17 Diese Beobachtung sollte allerdings nicht überstrapaziert werden. Das Kapital war schon lange auf Französisch erhältlich und die Dürkheim-Schüler hatten einen Lesekreis dazu gebildet. Mauss selbst machte sich erst später mit den Ideen von Marx vertraut, als er sich eingehender mit Technik beschäftigte. Mir geht es hier allerdings in erster Linie um den Marx'sehen Begriff der Entfremdung, den er insbesondere in seinem Frühwerk entwickelt hat und mit dem Mauss offenbar nicht besonders vertraut war. Jedenfalls konnte ich in den veröffentlichten Texten von Mauss keine Verweise auf »Entfremdung« im Marx'schen Sinne finden. 18 Jonathan Parry und Maurice Godelier kommt das Verdienst zu, an die übergeordnete Fragestellung zu erinnern, die Mauss verfolgte. Parry: »The Gift, the Indian Gift, and the >Indian Gift<«, 1986; Godelier: Das Rätsel der Gabe, 1999 [1996]. 19 Mauss: »Die Gabe«, 1975 [1925], S. 16. 20 Mauss: Handbuch der Ethnographie, 2012 [1947], S. 181. 21 Vgl. Mauss: »Les idées socialistes. Le principe de la nationalisation«, 1997 [1920]; ders.: »Intervention à la suite d'une communication d'Aftalion: >Les fondements du socialisme<«, 1969 [1924]. 22 Wenn sie einseitig wären, schreibt er, würden sie am Schluss aufgehoben werden, so dass A von B nimmt, B von C, C von D und D wieder von A. Der Einfluss auf Lévi-Strauss' späteren Entwurf des generalisierten Austauschs ist unübersehbar. Weniger Aufmerksamkeit erhielt ein anderer Begriff von Mauss, nämlich der der »alternierenden Reziprozität«, wonach man das, was man von seinen Eltern erhalten hat, zurückerstattet, indem man den eigenen Kindern dasselbe zuteilwerden lässt. 23 Mauss: Handbach der Ethnographie, 2012 [1947], S. 183; vgl. Godelier: Das Rätsel der Gabe: Geld, Geschenke, heilige Objekte, 1999 [1996], S. 55-72. 24 Parry: »The Gift, the Indian Gift, and the >Indian Gift«<, 1986. 25 Caillé: Don, intérêt et désintéressement, 1994, S. 10-12. 26 Vergleiche dazu Parrys Beobachtungen zur Gabe im Hinduismus in dem Aufsatz »The Gift, the Indian Gift, and the >Indian Gift«<; darin führt er aus, dass das Aufkommen universalistischer Religionen zum Ideal der nicht zu vergeltenden Gabe führt. Zum Islam vgl. Dresch: »Mutual Deception: Totality, Exchange, and Islam in der Middle East«, 1998. 27 Nicolas: »Le don rituel, face voilée de la modernité«, 1991. 28 Godbout und Caillé: The World of the Gift, 1998 [1992], S. 220-221. 29 Derrida: Falschgeld: Zeit geben I, 1993 [1991]; vgl. Gasché, Rudolphe: »Heliocentric Exchange«, 1997 [1972]; und allgemein Schrift: The Logic of the Gift: toward an Ethic of Generosity, 1997. 30 Mauss: »Die Gabe«, 1975 [1925], S. 124. 31 Ebd., S. 125. 32 Eine typische, reflexartige Ablehnung von einer rechten Position findet sich im Vorwort von Mary Douglas zur englischen Ausgabe der »Gabe« (»Foreward: No Free Gifts«, 1990). 33 Vgl. Annette Weiner: »Inalienable Wealth«, 1985, und Inalienable Possessions: The Paradox of Keeping-while-Giving, 1992; Godelier: Das Rätsel der Gabe, 1999 [1996]. 34 Mauss: »Die Gabe«, 1974 [1925], S. 46. 35 Malinowski: Das Geschlechtsleben der Wilden in Nordwest-Melanesien, 1979 [1929], S. 134-138. 36 Ebd., S. 151. 37 Ebd.; Weiner: Women of Value, Men of Renown: New Perspectives on Trobriand Exchange, 1976, S. 121-123.
- 38 Munn: The Fame of Gawa, 1986, S. 142-143. 39 Weiner: Women of Value, Men of Renown, 1976, S. 123-129; Malinowski: Argonauten des westlichen Pazifik 1979 [1922], S. 371-382; Das Geschlechtsleben der Wilden in Nordwest- Melanesien, 1979 [1929], S. 86-89. 40 Munn: The Fame of Gawa, 1986. 41 Munn: »The Spatiotemporal Transformations of Gawan canoes«, 1977; dies.: The Fame of Gawa, 1986, S. 121-162. 42 Weiner: Women of Value, Men of Renown, 1976; dies.: »The Reproductive Model in Trobriand Society«, 1978; dies.: The Trobrianders of Papua New Guinea, 1988. 43 Munn: »The Spatiotemporal Transformations of Gawan canoes«, 1977; dies.: »Gawan Kula: Spatiotemporal Control and the Symbolism of Influence«, 1983; dies.: The Fame of Gawa, 1986. 44 Damon: Modes of Production and the Circulation of Value on the Other Side of the Kula Ring, 1978; ders.: »The Kula and Generalized Exchange: Considering Some Unconsidered Aspects of the Elementary Structures of Kinship«, 1980; ders.: »The Problem of the Kula on Woodlark Island: Expansion, Accumulation, and Overproduction«, 1995. 45 Battaglia: »Projecting Personhood in Melanesia: the Dialectics of Artefact Symbolism on Sabarl Island«, 1983, S. 289. 46 Ebd., S. 293-294.; dies.: On the Bones of the Serpent, 1990, S. 68-71. 47 Dies.: »Projecting Personhood in Melanesia: the Dialectics of Artefact Symbolism on Sabarl Island«, 1983. 48 Ebd., S. 301. 49 Dies.: On the Bones of the Serpent, 1990, S. 128-135. 50 Vgl. Wagner: Symbols that Stand for Themselves, 1986, S. 58-59; Clark: »Pearl-Shell Symbolism in Highland Papua New Guinea, with Particular Reference to the Wiru People of Southern Highlands Province«, 1991; Atkins und Robbins: »An Introduction to Melanesian Societies: Agencies, Identity, and Social Reproduction«, 1999, S. 16-19. 51 Vgl. hierzu Goldman: Ancient Polynesian Society, 1970; ders.: The Mouth of Heaven: An Introduction to Kwakiutl Religious Thought, 1975; Sahlins: »Cosmologies of Capitalism«, 1988. 52 Schwimmer: »Lévi-Strauss and Maori Social Structure«, 1978, S. 202-203. 53 Schwimmer: »Lévi-Strauss and Maori Social Structure«, 1978; ders.: »The Maori Hapu: a Generative Model«, 1990. 54 Firth: Economics of the New Zealand Maori, 1959, S. 181; vgl. auch Graeber: »Manners, Deference and Private Property: The Generalization of Avoidance in Early Modern Europe«, 1997. 55 Angas: Savage Life and Scenes in Australia and New Zealand, 1847, Bd. 1, S. 318. 56 Williamson: »Kumara Lore«, 1913, Johansen: Studies in Maori Rites and Myths, 1958; Sahlins: Inseln der Geschichte, 1992 [1985]. 57 Smith: Tapu removal in Maori Religion, 1974. 58 Ebd., S. 62-63; Gudgeon: »Mana Tangata«, 1905, S. 62-65. 59 Schwimmer (»The Maori Hapu: a Generative Model«, 1990) geht so weit, darin die beiden Pole der Maori-Philosophie zu sehen. Da jeder gleichermaßen von den Göttern abstammt, stellt sich die Frage, woher die Unterschiede in den Spezies kommen, warum sie also verschiedene tikanga oder Naturen besitzen; die Antwort liegt in der Universalität des Kampfes. 60 Weiner: »Sexuality among the Anthropologists: Reproduction among the Informants«, 1992, S. 61. 61 Tregear: The Maori Race, 1904, S. 132-133. Die meisten dieser Beispiele stammen von White (»Maori Customs and Superstitions«, 1885, S. 197-198), der auch etliche Gründe aufzählt, auf die sich ein Stamm oder hapu berufen kann, wenn er Anspruch auf ein bestimmtes Stück Land erhebt; unter anderem, dass Vorfahren dort begraben oder gestorben sind, Kämpfe verloren oder gewonnen oder berühmte Taten vollbracht wurden. Auch bestimmte Handlungen konnten dazu beitragen, dass Besitz unter die einzigartige Identität einer Person gefasst wurde. 62 Maning: Old New Zealand, 1863, S. 137-139; vgl. Firth: Economics of the New Zealand Maori, 1959, S. 345.
- 63 White: »Maori Customs and Superstitions«, 1885, S. 150-151; vgl. Donne: The Maori Past and Present, 1927, S. 88-89. 64 Ein Unruhestifter konnte einen lokalen Häuptling auch verfluchen, indem er das Schwein eines Dritten mit dem Namen des Häuptlings rief. Wenn der Häuptling Wind davon bekam, konnte er seine Ehre nur retten, indem er sich das Schwein mit Waffengewalt holte. Daher fühlte sich der Besitzer des Schweins für gewöhnlich verpflichtet, es auszuhändigen, sobald der Häuptling verflucht wurde. 65 Firth: Economics of the New Zealand Maori, 1959, S. 411-412. 66 Darüber hinaus wurde vor allem Nahrung und nicht Erbstücke getauscht; vgl. hierzu Polack: Manners and Customs of the New Zealanders, 1840, Bd. 2, S. 159. 67 Johansen: The Maori and His Religion, 1954, S. 119. 68 White: »Maori Customs and Superstitions«, 1885, S. 196. 69 Shortland: Traditions and Superstitions of the New Zealanders, 1856, S. 215-217. 70 Donne: The Maori Past and Present, 1927, S. 189. 71 Vgl. Maning: Old New Zealand, 1863, S. 83-91; Johansen: The Maori and His Religion, 1954, S. 140-146. 72 Best: »The Spiritual Concepts of the Maori, part 1«, 1900, und »The Spiritual Concepts of the Maori, part 2«, 1901. 73 Firth: Economics of the New Zealand Maori, 1959, S. 255. 74 Vgl. Johansen: The Maori and His Religion, 1954; Schwimmer: »Lévi-Strauss and Maori Social Structure«, 1978. 75 Vgl. Gudgeon: »Maori Religion«, 1905, S. 127-128. 76 Vgl. hierzu u.a. Mitchell: Takitimu, 1944, S. 42-43. 77 Vgl. Best: »Maori Forest Lore, Part III« 1909, ders.: Fishing Methods and Devices of the Maori, 1929, ders.: Forest Lore of the Maori, 1942. 78 Best: Maori Agriculture, 1925, S. 199-203. 79 Vgl. hierzu Firth: Economics of the New Zealand Maori, 1959, S. 279-281, 417-421; Johansen: The Maori and His Religion, 1954, S. 116-118; Lévi-Strauss: »Einleitung in das Werk von Marcel Mauss«, 1974; Panoff: »Marcel Mauss: The Gift Revisited«, 1970; Sahlins: Stone Age Economics, 1972; ders.: »Foreword«, 1992; Gathercole: >»Hau<, >Mauri< and >Utu«<, 1978; McCall: »Association and Power in Reciprocity and Requital: More on Mauss and the Maori«, 1982; Mac-Cormack: »Mauss and the >Spirit< of the Gift«, 1982; Casajus: »L'énigme de la troisième personne«, 1984; Taïeb: »L'Oreille du Sourd«, 1984; Weiner: »Inalienable Wealth«, 1985; dies.: Inalienable Possessions, 1992, S. 49; Thompson: »The Hau of the Gift in its Cultural Context«, 1987; Racine: »L'Obligation de rendre les présents et l'esprit de la chose donnée«, 1991; Babadzan: Les dépouilles des dieux, 1993; Godelier: Das Rätsel der Gabe, 1999, S. 49-56; Salmond: Between Worlds: Early Exchanges Between Maori and Europeans, 1997, S. 176-177; Gell: Art and Agency: An Anthropological Theory, 1998, S. 106-109; Godbout und Caillé: The World of the Gift, 1998, S. 131-134. 80 Best: »Maori Forest Lore, Part III«, 1909. 81 Zitiert nach ebd., S. 439 und 441. Die an verschiedenen Stellen geänderte Übersetzung von Best beruht auf der von Bruce Biggs (nach Sahlins: Stone Age Economics, 1972, S. 152), MacCall: »Association and Power in Reciprocity and Requital: More on Mauss and the Maori«, 1982, und anderen. 82 Best: »The Spiritual Concepts of the Maori, part 1«, 1900, S. 198. 83 Williams: A Dictionary of the New Zealand Language, 1844, S. 46-47; Tregear: The Maori- Polynesian Comparative Dictionary, 1891, S. 52. 84 Williams: A Dictionary of the New Zealand Language, 1844, S. 47. 85 Ebd.; Tregear: The Maori-Polynesian Comparative Dictionary, S. 52. 86 Unter anderem Best: »Maori Forest Lore, Part III«, 1909, S. 442; Spiritual and Mental Concepts of the Maori, 1922, S. 26; Fishing Methods and Devices of the Maori, 1929, S. 3. 87 Smith: Tapu Removal in Maori Religion, 1974, S. 33.
- 88 Babdazan: Les dépouilles des dieux, 1993, S. 61; s.a. Gell: Art and Agency: An Anthropological Theory, 1998, S. 108. 89 So konnte gekochte Nahrung nicht wachsen oder »ihre eigene Natur entfalten« (tupu) und ihr Nutzen bestand nur mehr darin, etwas anderem einverleibt zu werden und ihm zum Wachstum zu verhelfen. 90 Vgl. Shortland: Traditions and Superstitions of the New Zealanders, 1856, S. 114-115. 91 Vergleiche Mauss: »Die Gabe«, 1975 [1925], S. 25, Fn. 29. 92 Tapu zu sein bedeutet nach Williams {A Dictionary of the New Zealand Language, 1844, S. 450) unter anderem, »jenseits der Macht zu stehen, unerreichbar«. 93 Das Wort taonga konnte letztlich für alles, was man wertschätzte, verwendet werden, nicht nur für Erbstücke, für die offenbar eher das Wort manatunga gebraucht wurde (Johansen: The Maori and His Religion, 1954, S. 100; vgl. Williams: A Dictionary of the New Zealand Language, 1844, S. 202 und 445). Weiner erklärt, dass nach Ranpiri nur taonga ein hau hatten; allerdings wurden auch für Nahrung erwiderte Geschenke hau genannt (vgl. Mauss: »Die Gabe«, 1975 [1925], S. 26, Fn 31). 94 Weiner: Inalienable Possessions: The Paradox of Keeping-while-Giving, 1992, S. 56-58. 95 Tregear: The Maori Race, 1904; Metge: The Maori of New Zealand, 1976, S. 263; Best: Spiritual and Mental Concepts of the Maori, 1924, Bd. 2, S. 54-55; vgl. Taylor: Te Ika a Maui or New Zealand and Its Inhabitants, 1855, S. 62. 96 Gudgeon: »Mana Tangata«, 1905, S. 57. 97 Ebd., S. 55-57. 98 Mitchell: Takitimu, 1944, S. 187; White: The Ancient History of the Maori: His Mythology and Traditions, 1887, Bd. 3, S. 301-302; Bd. 4, S. 17-18. 99 Firth berichtet, dass einer der Häuptlinge eines Stammes-ariki der Wächter solcher Stammeserbstücke war und auch die Aufsicht über die mauri der Wälder und Fischgründe hatte (Economics of the New Zealand Maori, 1959, S. 93; vgl. Johansen: The Maori and His Religion 1954, S. 106). 100 Donne: The Maori Past and Present, 1927, S. 187. 101 Allgemein hieß es, nur Aristokraten könnten solche wertvollen Objekte herstellen, aber das schloss eigentlich kaum jemanden aus, wie wir gesehen haben. Von einer bemerkenswerten Ausnahme berichtet Stirling: Amiria: The Life Story of a Maori Woman, 1976, S. 162. Dass man sich nicht an die Künstler erinnert, liegt zum Teil an dem Wesen des Maori-Tauschs. Solche Handwerker wurden wie Priester für rituelle Dienste oder Tätowierer mit Geschenken entlohnt, was eine endgültige Veräußerung zur Folge gehabt zu haben scheint (Firth: Economics of the New Zealand Maori, 1959, S. 299-304; 413-414; vgl. Thomas: Entangled Objects: Exchange, Material Culture, and Colonialism in the Pacific, 1991). 102 Er war, so heißt es, ein Geizkragen. 103 Offenbar hatte Te Wehi das Gefühl, eine direkte Bitte nicht ausschlagen zu dürfen, obwohl er sich in dieser Situation wahrscheinlich bereits tief in ihrer Schuld stehen sah. 104 Ich folge in dieser Zusammenfassung Kelly: Tainui: The Story of Hotoroa and his Descendants, 1949, S. 223-227 und S. 275-277; Jones: The Traditional History of the Tainui People, 1995, S. 260-271 und S. 360-361. 105 Ich konnte in den Dokumenten zu Te Whata Karakas Genealogie keinen Hinweis finden, dass er ein Nachfahr von Pakaue war, so dass er Waikato in Gestalt ihres Häuptlings eigentlich nur gegeben wurde. 106 Vgl. hierzu Geary: »Sacred Commodities: the Circulation of Medieval Relics«, 1986. 107 Vgl. hierzu Anne Salmond: »Nga Huarahi O Te Ao Maori (Pathways in the Maori World)«, 1984. 108 Codere: Fighting with Property: A Study of Kwakiutl Potlatching and Warfare, 1792-1930, 1950, S. 19. 109 Vgl. hierzu Walens: Feasting with Cannibals: An Essay on Kwakiutl Cosmology, 1981. 110 Ebd.; Goldman: The Mouth of Heaven: An Introduction to Kwakiutl Religious Thought,
- 1975. 111 Kobrinsky: »Dynamics of the Fort Rupert Class Struggle: Or, Fighting with Property Vertically Revisited«, 1975; Masco: »It Is a Strict Law that Bids Us Dance: Cosmologies, Colonialism, Death, and Ritual Authority in the Kwakwa-ka'wakw Potlatch, 1849 to 1922«, 1995; Wolf: Envisioning Power: Ideologies of Dominance and Crisis, 1999. 112 Lévi-Strauss: Der Weg der Masken, 1977 [1975]. 113 Vgl. Codere: »The Amiable Side of Kwakiutl Life: The Potlatch and the Play Potlatch«, 1956. 114 Wie so viele Jäger und Sammler wechselten die Kwakwaka'wakw zwischen verstreut liegenden kleineren Siedlungen im Sommer und großen, zentralen Siedlungen im Winter, wenn auch die Zeremonien abgehalten wurden. 115 Boas: Kwakiutl Ethnography, 1966, S. 50. 116 Ebd., S. 41-44; ders.: »Kwakiutl Culture as Reflected in Mythology«, 1935, S. 41-52. 117 Boas: »The Social Organization and Secret Societies of the Kwakiutl Indians«, 1897, S. 383. 118 Boas: »Kwakiutl Culture as Reflected in Mythology«, 1935, S. 43. 119 Es heißt, dass nur die ältesten vier Kinder, gleich welchen Geschlechts, den aristokratischen Status ihrer Eltern erbten; das fünfte galt als »Sklave«, auch wenn es tatsächlich wohl ein Gemeiner war. 120 Wahrscheinlicher ist, dass nur die Deckel weitergegeben und der Rest für den neuen Besitzer nachgebaut wurde. Das gleicht für die Übertragung von Titeln: Weitergegeben wird der Name und man schafft neue physische Entitä-ten, die ihn übernehmen und so neue Verkörperungen des Originals werden. 121 Lévi-Strauss: Der Weg der Masken, 1977 [1975]. 122 Da die Familiengeschichten und andere detaillierte Berichte alle möglichen Titel beinhalteten, die in diesen paradigmatischen Listen nicht aufgeführt waren, muss die tatsächliche oder auch nur mögliche Titelzahl sehr viel größer gewesen sein. 123 Nach Helen Codere entstand das allgemeine Rangsystem erst Ende des neunzehnten Jahrhunderts, als die Kwakiutl um Fort Rupert siedelten und anfingen, den neu entdeckten Reichtum für ihre Statuswettbewerbe zu nutzen. 124 Da das alles männliche Namen waren, konnten Frauen sie nur als eine Art Mann ehrenhalber tragen oder stellvertretend für ihre Söhne. Selbst in der Zeit des schlimmsten demographischen Niedergangs, als die Zahl adliger Männer weit geringer war als die der verfügbaren Titel, wurde einer Frau nur ausnahmsweise gestattet, ein solches Erbe anzutreten. 125 Für den Potlatch ging man jedoch weiterhin von verschiedenen Persönlichkeiten aus, die jeweils ihren Anteil am verteilten Besitz erhielten. 126 Wolf: Envisioning Power: Ideologies ofDominance and Crisis, 1999, S. 77, zitiert Zahlen, die darauf hinweisen, dass die Bevölkerungszahl von etwa 85.000 im Jahr 1835 bis auf etwa 1000 zur Jahrhundertwende sank. 127 Bei Kan: Symbolic Immortality: The Tlingit Potlatch of the 19th Century, 1989, S. 49-75, findet sich die bemerkenswerte Ausnahme für die Nordwestküste. 128 Goldman: The Mouth of Heaven: An Introduction to Kwakiutl Religious Thought, 1975; Walens: Feasting with Cannibals: An Essay on Kwakiutl Cosmo-logy, 1981. 129 Boas: »The Social Organization and Secret Societies of the Kwakiutl Indians«, 1897, S. 554. Solche Wappen waren auf Häuptlingshäusern besonders markant und repräsentierten das Haus selbst als eine Art äußerer Körper des numaym, dessen Mitglieder alle in gewisser Weise von der Persönlichkeit, der I Formseele seines Gründers und dessen (derzeitigem) lebenden Repräsentanten umfasst wurden. 130 Walens: Feasting with Cannibals: An Essay on Kwakiutl Cosmology, 1981, S. 46-49. 131 Ebd., S. 46. Daher zeigen mythische Tiere, wenn sie ihre Maske abstreifen und zu Menschen werden, nur eine andere Oberfläche, ähnlich den Masken hinter den Masken. 132 Ebd., S. 146-147.
- 133 Goldman: The Mouth of Heaven: An Introduction to Kwakiutl Religious Thought, 1975, S. 50-52, 139-140, 202-205. 134 Genauso wenig wie die Titel von Frauen, die es durchaus gibt. Jedes numaym verfügt über eine Reihe von Adelstiteln, die für Frauen reserviert sind, aber anders als die für Männer hält man sie für einzigartig und inkommensurabel. 135 In Boas: »The Social Organization and Secret Societies of the Kwakiutl Indians«, 1897, S. 363. 136 Goldman: The Mouth of Heaven, 1975, S. 79. 137 Boas: »Contributions to the Ethnology of the Kwakiutl«, 1925, S. 249-269. 138 Goldman: The Mouth of Heaven: An Introduction to Kwakiutl Religious Thought, 1975, S. 78-79. 139 Ein Potlatch wurde auch abgehalten, um ein beschämendes Ereignis wettzumachen; wenn beispielsweise ein adliges Kind beim Spielen verletzt wurde oder aus seinem Kanu fiel, verteilten seine Eltern normalerweise zur Kompensation Geschenke. 140 Goldman: The Mouth of Heaven, 1975, S. 124. 141 Ebd., S. 61; Boas: »The Social Organization and Secret Societies of the Kwakiutl Indians«, 1897, S. 339-340; Codere: Fighting with Property: A Study of Kwakiutl Potlatching and Warfare, 1792-1930, 1950, S. 67. 142 Boas: Kwakiutl Ethnography, 1966, S. 100. 143 Vgl. Oberg: The Social Economy of the Tlingit Indians, 1973, S. 125. 144 Das lag zum Teil natürlich daran, dass der Rang nicht verändert werden konnte, zumindest nicht so leicht. Die Stellung verschiedener Stämme und numayma zueinander und daher der Rang ihrer jeweiligen Titel konnte zwar durch einen Potlatch geändert werden, aber das war offenbar außerordentlich schwer zu erreichen. Wie oft bei solchen Systemen bestand natürlich keine Einmütigkeit über den jeweiligen Stand der Dinge. 145 Boas: »Kwakiutl Culture as Reflected in Mythology«, 1935, S. 334. 146 Goldman: The Mouth of Heaven, 1975. 147 Drucker und Heizer: To Make My Name Great: Reexamination of the Southern Kwakiutl Potlatch, 1967, S. 78. 148 Boas: »The Social Organization and Secret Societies of the Kwakiutl Indians«, 1897, S. 344; ders.: Kwakiutl Ethnography, 1966, S. 82. 149 Waterman: »Some Conundrums in Northwest Coast Art«, 1923. 150 Widersprach-Thor: »The Equation of Copper: In Memory of Wilson Duff«, 1 noi 151 Kan: Symbolic Immortality: The Tlingit Potlatch of the 19th Century, 1989, S. 238-241. 152 Die Idee, dass es zwei Arten von Kupferplatten gibt, von denen eine wertvoller ist und vom Clan behalten wird (Weiner: Inalienable Possessions: The Paradox of Keeping-while-Giving, 1992, S. 164, Fn. 11, 180, Fn. 1; Godelier: Das Rätsel der Gabe, 1999, S. 59-60), geht wohl auf eine Mauss'sche Fehlinterpretation von Boas zurück (Boas: »The Social Organization and Secret Societies of the Kwakiutl Indians«, 1897, S. 564, 579; Mauss: »Die Gabe«, 1975 [1925], S. 90, Fn 224). 153 Duff: »The Killer Whale Copper: a Chiefs Memorial to his Son«, 1981, S. 153; Jonaitis: Chiefly Feasts: The Enduring Kwakiutl Potlatch, 1991, S. 40-41. 154 Boas: Kwakiutl Ethnography, 1966, S. 84-92. 155 Goldman: The Mouth of Heaven, 1975, S. 126-127. 156 Widerspach-Thor: »The Equation of Copper: In Memory of Wilson Duff«, 1981, S. 172. 157 Kan: Symbolic Immortality: The Tlingit Potlatch of the 19th Century, 1989, S. 246; vgl. S. 345, Fn 65. 158 Diesen Begriff prägten Drucker und Heizer in To Make My Name Great: A Reexamination of the Southern Kwakiutl Potlatch, 1967, S. 102-103. 159 Ebd., S. 119. 160 Barnett (»The Nature of the Potlatch«, 1938) führt das auf den Brauch des
- »gesichtswahrenden Potlatch« zurück, bei dem man Reichtum aufgibt oder zerstört, um eine Kränkung oder Demütigung zu kompensieren. Entsprechend gibt ein Gast, der auf dem Weg zum Haus seines Gastgebers gestolpert ist, eine oder zwei Decken. 161 Das Zerbrechen einer Kupferplatte war eine hervorragende Möglichkeit für einen Adligen, einen vermeintlichen Emporkömmling aus den Reihen der Gemeinen fertigzumachen, der sich zu einem Potlatch hocharbeiten wollte; in der Literatur von Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts taucht das zuhauf auf. 162 Mauss: »Die Gabe«, 1974 [1925], S. 77. 163 Drucker und Heizer: To Make My Name Great: A Reexamination of the Southern Kwakiutl Potlatch, 1967, S. 37 und S. 56-57. 164 Curtis: The North American Indian, volume X, 1915, S. 143; Testart: »Uncertainties of the obligation to reciprocatec A Critique of Mauss«, 1998. 165 Barnett: »The Nature of the Potlatch«, 1938; ders.: The Nature and Function of the Potlatch, 1968; Rosman und Rubel: Feasting with Mine Enemy: Rank and Exchange among Northwest Coast Societies, 1971. 166 Goldman: The Mouth of Heaven, 1975, S. 136-137.; Sewid-Smith: »Kwagi-utl Ceremonial Blankets«, 1986, S. 63. 167 Vgl. Oberg: »The Kingdom of Ankole in Uganda«, 1940, S. 150-157. Margaret Wiener vergleicht das mit dem Excalibur-Prinzip: »Wer auch immer dieses Schwert trägt, ist König«. (Visible and Invisible Kingdoms: Power, Magic and Colonial Conquest in Bali, 1995, S. 67). 168 Oberg: »The Kingdom of Ankole in Uganda«, 1940, S. 156. i 169 Daher sind wir verpflichtet, so zu tun, als wären Parteisoldaten vor allem wegen ihrer persönlichen Qualitäten an ihre Position gelangt. (Nebenbei bemerkt glaube ich, dass B. B. King im Lauf seiner Karriere schon mehrere Lucilles durchgebracht hat. Wer in einer solchen Situation ein derart berühmtes Objekt besitzt, steht unter enormem Druck, es wegzugeben und beispielsweise für eine gute Sache versteigern zu lassen oder es mit großer Geste zu verschenken. Dieser Druck rührt vermutlich u. a. von dem Wunsch her, erneut zu bestätigen, dass die eigene Identität tatsächlich in einem inneren Vermögen wurzelt und nicht in irgendwelchen Emblemen oder historischen Artefakten.) 170 Vgl. die Literatur zu Maori-Festen, z.B. Firth: »The Study of Values by Social Anthropologists«, 1964. 171 Gelegentlich hob Mauss die Verpflichtung hervor, Gaben zu erwidern, dann wieder verwies er darauf, dass es drei wichtige Verpflichtungen gebe: die Verpflichtung zur Gabe, die Verpflichtung, sie anzunehmen, und die Verpflichtung, sie zu erwidern. Wie Alain Testart {Des dons et des dieux: Anthropologie religieuse et sociologie comparative, 1993; »Uncertainties of the obligation to reciprocatec a critique of Mauss«, 1998) bemerkte, hat »obligation« im Französischen mehrere Bedeutungen, und es ist nicht klar, ob Mauss das Gefühl meinte, etwas tun zu sollen, oder eine Pflicht mit tatsächlichen Sanktionen. Jedenfalls sollte das in diesem Kapitel angeführte Material deutlich gemacht haben, dass die drei Verpflichtungen nicht alle das gleiche Gewicht haben: Gaben bei den Maori mussten beispielsweise nicht immer angenommen, aber immer erwidert werden; unter den Kwakwala-Sprechern musste man geben, aber es herrschte normalerweise nicht die Verpflichtung zur Erwiderung der Gabe. 172 Lévi-Strauss: »Einleitung in das Werk von Marcel Mauss«, 1974 [1950]. 173 In dieser Weise begreifen Moieties die wechselseitigen Beziehungen für gewöhnlich, auch wenn sie es wie die Irokesen schon lange nicht mehr praktiziert haben. 174 Mauss: Handbuch der Ethnographie, 1947, S. 183-185. 175 Lévi-Strauss: Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft, 1981 [1949]. 176 Sahlins: Stone Age Economies, 1972. 177 Ebd., S. 223. 178 Daher kommt Sahlins zu dem Schluss, dass die meisten hierarchischen Beziehungen unter die »generalisierte Reziprozität« fallen, wobei das meiner Meinung nach ein weiteres Beispiel für
- die gefährliche Ambiguität des Begriffs »Reziprozität« ist. Ich würde sagen, dass die meisten solcher Beziehungen (wenn man den Begriff ernst nimmt) in keiner Weise reziprok sind. 179 Beidelman: »Agonistic Exchange: Homeric Reciprocity and the Heritage of Simmel and Mauss«, 1989. 180 Vgl. Lévi-Strauss: Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft, 1981 [1949]. 181 Leach: Social Anthropologe, 1982, S. 150-151. 182 Auf ziemlich paradoxe Weise würden sie mangels anderer Möglichkeiten dadurch wieder äquivalent. 183 Man könnte einwenden, dass ich mit »individueller« eigentlich meine, »sich von anderen derselben Art in mehr Dimensionen unterscheiden (die für wichtig gehalten werden)«, wonach die Inkommensurabilität dann von der bloßen Zahl solcher Dimensionen herrührt. Wenn Intelligenz also aus hunderten von verschiedenen inkommensurablen Maßstäben abgeleitet wird, kann man nicht behaupten, dass eine Person intelligenter als eine andere ist. Dem liegt jedoch die Annahme zugrunde, dass diese Dimensionen selbst zumindest hypothetisch messbar sind, was mir ein wenig positivistisch vorkommt. 184 Sahlins: Stone Age Economics, 1972. 185 So Godbout und Caillé: The World of the Gift, 1998. 186 Das kann etwas verwirrend werden, denn selbst die am wenigsten gleichen Beziehungen können von den beteiligten Akteuren als reziprok dargestellt werden, wenn sie ihre Gesellschaften als letztlich gerecht erscheinen lassen wollen. Auf eine solche Rhetorik wird meist aber nur in ganz spezifischen Zusammenhängen zurückgegriffen, und selbst dann kann man nie sicher sein, wie ernst die Akteure selbst sie nehmen. 187 Testart: »Les trois modes de transfert«, 1998, S. 98. 188 Weiner: »Inalienable Wealth«, 1985; dies.: Inalienable Possessions: The Paradox of Keeping-while-Giving, 1992; Godelier: Das Rätsel der Gabe, 1996. 189 So z.B. Parry und Bloch: »Introduction: Money and the Morality of Exchange«, 1989; Barraud u. a.: Of Relations and the Dead: Four Societies Viewed from the Angle of Their Exchanges, 1994; ebenso Weiner: »The Reproductive Model in Trobriand Society«, 1978; dies.: »Reproduction: A Replacement for Reciprocity«, 1980; dies.: »Sexuality among the Anthropologists: Reproduction among the Informants«, 1982. Siebtes Kapitel Die falsche Münze unserer Träume oder das Fetischproblem 1 Marx: Das Kapital, Bd. 1, S. 72. 2 Marx-Aveling: »Karl Marx. Lose Blätter«, 1964, S. 273. 3 Vgl. hierzu William Pietz' bekannte Essays zum Fetischproblem: »The Problem of the Fetish I«, 1985; ders.: »The Problem of the Fetish II: The Origin of the Fetish«, 1987; ders.: »The Problem of the Fetish Ilia: Bosman's Guinea and the Enlightenment Theory of Fetishism«, 1988; sowie MacGaffey: »African Objects and the Idea of the Fetish«, 1994. 4 Bloch: Placing the Dead: Tombs, Ancestral Villages, and Kinship Organization in Madagascar, 1971; ders.: »Death, Women and Power«, 1982; ders.: From Blessing to Violence: History and Ideology in the Circumcision Ritual of the Merina of Madagascar, 1986; ders.: Einführung zu Political Language and Oratory in Traditional Societies, 1975. 5 Bloch: »The disconnection between power and rank as a process«, 1977; ders.: »The Ritual of the Royal Bath in Madagascar«, 1989. 6 Dumont: Gesellschaft in Indien, 1976 [1966]. 7 Wie jene der »Ablegerstaaten«, die jedes Mal entstanden, wenn es einem einheimischen Herrscher gelang, groß angelegte öffentliche Bauarbeiten in Gang zu setzen, für gewöhnlich ließ er dafür seine Gefolgsleute Sümpfe trockenlegen und Bewässerungssysteme bauen und verteilte dann das neu gewonnene Land an Familien, die dadurch zu seinen unmittelbaren Untergebenen wurden. 8 Bloch: »The disconnection between power and rank as a process«, 1977. 9 Ebd. 10 Domenichini: Les Dieux au service des rois: histoire des Palladium d'Emyrne, 1977;
- Délivré: L'Histoire des rois d'imerina: interprétation d'une tradition orale, 1974. 11 Hery ist der Begriff für schlichte Kraft, wird aber insbesondere für Dinge wie das Bewegen von Steinen oder jemandem auf den Kopf schlagen verwendet; hasina ist die Kraft, die weniger sichtbar wirkt. 12 De Méritens: Livre de la sagesse malgache, 1967. 13 Edmunds: »Charms and Superstitions in Southeast Imerina«, 1897, S. 63. 14 In der Praxis seinem örtlichen Vertreter. Die bei solchen Gelegenheiten übergebene Summe betrug weniger als einen Silberdollar, es handelte sich also um einen ziemlich bescheidenen Betrag, der aber dennoch als hasina bezeichnet wurde. 15 Vgl. z.B. Callet: Tantara ny Andriana eto Madagascar, 1908; Cousins: Fomba Malagasy y 1963. 16 Bloch: Hierarchy and Equality in Merina Kinship«, 1986. 17 Marx selbst schien nichts gegen Magier zu haben, zumindest nicht bei den Gutenachtgeschichten, die er seinen Töchtern erzählte, wie das Motto zu diesem Kapitel erkennen lässt. 18 Evans-Pritchard: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, 1937; Malinowski: Korallengärten und ihre Magie, 1981 [1935]. 19 Tambiah: »The magical power of words«, 1968; ders.: »The Form and Meaning of Magical Acts: A Point of View« 1973. 20 Graeber: »Dancing with Corpses Reconsidered«, 1995; ders.: »Love Magic and Political Morality in Central Madagascar, 1875-1990«, 1996. 21 Malinowski: Korallengärten und ihre Magie, 1981. 22 Tambiah: Culture, Thought and Social Action: An Anthropological Perspective, 1985, S. 118. 23 Faraone (Hg.): Magika Hiera: Ancient Greek Magic and Religion, 1991; Graf: Gottesnähe und Schadenzauber, 1996. 24 Evans-Pritchard: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, 1937, S. 276. 25 Selbst wenn Macht ausschließlich auf Gewalt und Unterdrückung beruht, geht es noch darum, diejenigen, die Waffen besitzen oder anderweitig Teil des Unterdrückungsapparats sind, zu überzeugen. 26 Evans-Pritchard: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, 1937, S. 122. 27 Graeber: »Dancing with Corpses Reconsidered«, 1995. 28 Ebd. 29 Beidelman: » Agonistic Exchange: Homeric Reciprocity and the Heritage of Simmel and Mauss«, 1989. 30 Turner: »A Commentary«, 1989, S. 263-264. 31 Hogden: Early Anthropology in the 16th and 17th Centuriesj 1964, S. 21-43. 32 Lewis Henry Morgan träumte von einer Gesellschaft, die nicht mehr vom Privateigentum beherrscht werden würde; Alfred Haddon war Sozialist; Rad-cliffe-Brown war in Studententagen als »Anarchisten-Al« bekannt. 33 Dieser Hypothese hat Sahlins einen großen Teil seiner Arbeit gewidmet, vgl. Sahlins: Culture in Practice, 2000. 34 Vgl. Lévi-Strauss: Strukturale Anthropologie, 1971 [1958]. 35 Bei Vincent Geoghegan findet sich eine nützliche Zusammenfassung über die historische Beziehung von Marx und Engels zu utopischem Denken, die wesentlich ambivalenter ist, als sie für gewöhnlich dargestellt wird. Vgl. Geoghan: Utopianism and Marxism, 1987, S. 22-34. Zu Marx' Reaktion auf Moralkritik, insbesondere die von Proudhon (ein wichtiger Ideengeber für einen Sozialismus Mauss'scher Prägung) vgl. Thomas: Karl Marx and the Anarchists, 1980. 36 Weiner macht deutlich, dass ihr Ansatz weitgehend von Mauss beeinflusst ist, jedenfalls mehr als von Marx. Es wäre vermutlich ungerecht zu behaupten, dass sie die untergeordnete Stellung von Frauen bestreitet, zumindest tut sie es nicht explizit; allerdings verwendet sie wie Strathern all ihre Energie darauf, Leute anzugreifen, die eine solche Unterordnung feststellen oder
- andeuten. 37 Dabei handelt es um ein dauerhaftes Dilemma der feministischen Ethnologie - und ich vermute, der einzige Grund, warum man es in diesem Fall so viel leichter erkennt, ist der, dass es sich bei der feministischen Ethnologie um eines der wenigen ethnologischen Gebiete mit einem fortdauernden politischen Engagement handelt. 38 Die systematische Verfolgung eines solchen Ansatzes würde ihrerseits zweifellos alle möglichen unlösbaren Widersprüche nach sich ziehen. Die Vorstellung, dass es anders sein könnte, wäre geradezu naiv. Man kann jedoch zumindest mit gutem Grund davon ausgehen, dass diese Widersprüche ergiebiger wären. 39 Baudrillard: »Fetischismus und Ideologie: Die semiologische Reduktion«, 1972, S. 326. 40 Vgl. z.B. Deleuze: Anti-Ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie, 1988 [1972]. 41 Zumindest eine Theorie dazu, warum sich Begehren von allem anderen unterscheidet. Das Gleiche ließe sich von Foucaults Machttheorie behaupten. 42 Nicht das Brett also, auf dem sich die Damesteine bewegen, sondern die Regeln, die uns sagen, welche Markierungen auf dem Brett wichtig sind und warum. 43 Natürlich nur, bis sie realisiert sind. Von dieser Warte aus betrachtet konnte man sagen, dass Begehren nicht wie in der nietzscheschen Version eine wesentliche Komponente der Wirklichkeit ist, sondern eher eine Metapher für Potential. 44 Mauss: »Die Gabe«, 1975 [1925], S. 127. 45 Vgl. z.B. Scarry: Der Körper im Schmerz, 1992 [1985].
- Literaturverzeichnis
- Ahem, Emily -- »The Problem of Efficacy: Strong and Weak Illocutionary Acts«, in: Man, 14, 1, 1979, S. 1- 17. Atkins, David und Robbins, Joel -- »An Introduction to Melanesian Currencies: Agencies, Identity, and Social Reproduction«, in: dies. (Hg.): Money and Modernity: State and Local Currencies in Melanesia, Pittsburgh 1999, S. 1-40. Albert, Ethel M. -- »The Classification of Values: A Method and Illustration«, in: American Anthropologist, 58, 1956, S. 221-248. -- »Value Systems«, in: Sills, David (Hg.): The International Encyclopedia of Social Sciences, Bd. 16, 1968, S. 287-291. Anderson, Perry -- Von der Antike zum Feudalismus: Spuren der Übergangsgesellschaften, übers, v. Angelika Schweikhart, Frankfurt/M. 1978 [1974]. -- Die Entstehung des absolutistischen Staates, übers, v. Gerhard Fehn, Frankfurt/M. 1979 [1974]. Angas, George French -- Savage Life and Scenes in Australia and New Zealand. 2 Bde., London 1847. Appadurai, Arjun -- »Introduction: commodities and the politics of value«, in: ders. (Hg.): The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, Cambridge 1986, S. 3-63. Archer, Margaret, Bhaskar, Roy, Collier, Andrew, Lawson, Tony und Norrie, Alan (Hg.) -- Critical Realism: Essential Readings, New York 1998. Austin, Michel und Vidal-Naquet, Pierre -- Gesellschaft und Wirtschaft im alten Griechenland, übers, v. Andreas Wittenburg, München 1984 [1972].
- Babadzan, Alain -- Les dépouilles des dieux: Essai sur la religion tahitienne à l'époque de la découverte, Paris 1993. Barnes, Jonathan -- The Presocratic Philosophers, New York 1982. Barnett, Homer G. -- »The Nature of the Potlatch«, in: American Anthropologist, 40,1938, S. 349-358. -- The Nature and Function of the Potlatch, Eugene 1968. Barraud, Cécile, Coppet, Daniel de, Iteanu, André und Jamous, Raymond -- Of Relations and the Dead: Four Societies Viewed from the Angle of Their Exchanges, libers, v. Stephen J. Suffern, Oxford 1994. Barraud, Cécile -- Tanebar-Evav: une société de maisons tournée vers le large, Cambridge 1979. Barth, Fredrik -- Models of Social Organization, London 1966. Barthes, Roland -- Die Sprache der Mode, libers, v. Horst Brühmann, Frankfurt/M. 1985 [1967]. Battaglia, Debbora -- »Projecting Personhood in Melanesia: the Dialectics of Artefact Symbolism on Sabarl Island«, in: Man, 18, 1983, S. 289-304. -- On the Bones of the Serpent: Person, Memory and Mortality in Sabarl Island Society, Chicago 1990. Baudrillard, Jean -- Das System der Dinge, übers, v. Joseph Garzuly, Frankfurt/M. 1991 [1968]. -- Pour une critique de l'économie politique du signe, Paris 1972. -- Der symbolische Tausch und der Tod, übers, v. Gerd Bergfleth, 1982 [1976]. -- »Fetischismus und Ideologie: Die semiologische Reduktion«, in: Pontalis, Jean-Bertrand (Hg.): Objekte des Fetischismus, Frankfurt/M. 1972, S. 315-334. Beauchamp, William M. -- »The Iroquois White Dog Feast«, in: American Antiquarian, 7,1885, S. 235-239. -- »Onodaga Customs«, in: Journal of American Folklore 1, 1888, S. 195-203. -- »An Iroquois Condolence«, in: Journal of American Folklore, 8, 31, 1895, S. 313-316. -- »Wampum Used in Council and as Currency«, in: American Antiquarian, 20, 1, 1898, S. 1- 13. -- Wampum and Shell Articles Used by the New York Indians, Albany 1901. -- Civil, Religious and Mourning Councils and Ceremonies of Adoption of the New York Indians, Albany 1907. -- Iroquois Folk Lore, Syracuse 1922 (Nachdruck Port Washington 1965). Beidelman, Thomas O. -- »Agonistic Exchange: Homeric Reciprocity and the Heritage of Simmel and Mauss«, in: Cultural Anthropology, 4, 1989, S. 227-259. Berg, Gerald -- »Royal Authority and the Protector System in Nineteenth Century Imerina«, in: Kottak, Conrad P., Rakotoarisoa, J.-A., Southall, A. und Vérin, P. (Hg.): Madagascar: Society and History, Durham 1986. Berger, John -- Sehen. Das Bild der Welt in der Bilderwelt, übers, v. Axel Schenck, Reinbek 1976 [1972]. Bernard-Thierry, Solange -- »Perles magiques à Madagascar«, in: Journal de la Société des Africanistes, 29, 1959, S. 33- 90. Best, Elsdon -- »The Spiritual Concepts of the Maori, part 1«, in: Journal of the Polynesian Society, 9, 1900, S. 173-199. -- »The Spiritual Concepts of the Maori, part 2«, in: Journal of the Polynesian Society, 10, 1901, S. 1-20.
- -- »Maori Forest Lore, Part III«, in: Transactions of the New Zealand Institute, 43, 1909, S. 433-481. -- Spiritual and Mental Concepts of the Maori, Wellington 1922. -- The Maori, 2 Bde., Wellington 1924. -- Maori Religion and Mythology, Wellington 1924. -- Maori Agriculture, Wellington 1925. -- Tuhoe: Children of the Mist, 2.Bde., New Plymouth 1925. -- Fishing Methods and Devices of the Maori, Wellington 1929. -- Forest Lore of the Maori, Wellington 1942. Bhaskar, Roy -- The Possibility of Naturalism, Hempstead 1979. -- Reclaiming Reality, London 1989. -- Scientific Realism and Human Emancipation, London 1986. -- Philosophy and the Idea of Freedom, London 1991. -- Dialectic. The Pulse of Freedom, London 1993. -- Plato etc., London 1994. Blau, Harold -- »Dream Guessing: A Comparative Analysis«, in: Ethnohistory, 10, 3, 1963, S. 233-249. -- »The Iroquois White Dog Sacrifice: Its Evolution and Symbolism«, in: Ethnohistory, 11, 1964, S. Bloch, Maurice -- Placing the Dead: Tombs, Ancestral Villages, and Kinship Organization in Madagascar, London 1971. -- »Introduction«, in: Political Language and Oratory in Traditional Societies, London 1975, S. 1-28. -- »The disconnection between power and rank as a process: an outline of the development of kingdoms in central Madagascar«, in: European Journal of Sociology, 18, 1| 1977, S. 107-148. -- »Death, Women and Power«, in: ders. und Parry, Jonathan (Hg.): Death and the Regeneration of Life, Cambridge 1982, S. 211-30. -- From Blessing to Violence: History and Ideology in the Circumcision Ritual of the Merina of Madagascar, Cambridge 1986. -- »Hierarchy and Equality in Merina Kinship«, in: Kottak, Conrad P., Rako-toarisoa, J.-A., Southall, A. und Vérin, P. (Hg.): Madagascar: Society and History, Durham 1986, S. 215-228. -- »The Ritual of the Royal Bath in Madagascar: The Dissolution of Death, Birth, and Fertility into Authority«, in: ders.: Ritual, History and Power: Selected Papers in Anthropology, London 1989, S. 187-211. -- »The Symbolism of Money in Imerina«, in: ders. und Parry, Jonathan (Hg.): Money and the Morality of Exchange, Cambridge 1989, S. 165-190. Boas, Franz -- »The Social Organization and Secret Societies of the Kwakiutl Indians«, in: Report of the U.S. National Museum for 1895, 1897, S. 311-738. -- »Ethnology of the Kwakiutl«, in: Bureau of American Ethnology Thirty-fifth Annual Report, Teil 1 und 2, 1913-1914, Washington, D.C., 1921. -- »Contributions to the Ethnology of the Kwakiutl«, in: Columbia University Contributions to Anthropology, Bd. III, New York 1925. -- »The Religion of the Kwakiutl Indians«, in: Columbia University Contributions to Anthropology, Bd. X, New York 1930. -- »Kwakiutl Culture as Reflected in Mythology«, in: Memoirs of the American Folklore Society 28, New York 1935. -- »The Social Organization of the Kwakiutl«, in: ders.: Race, Language and Culture, New York 1940, S. 356-369. -- Kwakiutl Ethnography, hg. von Helen Codere, Chicago 1966. Bogart, John -- »The Currency Crisis in New Amsterdam«, De Halve Maen, 32, 1, 1957, S. 6-77. Bohannan, Paul
- -- »Some Principles of Exchange and Investment among the Tiv«, in: American Anthropologist 57, 1955, S. 60-67. -- »The Impact of Money on an African Subsistence Economy«, in: Journal of Economic History 19, 1959, S. 491-503. Bohannan, Paul und Bohannan, Laura -- Tiv Economy, Evanston 1968. Bosman, William -- A New and Accurate Description of the Coast of Guinea, London 1967 [1744]. Bourdieu, Pierre -- Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen Grundlage der kaby-lischen Gesellschaft, übers, v. Cordula Pialoux und Bern Schwibs, Frankfurt/M. 1976 [1972]. -- Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft, übers, v. Günter Seib, Frankfurt/M. 1987 [1980]. -- »Marginalia - Some Additional Notes on the Gift«, in: Schrift, Alan D. (Hg.): The Logic of the Gift: toward an Ethic of Generosity, New York 1997, S. 231-241. Buck, Peter -- The Coming of the Maori, Wellington 1950. Burling, Robbins -- »Maximization Theories and the Study of Economic Anthropology«, in: American Anthropologist 64,1962, S. 802-821. Caillé, Alain -- »Deux mythes modernes: la rareté et la rationalité économiques«, in: Bulletin duMAUSS, 12, 1984, S. 9-37. -- Critique de la raison utilitaire: Manifeste du MAUSS, Paris 1989. -- Don, intérêt et désintéressement: Bourdieu, Mauss, Platon et quelques autres, Paris 1994. Callet, François -- Tantara ny Andriana eto Madagascar, Tananarive 1908. Cannizzo, Jeanne -- »George Hunt and the Invention of Kwakiutl Culture«, in: Canadian Review of Sociology and Anthropology 20, 1983, S. 44-58. Carrier, James G. -- »Gifts in a World of Commodities: The Ideology of the Perfect Gift in American Society«, in: Social Analysis 29, 1990, S. 19-37. -- »Gifts, Commodities, and Social Relations: A Maussian View of Exchange«, in: Sociological Forum 6, 1991, S. 119-136. -- »The Gift in Theory and Practice in Melanesia: A Note on the Centrality of Gift Exchange«, in: Ethnology 31, 1992, S. 185-193. -- Gifts and Commodities: Exchange and Western Capitalism since 1700, London 1995. Casajus, Dominique -- »L'énigme de la troisième personne«, in: Galey, Jean-Claude (Hg.): Différences, valeurs, hiérarchie: textes offertes à Louis Dumont, Paris 1984, S. 65-78. Ceci, Lynn -- The Effect of European Contact and Trade on the Settlement Pattern of the Indians in Coastal New York, 1524-1665, New York 1977 [Dissertation; gedruckt New York 1990]. -- »Letters: The Cowrie Shells from the Little Neck Bay Area, Long Island«, in: Archaeology, 6, 1979, S. 63. -- »The First Fiscal Crisis in New York«, in: Economic Development and Cultural Change, 28, 1980, S. 839-847. -- »The Value of Wampum among the New York Iroquois: A Case Study in Artifact Analysis«, in: Journal of Anthropological Research, 38, 1, 1982, S. 97-107. Chafe, Wallace L. -- Seneca Thanksgiving Rituals, Washington, D.C., 1961. Chapus, George-Sully und Ratsimba, Emmanuel (Hg.) -- Histoires des Rois, 4 Bde., Tananarive 1953-58 (frz. Übers, v. Callet: Tantara ny Andriana, 1908). Clark, Jeffrey -- »Pearl-Shell Symbolism in Highland Papua New Guinea, with Particular Reference to the
- Wiru People of Southern Highlands Province«, in: Oceania, 61, 1991, S. 185-193. -- »Shit Beautiful: Tambu and Kina Revisited«, in: Oceania, 65, 1995, S. 195-211. Clellan, Ford S. -- Smoke from their Fires: the Life of a Kwakiutl Chief, hg. v. Charles J. Nowell, New Haven 1941 [Nachdruck 1968]. Codere, Helen -- Fighting with Property: A Study of Kwakiutl Potlatching and Warfare, 1792-1930, Seattle 1950. -- »The Amiable Side of Kwakiutl Life: The Potlatch and the Play Potlatch«, in: American Anthropologist, 58, 1956, S. 334-351. Cole, Douglas und Chaikin, Ira -- An Iron Hand Upon the People: The Law against the Potlatch on the Northwest Coast, Seattle 1990. -- Colenso, William »On the Maori Races of New Zealand«, in: Transactions of the New Zealand Institute 1, 1868, S. 339-424. Collier, Andrew -- Critical Realism: An Introduction to Roy Bhaskar's Philosophy, London 1994. Comaroff, John L. und Comaroff, Jean -- Of Revelation and Revolution: Christianity, Colonialism and Consciousness in South Africa, Chicago 1991. -- Ethnography and the Historical Imagination, Boulder 1992. Converse, Harriet M. -- Myths and Legends of the New York State Iroquois, hg. v. Arthur C. Parker, Albany 1974 [Nachdruck der Ausgabe von 1908]. Cook, Scott -- »The Obsolete >Anti-Market< Mentality: A Critique of the Substantivist Approach to Economic Anthropology«, in: American Anthropologist 68, 1966, S.323-345. Coppet, Daniel de -- »Cycles de meurtres et cycles funéraires. Esquisse de deux structures d'échanges«, in: Pouillon, J. und Maranda, P. (Hg.): Echanges et communications. Mélanges offerts à Claude Lévi- Strauss, Den Haag 1969, S. 759-781. -- »1, 4, 8; 9, 7. La monnaie: présence des morts et mésure du temps«, in: L'Homme, 10, 1, 1970, S. 17-39. -- »Premier troc, double illusion«, in: L'Homme, 13, 1-2, 1972, S. 10-22. -- »The Life-giving death«, in: Humphreys, S. C., und King, H. (Hg.): Mortality and Immortality: The Anthropology and Archaeology of Death, New York 1982. -- »Land Owns People«, in: Barnes, R. H., Coppet, Daniel de und Parkins, R. J. (Hg.): Contexts and Levels: Anthropological Essays on Hierarchy, Oxford 1985. -- »'Are'are Society: A Melanesian Socio-Cosmic Point of View. How are Big-men the Servants of Society and Cosmos?«, in: Coppet, Daniel de und Iteanu, André (Hg.): Cosmos and Society in Oceania, Oxford 1995, S. 235-274. Cousins, William E. -- Fomba Malagasy, hg. v. Henri Randzavola, Tananarive 1963. Curtis, E. S. -- The North American Indian, volume X. The Kwakiutl, New York 1915. Dalton, George -- »Economic Theory and Primitive Society«, in: American Anthropologist 62, 1961, S. 483- 490. -- »Primitive Money«, in: American Anthropologist 66, 1965, S. 44-65. Damon, Frederick H. -- Modes of Production and the Circulation of Value on the Other Side of the Kula Ring, Princeton 1978 [Dissertation]. -- »The Kula and Generalized Exchange: Considering Some Unconsidered Aspects of the Elementary Structures of Kinship«, in: Man, 15, 1980, S. 267-292. -- »Muyuw Kinship and the Metamorphosis of Gendered Labor«, in: Man, 18, 1983, S. 305- 326.
- -- »The Muyuw Lo'un and the End of Marriage«, in: Damon, Frederick und Wagner, Roy (Hg.): Death Rituals and Life in the Societies of the Kula Ring, DeKalb 1989, S. 73-94. -- »Representation and Experience in Kula and Western Exchange Spheres (Or, Billy)«, in: Research in Economic Anthropology, 14, 1993, S. 235-254. -- »The Problem of the Kula on Woodlark Island: Expansion, Accumulation, and Overproduction«, in: Ethnos, 45, 1980, S. 176-201. Davy, Georges -- La foi jurée: étude sociologique du problème du contrat et la formation du lien contractuel, Paris 1922. Delâge, Denys -- Bitter Feast: Amerindians and Europeans in Northeastern North America, 1600-64, Vancouver 1993. Deleuze, Gilles und Guattari, Felix -- Anti-Oedipus: Kapitalismus und Schizophrenie I, übers, v. Bernd Schwibs, Frankfurt/M. 1988 [1972]. Délivré, Alain -- L'Histoire des rois d'Imerina: interprétation d'une tradition orale, Paris 1974. Dennis, Matthew -- Cultivating a Landscape of Peace: Iroquois-European Encounters in Seventeenth-Century America, Ithaca 1993. Derrida, Jacques -- Falschgeld: Zeit geben 1, übers, v. Andreas Knop und Michael Wetzel, München 1993 [1991]. Domenichini, Jean-Pierre -- Les Dieux au service des rois: Histoire des Palladium d'Emyrne, Paris 1977. Donne, Thomas Edward -- The Maori Past and Present, London 1927. Dorfman, Ariel und Mattelart, Armand -- Walt Disneys »Dritte Welt«. Massenkommunikation und Imperialismus bei Micky Maus und Donald Duck, übers, von Gaston Richter u. Frowin Haas, Berlin 1977 [1971]. Douglas, Mary -- »Foreword: No Free Gifts«, in: Marcel Mauss: The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies, New York 1990, S. xii-xviii. Dresch, Paul -- »Mutual Deception: Totality, Exchange, and Islam in the Middle East«, in: Marcel Mauss: A Centenary Tribute, New York 1998, S. 111-133. Drucker, Philip und Heizer, Robert F. -- To Make My Name Great: A Reexamination of the Southern Kwakiutl Potlatch, Berkeley 1967. Druke, Mary A. -- »The Concept of Personhood in Seventeenth and Eighteenth Century Iroquois Ethnopersonality«, in: Bonvillain, Nancy (Hg.): Studies on Iroquoian Culture, Rindge 1980, S. 59- 69. -- »Iroquois Treaties: Common Forms, Varying Interpretations«, in: Jennings, F., Fenton, W., Druke, M. und Miller, D. (Hg.): History and Culture of Iroquois Diplomacy, Syracuse 1985, S. 85- 98. Duff, Wilson -- »The Killer Whale Copper: a Chief's Memorial to his Son«, in: Abbott, Donald N. (Hg.) : The World is as Sharp as a Knife: An Anthology in Honour of Wilson Duff, Victoria 1981, S. 153- 156. ^ ^ Dumont, Louis -- »Marcel Mauss: Eine Wissenschaft im Werden« [1952], in: ders.: Individualismus: Zur Ideologie der Moderne, übers, v. Una Pfau und Achim Russer, Hamburg 1991 [1983], S. 195-214. -- Gesellschaft in Indien: die Soziologie des Kastenwesens, übers, v. Margarete Venjakob,
- Wien 1976 [1966]. -- From Mandeville to Marx: The Genesis and Triumph of Economic Ideology, Chicago 1977. -- Individualismus: Zur Ideologie der Moderne, übers, v. Una Pfau und Achim Russer, Hamburg 1991 [1983]. Dürkheim, Emile -- De la division du travail social Étude sur l'organisation des sociétés supérieures, Paris 1893. Dürkheim, Emile und Mauss, Marcel -- »De quelques formes primitives de classifications. Contributions à l'étude des représentations collectives«, in: L'Année Sociologique 6, 1903, S. 1-72. Edmonson, Munro S. -- »The Anthropology of Values«, in: Taylor, Walter, Fischer, John und Vogt, Evon (Hg.): Culture and Life: Essays in Memory of Clyde Kluckhohn, Carbondale 1973, S. 157-197. Edmunds, William -- »Charms and Superstitions in Southeast Imerina«, in: Antananarivo Annual and Malagasy Magazine 22, 1897, S. 61-67. Ellis, William -- Historv of Madagascar, 2 Bde. London 1838. Engels, Friedrich -- Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, in: Karl Marx/ Friedrich Engels: Werke, Bd. 21, Berlin 1975 [1884], S. 25-173. Errington, Frederick und Gewertz, Deborah -- »The Remarriage of Yebiwali: A Study of Dominance and False Consciousness in a Non- Western Society«, in: Strathem, Marilyn (Hg.): Dealing with Inequality: Analysing Gender Relations in Melanesia and Beyond, Cambridge 1987, S. 63-88. Evans-Pritchard, Edward E. -- Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, Oxford 1937. -- The Nuer: the Political System and Mode of Livelihood of a Nilotic People, Oxford 1940. Fajans, Jane -- »Exchanging Products: Producing Exchange«, in: dies. (Hg.): Exchanging Products: Producing Exchange, Sydney 1993, S. 1-14. -- »The Alimentary Structures of Kinship: Food and Exchange among the Bain-ing of Papua New Guinea«, in: dies. (Hg.): Exchanging Products: Producing Exchange, Sydney 1993, S. 59-75. -- They Make Themselves: Work and Play among the Baining of Papua New Guinea, Chicago 1997. Faraone, Christopher und Obbink, Dirk (Hg.) -- Magika Hiera: Ancient Greek Magic and Religion, New York 1991. Fenton, William N. -- Songs from the Iroquois Longhouse, Washington, D.C., 1942. -- »An Iroquois Condolence Council for Installing Cayuga Chiefs in 1945«, in: Journal of the Washington Academy of Sciences, 36, 4, 1946, S. 110-127. -- The Roll Call of the Iroquois Chiefs: A Study of a Mnemonic Cane from the Six Nations Reserve, Washington, D.C., 1950. -- »The New York State Wampum Collection: The Case for Integrity of Cultural Treasures«, in: Proceedings of the American Philosophical Society, 115, 6, 1971, S. 437-461. -- »Northern Iroquois Culture Patterns«, in: Sturtevant, W. und Trigger, B. (Hg.): Handbook of North American Indians, Bd. 15: Northeast, Washington, D.C., 1978 S. 296-321. -- »Structure, Continuity, and Change in the History of Iroquois Treaty Making«, in: Jennings, Fenton, W., Druke, M. und Miller, D. (Hg.): History and Culture of Iroquois Diplomacy, Syracuse 1985, S. 3-36. -- The Great Law and the Longhouse: A Political History of the Iroquois Confederacy, Norman 1998. Ferguson, James -- »The Bovine Mystique«, in: Man, 20, 1985, S. 647-674.
- -- »Cultural Exchange: New Developments in the Anthropology of Commodities«, in: Cultural Anthropology 3, 1988, S. 488-513. Finley, Moses -- Die antike Wirtschaft, übers, v. Andreas Wittenburg, München 1993 [1973]. Firth, Raymond -- »The Analysis of Mana: An Empirical Approach«, in: Journal of the Polyne- sian Society, 49, 1940, S. 483-512 (erneut abgedruckt in ders.: Tikopia Ritual and Belief, London 1967). -- Economics of the New Zealand Maori, Wellington 1959. | -- »The Study of Values by Social Anthropologists«, in: Essays on Social Orga- $ nization and Values, London 1964, S. 206-224. | Ford, Clellan S. I -- Smoke from Their Fires: The Life of a Kwakiutl Chief, New Haven 1941. Foster, Michael K. I -- From the Earth to Beyond the Sky: An Ethnographic Approach to Four Long-house Iroquois Speech Events, Ottawa 1974. -- »Another Look at the Function of Wampum in Iroquois-White Councils«, in: F. Jennings, W. Fenton, M. Druke und Miller, D. (Hg.): History and Culture of Iroquois Diplomacy, Syracuse 1985, S. 125-142. Foster, Robert J. -- »Production and Value in the Enga Tee«, in: Oceania, 55, 1985, S. 182-196. -- »Value without Equivalence: Exchange and Replacement in a Melanesian Society«, in: Man, 25, 1990, S. 54-69. -- »Commodisation and the Emergence of kastom as a Cultural Category: A New Ireland Case in Comparative Perspective«, in: Oceania, 62, 1992, S. 284-294. -- »Dangerous Circulation and Revelatory Display: Exchange Practices in a New Ireland Society«, in: Fajans, Jane (Hg.): Exchanging Products: Producing Exchange, Sydney 1993, S. 15- 31. -- Social Reproduction and History in Melanesia: Mortuary Ritual, Gift Exchange, and Custom in the Tanga Islands, Cambridge 1995. Foucault, Michel -- Archciologie des Wissens, übers, v. Ulrich Koppen, Frankfurt/M. 1973 [1969]. -- Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, übers, v. Walter Seit-ter, Frankfurt/M. 1977 [1975]. Fournier, Marcel -- Marcel Mauss, Paris 1994. Gasché, Rudolphe -- »Heliocentric Exchange«, in: Schrift, Alan (Hg.) : The Logic of the Gift: Toward an Ethic of Generosity, New York 1997 [1972], S. 100-120. (Originaltitel: »L'échange héliocentrique«, in: L'Arcf 48, 1972, S. 70-84.) Gathercole, Peter -- >»Hau<, >Mauri< and >Utu«<, in: Mankind, 11, 1978, S. 334-340. Gauchet, Marcel -- Le désenchantement du monde: une histoire politique de la religion, Paris Geary, Patrick -- »Sacred Commodities: the Circulation of Medieval Relics«, in: Appadurai, Arjun (Hg.): The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, Cambridge 1986, S. 169-191. Geertz, Clifford -- The Interpretation of Cultures, New York 1973. Gell, Alfred -- Wrapping in Images: Tattooing in Polynesia, Oxford 1993. -- Art and Agency: An Anthropological Theory, Oxford 1998. -- The Art of Anthropology: Essays and Diagrams, London 1999. Geoghegan, Vincent -- Utopianism and Marxism, London 1987. Gewertz, Deborah -- Sepik River Societies: A Historical Ethnography of the Chambri and their Neighbors, New
- Haven 1983. Godbout, Jacques T. und Caillé, Alain -- The World of the Gift, Montreal 1998 [1992]. Godelier, Maurice -- Ökonomische Anthropologie: Untersuchungen zum Begriff der sozialen Struktur primitiver Gesellschaften, übers, v. Wolf H. Leube und Hans-Horst Hen-schen, Reinbek 1973 [1973]. -- The Making of Great Men: Male Domination and Power among the New Guinea Baruya, Cambridge 1986. -- Das Rätsel der Gabe: Geld, Geschenke, heilige Objekte, übers, v. Martin Pfeiffer, München 1999 [1996]. Golden weiser, Alexander A. -- »On Iroquois Work 1912«, in: Summary Report of the Geological Survey Branch of the Canadian Department of Mines for the Calendar Year 1912, Ottawa 1914, S. 464-475. . ' 11. . '^ jlft^ I. -- »On Iroquois Work 1913-14«, in: Summary Report of the Geological Survey Branch of the Canadian Department of Mines for the Calendar Year 1913, Ottawa 1914, S. 365-372. Goldman, Irving -- Ancient Polynesian Society, Chicago 1970. -- The Mouth of Heaven: An Introduction to Kwakiutl Religious Thought, New York 1975. Graeber, David -- »Dancing with Corpses Reconsidered: an Interpretation of Famadihana (in Arivonimamo, Madagascar)«, in: American Ethnologist, 22, 1995, S. 258-278. -- »Beads and Money: Notes toward a Theory of Wealth and Power«, in: American Ethnologist, 23, 1996, S. 1-32. -- »Love Magic and Political Morality in Central Madagascar, 1875-1990«, in: Gender and History, 8, 3, 1996, S. 94-117. -- »Manners, Deference and Private Property: The Generalization of Avoidance in Early Modern Europe«, in: Comparative Studies in Society and History, 39, 4, 1997, S. 694-728. Graf, Fritz -- Gottesnahe imd Schadenzauber. Die Magie der griechisch-rdmischen Antike, Miinchen 1996. Gregory, Christopher A. -- »Gifts to Men and Gifts to God: Gift Exchange and Capital Accumulation in Contemporary Papua«, in: Man, 15, 4, 1980, S. 626-652. -- Gifts and Commodities, London 1982. -- »Kula Gift Exchange and Capitalist Commodity Exchange: a Comparison«, in: Leach, Jerry W. (Hg.): The Kula: New Perspectives on Massim Exchange, Cambridge 1983, S. 103-117. -- »Cowries and Conquest: Towards a Subalternate Quality Theory of Money«, in: Comparative Studies in Society and History, 38, 2, 1996, S. 195-216. -- Savage Money: The Anthropology and Politics of Commodity Exchange, Amsterdam 1998. Gudgeon, C. M. G. -- »Mana Tangata«, in: Journal of the Polynesian Society, 14, 1905, S. 49-66. -- »Maori Religion«, in: Journal of the Polynesian Society, 14, 1905, S. 117-130. Gudgeon, Thomas Wayth (Hg.) -- The History and Doings of the Maoris: From the Year 1820 to the Signing of the Treaty ofWaitangi in 1840, Auckland 1885. Guthrie, William K. C. -- A History of Greek Philosophy, Bd. Ill, Cambridge 1971. Hale, Horatio E. -- The Iroquois Book of Rites, Philadelphia 1883 [Nachdruck 1965]. -- »The Iroquois Sacrifice of the White Dog«, in: American Antiquarian, 7, 1885, S. 7-14. -- »An Iroquois Condoling Council«, in: Transactions of the Royal Society of Canada, 1, 2, 1895, S. 45-65. Hallowell, A. Irving
- -- »Ojibwa Ontology, Behavior, and World View«, in: Diamond, Stanley (Hg.): Culture in History: Essays in Honor of Paul Radin, New York 1960, S. 19-52. -- »The Ojibwa Self in its Behavioral Environment«, in: ders.: Culture and Experience, Philadelphia 1967, S. 172-182. Hallpike, C. R. -- The Foundations of Primitive Thought, Oxford 1979. Hamell, George R. -- »Trading in Metaphors: The Magic of Beads«, in: Proceedings of the 1982 Glass Trade Bead Conference, hg. v. Charles Hayes, Rochester 1983, S. 5-28. -- »Mythical Realities and European Contact in the Northeast During the 16th and 17th Centuries«, in: Man in the Northeast, Nr. 33, 1987, S. 63-87. -- »The Iroquois and the World's Rim: Speculations on Color, Culture, and Contact«, in: American Indian Quarterly 16 (4), 1992, S. 451-469. Harris, Marvin -- Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture, New York 1979. Hart, Keith -- »Heads or tails? Two Sides of the Coin«, Man, 21, 4, 1986, S. 637-656. -- The Memory Bank: Money in an Unequal World, London 2000. Heckewelder, Johann -- Nachricht von der Geschichte, den Sitten und Gebräuchen der Indianischen Völkerschaften, welche ehemals Pennsylvanien und die benachbarten Staaten bewohnten, Göttingen 1821. Heidenreich, Conrad E. -- Huronia: A History and Geography of the Huron Indians 1600-1650, Ottawa 1971. Hertz, Gilbert -- »La Prééminence de la main droite: étude sur la polarité religieuse«, in: Revue Philosophique, 68, 1907, S. 553-580. Heusch, Luc de -- »The Symbolic Mechanisms of Sacred Kingship: Rediscovering Frazer«, in: Journal of the Royal Anthropological Institute, 3, 1998, S. 213-232. Hewitt, John N. B. -- »New Fire among the Iroquois«, in: American Anthropologist, 2,1889, S. 319. -- »Legend of the Founding of the Iroquois League«, in: American Anthropologist, 5, 2, 1892, S. 131-148. -- »The Iroquoian Concept of the Soul«, in: Journal of American Folklore, 8, 29, 1895, S. 107- 116. -- »Iroquoian Cosmology: First Part«, in: Annual Report of the Bureau of American Ethnology for the years 1899-1900. Washington, D.C., 1903, S. 127-339. -- »Wampum«, in: Hodge, F. W. (Hg.): Handbook of American Indians North of Mexico, Bd. 2, Washington, D.C., 1910, S. 904-909. -- »White Dog Sacrifice«, in: Hodge, F. W. (Hg.): Handbook of American Indians North of Mexico, Bd. 2, Washington, D.C., 1910, S. 939-944. -- »The White-dog Feast of the Iroquois«, in: American Anthropologist, 12, 1910, S. 86-87. -- »Iroquoian Cosmology: Second Part, with Introduction and Notes«, in: Annual Report of the Bureau of American Ethnology for the Years 1925-1926, Washington, D.C., 1928, S. 449-819. Hewitt, John N. B. und Fenton, William N. -- »The Requickening Address of the Iroquois Condolence Council«, in: Journal of the Washington Academy of Sciences 34 (3), 1944, S. 65-85. Hickerson, Harold -- »The Feast of the Dead among the Seventeenth-Century Algonkians of the Upper Great Lakes«, in: Ethnohistory 62, i960, S. 81-107. Hobbes, Thomas -- Leviathan, übers, v. Jutta Schlösser, Hamburg 1996 [1651]. Hogden, Margaret -- Early Anthropology in the 16th and 17th Centuries, Philadelphia 1964. Holmes, William -- »Art in Shell of the Ancient Americans«, in: Second Annual Report of the Bureau of American Ethnology 1880-1881, 1883, S. 185-305.
- Iteanu, André -- Le ronde des échanges: de la circulation aux valeurs chez les Orokaiva, Paris 1983. -- »Idéologie patrilinéaire ou idéologie de l'anthropologue?«, in: L'Homme 23 (2), 1983, S. 37- 55. -- »The Concept of the Person and the Ritual System: An Orokaiva View«, in: Man, 25, 1990, S. 35-53. Jacobs, Wilbur -- »Wampum, the Protocol of Indian Diplomacy«, in: William and Mary Quarterly 6, 1949, S. 596-604. Jamous, Raymond -- Honneur et Baraka: les structures sociales traditionnelles dans le Rif, Paris 1981. Jennings, Francis -- The Invasion of America: Indians, Colonialism, and the Cant of Conquest, New York 1976. -- The Ambiguous Iroquois Empire: The Covenant Chain Confederation of Indian Tribes with English Colonies from its beginnings to the Lancaster Treaty of 1744, New York 1984. Jennings, Francis, Fenton, William, Druke, Mary und Miller, David -- »Glossary of Figures of Speech in Iroquois Political Rhetoric«, in: dies. (Hg.): History and Culture of Iroquois Diplomacy, Syracuse 1985, S. 115-124. Joas, Hans -- The Creativity of Action, Chicago 1996. Johansen, J. Prytz -- The Maori and His Religion, Kopenhagen 1954. -- Studies in Maori Rites and Myths, Kopenhagen 1958. Jonaitis, Aldona (Hg.) -- Chiefly Feasts: The Enduring Kwakiutl Potlatch, New York 1991. Jones, Pei Te Hurinui -- The Traditional History of the Tainui People, Auckland 1995. Josephides, Lisette -- Suppressed and Overt Antagonism: A Study in Aspects of Power and Reciprocity among Northern Melpa, Papua New Guinea 1982. -- »Equal but different? The Ontology of Gender among the Kewa«, in: Oceania, 53, 3, 1983, S. 291-307. -- The Production of Inequality: Gender and Exchange among the Kewa, London 1985. -- »Metaphors, Metathemes, and the Construction of Sociality: A Critique of the New Melanesian Ethnography«, in: Man, 26, 1991 S. 145-161. -- »Replacing Cultural Markers: Symbolic Analysis and Political Action in Melanesia«, in: de Coppet, Daniel und Iteanu, André (Hg.): Cosmos and Society in Oceania, Oxford 1995, S. 189-212. Kan, Sergei -- Symbolic Immortality: The Tlingit Potlach of the 19th Century, Washington, D.C., 1989. Kapferer, Bruce (Hg.) -- Transaction and Meaning: Directions in the Anthropology of Exchange and Symbolic Behavior, Philadelphia 1976. Keane, Webb -- »The Value of Words and the Meaning of Things in Eastern Indonesian Exchange«, in: Man, 29, 1994, S. 605-629. -- Signs of Recognition: Powers and Hazards of Representation in an Indonesian Society, Berkeley 1997. -- »From Fetishism to Sincerity: on Agency, the Speaking Subject, and their Historicity in the Context of Religious Conversion«, in: Comparative Studies in Society and History 39, 1977, S. 74- 693. Kelly, Leslie G. (Te Putu) -- Tainui: The Story of Hotoroa and his Descendants, Wellington 1949. Kirk, Geoffrey S. (Hg.) -- Heraclitus: The Cosmic Fragments, Cambridge 1962. Kluckhohn, Clyde -- »The Philosophy of the Navaho Indian«, in: Northrop, Filmer S. (Hg.): Ideological Differences and World Order, New Haven 1949, S. 356-384. -- »Values and Value-orientations in the Theory of Action: an Exploration in Definition and
- Classification«, in: Parsons, Talcott und Shils, Edward (Hg.): Toward a General Theory of Action, Cambridge 1951, S. 388-433. -- »A Comparative Study of Values in Five Cultures«, in: Vogt, Evon Z.: Navaho Veterans, Cambridge 1951, S. vii-xii. -- »Towards a Comparison of Value-emphases in Different Cultures«, in: White, Leonard (Hg.): The State of the Social Sciences, Chicago 1956, S. 116-132. -- »The Study of Values«, in: Barrett, Donald (Hg.): Values in America, Notre Dame 1961, S. 17-45. Kluckhohn, Florence und Strodtbeck, Fred -- Variations in Value Orientation, Evanston 1961. Kobrinsky, Vernon -- »Dynamics of the Fort Rupert Class Struggle: Or, Fighting with Property Vertically Revisited«, in: Serl, Vernon C. und Taylor, Herbert C. (Hg.): Papers in Honor of Harry Hawthorne, Bellingham 1975, S. 32-59. Kopytoff, Igor -- »The Cultural Biography of Things: Commoditization as Process«, in: Appa-durai, Arjun (Hg.): The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective), Cambridge 1986, S. 64-94. Lacan, Jacques -- »Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion, wie sie uns in der psychoanalytischen Erfahrung erscheint [kommentiert (D)]«, in: ders.: Schriften I, Bd. 1, ausgew. u. hg. v. Norbert Haas, Weinheim 1991, S. 61-70. Leach, Edmund -- Political Systems of Highland Burma, Cambridge 1954. -- Social Anthropology, Oxford 1982. Lévi-Strauss, Claude -- Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft, übers, v. Eva Moldenhauer, Frankfurt/M. 1981 [1949]. -- »Einleitung in das Werk von Marcel Mauss«, in: Marcel Mauss, Soziologie und Anthropologie, Bd. 1. Theorie der Magie. Soziale Anthropologie, übers, v. Henning Ritter, München 1974 [1904], S. 7-41. -- Strukturale Anthropologie, übers, v. Hans Naumann, Frankfurt/M. 1971 [1958]. -- Das Ende des Totemismus, übers, v. Hans Naumann, Frankfurt/M. 1965 [1962]. -- Das wilde Denken, übers, v. Hans Naumann, Frankfurt/M. 1968 [1966]. -- Der Weg der Masken, übers, v. Eva Moldenhauer, Frankfurt/M. 1977 [1975]. -- Die eifersüchtige Töpferin, übers, v. Hans-Horst Henschen, Nördlingen 1987 [1985]. Liep, John -- »Gift Exchange and the Construction of Identity«, in: Jukka Siikala (Hg.), Culture and History in the Pacific, Helsinki 1990, S. 164-183. Loskiel, Georg Heinrich -- Geschichte der Mission der evangelischen Brüder unter den Indianern in Nordamerika, Barby 1789. MacCormack, Geoffrey -- »Mauss and the >Spirit< of the Gift«, in: Oceania, 52, 1982, S. 286-293. MacGaffey, Wyatt -- »African Objects and the Idea of the Fetish«, in: RES. Journal of Anthropology and Aesthetics, 25, 1994, S. 123-131. MacPherson, Crawford B. -- The Political Theory of Possessive Individualism, Oxford 1962. Malinowski, Bronislaw -- Argonauten des westlichen Pazifik, übers, v. Heinrich Ludwig Herdt, Frankfurt/M. 1979 [1922]. -- Das Geschlechtsleben der Wilden in Nordwest-Melanesien, übers, v. Eva Schumann Frankfurt/M. 1979 [1929]. -- Korallengärten und ihre Magie, übers, v. Gertraud Marx, Frankfurt/M. 1981 [1935]. Maning, Frederick Edward -- Old New Zealand, London 1863 (Neuausg. 2001 von Alex Calder). Martien, Jerry
- -- Shell Game: A True Account of Beads and Money in North America, Sai Francisco 1996. Marx, Karl -- Thesen über Feuerbach, in: ders. und Engels, Friedrich: Werke, Bd. 3, Berlin 1969 [1845], S. 533 ff. -- Grundrisse der politischen Ökonomie. Formen, die der kapitalistischen Produktion vorhergehn, in: Werke, Bd. 42, Berlin 1983 [1858], S. 19-875. -- Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: ders. und Engels, Friedrich: Werke, Bd. 13, Berlin 1971 [1859], S. 3-160. -- Das Kapital, Bd. 1, in: ders. und Engels, Friedrich: Werke, Bd. 23, Berlin 1968 [1867], S. 49-98. Marx, Karl und Engels, Friedrich Ü Die deutsche Ideologie, in: dies.: Werke, Bd. 3, Berlin 1969 [1846], S. 5-530. Marx-Aveling, Eleanor -- »Karl Marx. Lose Blätter« in: Mohr und General, Berlin 1964, S. 269-279. Masco, Joseph -- »It Is a Strict Law that Bids Us Dance: Cosmologies, Colonialism, Death, and Ritual Authority in the Kwakwaka'wakw Potlatch, 1849 to 1922«, in: Comparative Studies in Society and History, 37, 1995, S. 41-75. Mauss, Marcel -- »Les idées socialistes. Le principe de la nationalisation« [1920], in: ders.: Écrits Politiques: Textes réunis et présentés par Marcel Fournier, Paris 1997, S. 249-266. -- »Pour les bolchevistes«, in: ders.: Écrits Politiques: Textes réunis et présentés par Marcel Fournier, Paris 1997 [1921], S. 405-406. -- »Une forme ancienne de contrat chez les thraces«, in: ders., OEuvres III, Paris 1969 [1921], S. 35-45., -- »La vente de la Russie«, in: ders., Écrits Politiques: Textes réunis et présentés par Marcel Fournier, Paris 1997 [1922], S. 472-476. -- »L'obligation à rendre les présents«, in: Compte rendu d'une communication présentée à l'Institut français de l'anthropologie. Anthropologie 33, 1923, S. 193-94. -- »Intervention à la suite d'une communication d'Aftalion: >Les fondements du socialisme'«, in: ders., OEuvres III, Paris 1969 [1924], S. 634-38. -- »Gift gift«, in: ders., OEuvres III, Paris 1969 [1924], S. 46-51. -- »Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften«, in: ders., Soziologie und Anthropologie, Bd. 1., übers, v. Eva Moldenhauer, München 1974 [1925]. -- »Socialisme et bolchevisme«, in: ders., Écrits Politiques: Textes réunis et présentés par Marcel Fournier, Paris 1997 [1925], S. 699-721. -- »Letters on communism, fascism and nazism«, in: Gane, Mike (Hg.): The Radical Sociology of Dürkheim and Mauss, New York, 1992 [1936], S. 213-215. -- »Eine Kategorie des menschlichen Geistes: Der Begriff der Person und des >Ich<«, in: ders., Soziologie und Anthropologie, Bd. 2. Gabentausch. Soziologie und Psychologie. Todesvorstellung. Körpertechniken. Begriff der Person, übers, v. Eva Moldenhauer, München 1974 [1938]. -- Handbuch der Ethnographie, hg. v. Iris Därmann und Kirsten Mahlke, übers, v. L. Dinkel und A. Haarmann, München 2012 [1947] (in Vorbereitung). Mauss, Marcel und Hubert, Henri -- »Entwurf einer allgemeinen Theorie der Magie« [1902-1903], in: dies.: Soziologie und Anthropologie Bd. 1. Theorie der Magie. Soziale Morphologie, übers, v. Henning Ritter, München 1974, S. 43-179. McCall, Grant -- »Association and Power in Reciprocity and Requital: More on Mauss and the Maori«, in: Oceania, 52, 1982, S. 303-319. McKirahan, Richard -- Philosophy Before Socrates: An Introduction with Texts and Commentary, Indianapolis 1994. Mead, Sidney
- -- Traditional Maori Clothing, Wellington 1969. Meggitt, Mervyn J. -- »From Tribesmen to Peasants: the Case oft he Mae-Enga of New Guinea«, in: Hiatt, Lester R. and Jayawardena, Chandra (Hg.): Anthropology in Oceania: Essays presented to Ian Hogbin, Sydney 1971, S. 191-209. Meillassoux, Claude -- Die wilden Früchte der Frau. Über häusliche Produktion und kapitalistische Wirtschaft, übers, v. Eva Moldenhauer, Frankfurt/M. 1976 [1975]. Meritens, Guy de und Veyrieres, Paul de -- Livre de la sagesse malgache, Paris 1967. Metge, A. Joan -- The Maori of New Zealand: Rautahi, London 1976. Michelson, Gunther -- »Upstreaming Bruyas«, in: Foster, Michael K. (Hg.): Papers in Linguistics from the 1972 Conference on Iroquois Research, Ottawa 1974, S. 36-46. Miller, Daniel -- Material Culture and Mass Consumption, London 1987. -- Acknowledging Consumption: A Review of New Studies, (Hg.), London 1995. Mitchell, J. H. (Tiaki Hikawera Mitira) -- Takitimu, Wellington 1944. Mithun, Marianne -- »The Proto-Iroquoians: Cultural Reconstruction from Lexical Materials«, in: Foster, Michael K., Campisi, J. und Mithun, Marianne (Hg.): Extending the Rafters: Interdisciplinary Approaches to Iroquoian Studies, Albany 1984, S. 259-281. Modjeska, Nicholas -- »Exchange value and Melanesian trade reconsidered«, in: Gardiner, Don und Modjeska, Nicholas: Recent Studies in the Political Economy of Papua New Guinea Societies, Sydney 1985, S. 145-162. Morgan, Lewis Henry -- League of the Ho-de'-no-sau-nee, or Iroquois, Secaucus 1962 [1851]. Munn, Nancy -- »Symbolism in a Ritual Context: Aspects of Symbolic Action«, in: Honig-mann, J. J. (Hg.): Handbook of Social and Cultural Anthropology, Chicago 1973, S. 579-612. -- »The Spatiotemporal Transformations of Gawan canoes«, in: Journal de la Société des Océanistes, Bd. 33 (März-Juni), 54-55, 1977, S. 39-53. -- »Gawan Kula: Spatiotemporal Control and the Symbolism of Influence«, in: Leach, J. und Leach, E. (Hg.): The Kula: New Perspectives on Maèsim Exchange, Cambridge 1983, S. 277-308. -- The Fame of Gawa: A Symbolic Study of Value Transformation in a Massim (Papua New Guinea) Society, Cambridge 1986. Myers, Fred -- Pintupi Country, Pintupi Self: Sentiment, Place, and Politics among Western Desert Aborigines, Washington 1986. Myers, Fred und Brenneis, Donald -- »Introduction: Language and Politics in the Pacific«, in: dies. (Hg.): Dangerous Words: Language and Politics in the Pacific, Prospect Heights 1991, S. 1-29. Needham, Rodney -- Right and Left, Chicago, 1973. Nicolas, Guy -- »Le don rituel, face voilée de la modernité«, in: Revue du MAUSS 12, 1991, S. 7-29. Nuckolls, Charles W. -- Culture: A Problem that Cannot Be Solved, Madison 1998. Oberg, Kalervo -- »The Kingdom of Ankole in Uganda«, in: Fortes, Meyer und Evans-Pritchard, Edward (Hg.): African Political Systems, London 1940, S. 121-162. -- Social Economy of the Tlingit Indians, Seattle 1973. Oilman, Bertell -- Alienation. Marx's Conception of Man in Capitalist Society, Cambridge 1971. Ong, Walter -- In the Presence of the Word, New Haven 1967. -- Interfaces of the Word, New Haven 1977. Ottino, Paul -- »La mythologie malgache des Hautes Terres: Le cycle des Andriambahoaka«, in: Bonnefoy,
- Yves (Hg.): Dictionnaire des Mythologies, Bd. 2, Paris 1981, S. 30-45. Pannel, Sandra -- »Circulating Commodities: Reflections on the Movement and Meaning of Shells and Stories in North Australia and Eastern Indonesia«, in: Oceania, 64, 1993 S. 57-76. -- »Marcel Mauss: The Gift Revisited«, in: Man, 5, 1970, S. bu-/u. Parker, Arthur C. -- The Constitution of the Five Nations, or the Iroquois Book of the Great Lc Albany 1916. -- Seneca Myths and Folk Tales, Buffalo 1923. -- An Analytical History of the Seneca Indians, Rochester 1926. -- Parker on the Iroquois, hg. von William N. Fenton, Syracuse 1968. Parry, Jonathan -- »The Gift, the Indian Gift, and the >Indian Gift«<, in: Man, 21, 1986, S. 4 473. Parry, Jonathan und Bloch, Maurice -- »Introduction: Money and the Morality of Exchange«, in: dies. (Hg.): Mc and the Morality of Exchange, Cambridge 1989. Parsons, Talcott und Shils, Edward A. (Hg.) -- Toward a General Theory of Action, Cambridge 1951. Peristiany, John G. (Hg.) -- Honour and Shame: The Values of Mediterranean Society, Chicago 1966 Piaget, Jean -- The Psychology of Intelligence, New York 1967. -- Der Strukturalismus, übers, von Lorenz Häfliger, Ölten 1973 [1968]. -- Sociological Studies, London 1995 [1965]. Pietz, William -- »The Problem of the Fetish I«, in: RES. Journal of Anthropology and Ae ics 9, 1985, S. 5- 17. -- »The Problem of the Fetish II: The Origin of the Fetish« RES. Joun Anthropology and Aesthetics 13, 1987, S. 23-45. -- »The Problem of the Fetish Ilia: Bosnian's Guinea and the Enlightei Theory of Fetishism«, in: RES. Journal of Anthropology and Aesthetics 16, S. 105-123. -- »Fetishism and Materialism: The Limits of Theory in Marx«, in: Apter, und Pietz, William (Hg.): Fetishism as Cultural Discourse, Ithaca 1993, S 151. -- »The Spirit of Civilization: Blood Sacrifice and Monetary Debt«, in: REt nal of Anthropology and Aesthetics 28, 1995, S. 23-38. -- »Death and the Deadened: Accursed Objects and the Money Value of I Life«, in: Farquar, Masuzawa, Judith Tomoko und Mavor, Carol (Hg.' Fixing Representation, Minneapolis 1995. Polack, Joel S. -- Manners and Customs of the New Zealanders, 2 Bde., London 1840. Polanyi, Karl -- The Great Transformation: Politische und ökonomische Ursprünge vor Schäften und Wirtschaftssystemen, übers, v. Heinrich Jelinek, Franl und Pearson, Harry W. (Hg.), Trade and Market in the Early Empires, Glenco 1957. -- »Anthropology and Economic Theory«, in: Fried, Morton (Hg.): Readings in Anthropology, Bd. 2, New York 1959, S. 215-238. -- Primitive, Archaic, and Modern Economies: Essays of Karl Polanyi, hg. v. George Dalton, New York 1968. Postone, Moishe -- »Anti-Semitism and National Socialism«, in: Rabinbach, Anson und Zipes, Jack (Hg.): Germans and Jews Since the Holocaust: the Changing Situation in West Germany, New York 1986, S. 302-314. Pye, Christopher -- »The Sovereign, the Theatre, and the Kingdome of Darkness: Hobbes and the Spectacle of Power«, in: Representations, 8, 1984, S. 85-106. Quain, Buell -- »The Iroquois«, in: Mead, Margaret (Hg.): Cooperation and Competition Among Primitive Peoples, New York 1937, S. 240-281. Quiggin, Alison H. -- Trade Routes, Trade and Currency in East Africa, Livingstone 1949. Racine, Luc
- -- »L'Obligation de rendre les présents et l'esprit de la chose donnée: de Marcel Mauss à René Maunier«, in: Diogène, 154, 1991, S. 69-94. Renel, Charles -- Contes de Madagascar, Paris 1910. -- »Les Amulettes Malgaches: Ody et Sampy«, in: Bulletin de l'Académie Malgache, 2, 1915, S. 31-279. -- »Ancêtres et dieux«, in: Bulleün de l'Académie Malgache, 5, 1920, S. 1-261. Richardson, John (Hg.) -- A New Malagasy-English Dictionary, Antananarivo 1885. Richter, Daniel K. -- »War and Culture: the Iroquois Experience«, in: The William and Mary Quarterly, 3. Folge, 40, 4, 1983, S. 528-559. -- The Ordeal of the Longhouse: The Peoples of the Iroquois League in the Era of European Colonization, Chapel Hill 1992. Ricceur, Paul -- Geschichte und Wahrheit, übers, v. Romain Leick, München 1974 [1955]. Robbins, Joel -- »Keeping to Oneself in Melanesia: Secrecy, Not-Reciprocity, and Cultural Theory«, 1987 (Vortrag, gehalten auf der Jahreskonferenz der Paper American Anthropological Association, Chicago). -- »Equality as a Value: Ideology in Dumont, Melanesia and the West«, in: Social Analysis 36, 1994, S. 21-70. Rosman, Abraham und Rubel, Paula -- Feasting with Mine Enemy: Rank and Exchange among Northwest Coast Societies, Prospect Heights 1986 [1971]. Rospabe, Philippe -- La dette de vie: aux origines de la monnaie sauvage, Paris 1995. Ruud, Jorgen -- Taboo: A Study of Malagasy Customs and Beliefs, New York 1960. Sahlins, Marshall -- Stone Age Economics, Chicago 1972. -- Kultur und praktische Vernunft, übers, v. Brigitte Luchesi, Frankfurt/M. 1981 [1976]. -- Der Tod des Kapitän Cook: Geschichte als Metapher und Mythos als Wirklichkeit in der Frühgeschichte des Königreichs Hawaii, übers, v. Hans Medick und Michael Schmidt, Berlin 1986 [1981]. -- »Individual Experience and Cultural Order«, in: Kruskal, William (Hg.): The Social Sciences: Their Nature and Uses, Chicago 1982. -- Inseln der Geschichte, übers, v. Ilse Utz, Hamburg 1992 [1985]. -- »Cosmologies of Capitalism«, in: Proceedings of the British Academy 74,1988, S. 1-51. -- »The Return of the Event, Again: With Reflections on the Beginnings of the Great Fijian War of 1843 to 1855 Between the Kingdoms of Bau and Rewa«, in: Aletta Biersack (Hg.): Clio in Oceania, Washington 1991, S. 37-99. -- »Foreword«, in: Schrempp, Gregory: Magical Arrows: The Maori, the Greeks, and the Folklore of the Universe, Madison 1992, S. ix-xiii. -- How »Natives« Think: About Captain Cook, For Example, Chicago 1995. -- Culture in Practice: Selected Essays, New York 2000. Salmond, Anne -- >»Te Ao Tawhitoc A Semantic Approach to the Traditional Maori Cosmos«, in: Journal of the Polynesian Society, 87, 1978, S. 5-28. Hui, Wellington 1983. -- »Nga Huarahi O Te Ao Maori (Pathways in the Maori World)«, in: Mead Sidney M. (Hg.): Te Maori, Maori Art from New Zealand Collections, New York 1984, S. 109-137. -- Between Worlds: Early Exchanges Between Maori and Europeans 1773-1815, Honolulu 1997. Saussure, Ferdinand de -- Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, übers, v. Hermann Lom-mel, Berlin 1967 [1916].
- Scarry, Elaine -- Der Körper im Schmerz. Die Chiffren der Verletzlichkeit und die Erfindung der Kultur, Frankfurt/M. 1992 [1985]. Schlanger, Nathan -- »The study of techniques as an ideological challenge: Technology, Nation, and Humanity in the Work of Marcel Mauss«, in: James, Wendy und Allen, N. J. (Hg.): Marcel Mauss. A Centenary Tribute, New York 1998, S. 192-212. bcnrempp, Gregory -- Magical Arrows: The Maori, the Greeks, and the Folklore of the Universe, Madison 1992. Schrift, Alan D. (Hg.) -- The Logic of the Gift: toward an Ethic of Generosity, New York 1997. Schulte-Tenckhoff, Isabelle -- Potlatch, conquête et invention: réflexions sur un concept anthropologique, Lausanne 1986. Schwimmer, Eric -- »Guardian Animals of the Maori«, in: Journal of the Polynesian Society, 72, 1963, S. 397- 410. -- »Lévi-Strauss and Maori Social Structure«, in: Anthropologica, 20, 1978, S. 201-222. -- »The Maori Hapu: a Generative Model«, in: Journal of the Polynesian Society, 99, 1990, S. 297-317. Scott, James D. -- Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts, New Haven 1990. Sewid-Smith, Daisy -- »Kwagiutl Ceremonial Blankets«, in: Jensen, Doreen and Sargent, Polly (Hg.): Robes of Power: Totem Poles on Cloth, Vancouver 1986. Shell, Marc -- The Economy of Literature, Baltimore 1978. Shimony, Annemarie -- Conservatism among the Six Nations Iroquois Reservation, New Haven 1961. Shirres, M. P. -- »Tapu«, in: Journal of the Polynesian Society, 91, 1, 1982, S. 29-51. Shortland, Edward -- Traditions and Superstitions of the New Zealanders, London 1856. Maori Religion and Mythology, London 1882. Sibree, James -- Madagascar: The Great African Island, London 1880. --- Madagascar Before the Conquest: The Island, the Country, and the People, London 1896. Silverman, Kaja -- »Fragments of a Fashionable Discourse«, in: Modleski, Tania (Hg.): Studies in Entertainment: Critical Approaches to Mass Culture, Bloomington 1985, S. 215-247. Simmel, Georg -- Philosophie des Geldes, Berlin 1900. Siou, Georges E. -- Huron-Wendat: The Heritage of the Circle, Vancouver 1999. Slotkin, J. S. und Schmidt, Karl -- »Studies of Wampum«, in: American Anthropologist 51, 1,1949, S. 223-236. Smith, Erminnie A. -- »Myths of the Iroquois«, in: Second Annual Report of the Bureau of American Ethnology for the Years 1880-1881, Washington, D.C., 1883 S. 47-116. Smith, Jean -- Tapu Removal in Maori Religion, Wellington 1974. Smith, S. Percy -- History and Traditions of the Taranaki Coast, Wellington 1910 [Nachdruck 1984]. Smith, Timothy -- »Wampum as Primitive Valuables«, in: Research in Economic Anthropology, 5, 1983, S. 225-246. Snyderman, George S. -- »The Functions of Wampum«, in: Proceedings of the American Philosophical Society, 93, 6, 1954, S. 469-494.
- -- »The Functions of Wampum in Iroquoian Religion«, in: Proceedings of the American Philosophical Society, 105, 1961, S. 571-605. Speck, Frank G. -- The Functions of Wampum Among the Eastern Algonquin, Lancaster 1919. -- Midwinter Rites of the Cayuga Long House, Philadelphia 1949. Stallybrass, Peter -- »Marx's Coat«, in: Spyer, Patricia (Hg.): Border Fetishisms: Material Objects in Unstable Spaces, New York 1998, S. 183-207. Starna, William A. und Watkins, Ralph -- »Northern Iroquoian Slavery«, in: Ethnohistory, 38, 1,1991, S. 34-57. Stirling, Amiria Manutahi und Salmond, Anne -- Amiria: The Life Story of a Maori Woman, Wellington 1976. Strathern, Andrew -- The Rope of Moka: Big-Men and Ceremonial Exchange in Mount Hagen, New Guinea, Cambridge 1971. -- »Gender, Ideology and Money in Mount Hagen«, in: Man, 14, 3, 1979, S. 530-548. Strathern, Marilyn -- No Money on Our Skins: Hagen Migrants in Port Moresby, Port Moresby 1975. -- »Culture in a Netbag: The Manufacture of a Subdiscipline in Anthropology«, in: Man, 1981, S. 665-688. -- »Subject or object? Women and the circulation of valuables in Highlands New Guinea«, in: Hirschon, Renée (Hg.): Women and Property - Women as Property, New York 1984, S. 158-175. -- »Marriage Exchanges: A Melanesian Comment«, in: Annual Review of Anthropology 13, 1984, S. 41-73. -- »Conclusion«, in: Strathern, Marilyn (Hg.) : Dealing with Inequality: Analysing Gender Relations in Melanesia and Beyond, Cambridge 1987, S. 278-302. -- The Gender of the Gift: Problems with Women and Problems with Society in Melanesia, Berkeley 1988. -- »Qualified Value: The Perspective of Gift Exchange«, in: Humphrey, Caroline, und Hugh- Jones, Stephen (Hg.): Barter, Exchange and Value: An Anthropological Approach, Cambridge 1992, S. 169-191. Suttles, Wayne -- »Coping with Abundance: Subsistence on the Northwest Coast«, in: Lee, Richard B. und DeVore, Irvin (Hg.): Man the Hunter, Chicago 1968, S. 56-69. Taïeb, Paulette -- »L'Oreille du sourd«, in: Bulletin du MAUSS. 11, 1984, S. 39-69. Tambiah, Stanley J. -- »The Magical Power of Words«, in: Man, 3, 1968, S. 175-208. -- »The Form and Meaning of Magical Acts: A Point of View«, in: Horton, Robin und Finnegan, Ruth (Hg.): Modes of Thought, London 1973, S. 199-229. -- Culture, Thought and Social Action: An Anthropological Perspective, Cambridge 1985. Taussig, Michael T. -- The Devil and Commodity Fetishism in South America, Chapel Hill 1980. -- »Maleficium: State Fetishism«, in: Apter, Emily und Pietz, William (Hg.): Fetishism as Cultural Discourse, Ithaca 1993, S. 217-247. Taylor, Richard -- Te Ika a Maui or New Zealand and Its Inhabitants, London 1855. Tcherkezoff, Serge -- Le Roi Nyamwezi, la droite et la gauche. Révision comparative des classifications dualistes, Paris 1983. Testait, Alain -- Des dons et des dieux: Anthropologie religieuse et sociologie comparative, Paris 1993. -- »Les trois modes de transfert«, in: Gradhiva 21:39-58. -- »Uncertainties of the »obligation to reciprocatec A Critique of Mauss«, in: James, Wendy und Allen, N. J. (Hg.): Marcel Mauss: A Centenary Tribute, New York 1998, S. 97-110. Thomas, Nicholas
- -- »Forms of personification and prestations«, in: Mankind, 15, 1985, S. 223-230. -- Entangled Objects: Exchange, Material Culture, and Colonialism in the Pacific, Cambridge 1991. Thomas, Paul -- Karl Marx and the Anarchists, London 1980. Thomas, William I. und Znaniecki, Florian -- The Polish Peasant in Europe and America, Dover 1918. Thompson, David -- »The Hau of the Gift in its Cultural Context«, in: Pacific Studies 11, 1987, S. 63-79. Thwaites, R. G. (Hg.) -- The Jesuit Relations and Allied Documents: Travels and Explorations of the Jesuit Missionaries in New France, 1610-1791, 73 Bde., Cleveland 1970 [1896-1901]. Tooker, Elizabeth -- An Ethnography of the Huron Indians, 1615-1649, Washington, D.C., 1964. -- »The Iroquois White Dog Ceremony in the Latter Part of the Eighteenth Century«, in: Ethnohistory 12, 1965, S. 129-140. -- The Iroquois Ceremonial of Midwinter, Syracuse 1970. -- »The League of the Iroquois: Its History, Politics, and Ritual«, in: Trigger, Bruce (Hg.): Handbook of North American Indians, Bd. 15: Northeast, Washington, D.C., 1978, S. 418-441. -- »Women in Iroquois Society«, in: Foster, Michael K., Campisi, J. und Mit-hun, Marianne (Hg.) : Extending the Rafters: Interdisciplinary Approaches to Iro-quoian Studies, Albany 1984, S. 109-123. Tregear, Edward -- The Maori-Polynesian Comparative Dictionary, Wellington 1891. -- The Maori Race, Wanganui 1904. Trigger, Bruce -- The Children of Aatentsic: A History of the Huron People to 1660, 2 Bde., Montreal 1976. Turgeon, Laurier -- »Les objets des échanges entre Français et Amérindiens au XVIe siècle«, in: Recherches amérindiens au Québec, 22, 1-2, 1992, S. 152-167. -- »The Tale of the Kettle: Odyssey of an Intercultural Object«, in: Ethnohistory, 44, 1, 1997, S. 1-29. Turner, Terence -- »Parsons' Concept of a Generalized Media of Social Interaction and its Relevance for Social Anthropology«, in: Sociological Inquiry, 38, 1967, S. 121-134. -- »Piaget's Structuralism«, in: American Anthropologist, 75, 1973, S. 351-373. -- »Transformation, Hierarchy and Transcendence: A Reformulation of Van Gennep's Model of the Structure of Rites of Passage«, in: Moore, Sally Falk und Myerhoff, Barbara (Hg.): Secular Ritual, Amsterdam 1977, S. 53-70. -- »The Kayapo of Central Brazil«, in: Sutherland, Anne (Hg.): Face Values, London 1978, S. 245-279. -- »The Gê and Bororo Socities as Dialectical Systems: A General Model«, in: Maybury- Lewis, David (Hg.): Dialectical Societies. The Gê and Bororo of Central Brazil, Cambridge 1979, S. 147-178. -- »Kinship, Household and Community Structure among the Kayapo«, in: Maybury-Lewis (Hg.): Dialectical Societies. The Gê and Bororo of Central Brazil, Cambridge 1979, S. 179-217. -- »Anthropology and the Politics of Indigenous Peoples' Struggles«, in: Cambridge Anthropology, 5, 1979, S. 1-43. -- »The Social Skin«, in: Cherfas, Jeremy und Lewin, Roger (Hg.): Not Work Alone, Beverly Hills 1980, S. 112-140. -- Value, Production and Exploitation in Non-Capitalist Societies, 1984 (unveröffentlicht). -- »Dual opposition, hierarchy and value: Moiety structure and symbolic polarity in Central Brazil and elsewhere«, in: Galey, Jean-Claude (Hg.): Différences, valeurs, hiérarchie: textes offertes à Louis Dumont, Paris 1984, S. 335-370. -- »Animal Symbolism, Totemism, and the Structure of Myth«, in: Urton, Gary (Hg.): Animal
- Myths and Metaphors in South America, Salt Lake City 1985, S. 49-107. -- The Kayapo of Southeastern Para, 1987 (unveröffentlicht). -- »A Commentary« (zu T.O. Beidelman: »Agonistic Exchange, Homeric Reciprocity and the Heritage of Simmel and Mauss«), in: Cultural Anthropology, 4, 3, 1989, S. 260-264. -- »Representing, Resisting, Rethinking: Historical Transformations of Kayapo Culture and Anthropological Consciousness«, in: Stocking, George (Hg.): Colonial Situations: Essays on the Contextualization of Ethnographic Knowledge, Madison 1991, S. 285-314. -- The Poetics of Play: Ritual Clowning, Masking and Performative Mimesis among the Kayapo, 1993 (unveröffentlicht). -- »Bodies and anti-Bodies: Flesh and Fetish in Contemporary Social Theory«, in: Csordas, Thomas J. (Hg.): Embodiment and Experience, Cambridge 1994, S. 21-47. -- »Social body and embodied subject: the production of bodies, actors and society among the Kayapo«, in: Cultural Anthropology, 10, 2, 1995, S. 143-170. Turner, Terence und Fajans, Jane -- Where the Action Is: An Anthropological Perspective on >Activity Theory<, with Ethnographic Implications, 1988 (unveröffentlicht). Turner, Victor -- The Forest of Symbols. Aspects ofNdembu Ritual, Ithaca 1967. Tylor, Edward Burnett -- Die Anfänge der Cultur. Untersuchungen über die Entwicklung der Mythologie, Philosophie, Religion, Kunst und Sitte, Bd. 1, übers, v. Johann Wilhelm Sprengel und Friedrich Poske, Leipzig 1873 [1871]. Van Gennep, Arnold -- Übergangsriten, übers, v. Klaus Schomburg und Sylvie M. Schomburg-Scherff, Frankfurt/M. 1986 [1909]. Vérin, Pierre -- The History of Civilisation in North Madagascar, Rotterdam 1986 [1972]. Vernant, Jean- Pierre -- Myth and Thought among the Greeks, London 1983 [1965]. Vig, Lars -- Charmes: Spécimens de magie malgache, Oslo 1969. Vlastos, Gregory -- »On Heraclitus«, in: Allen, Reginald E. und Furley, David J. (Hg.): Studies in Presocratic Philosophy: The Beginnings of Philosophy, New York 1970, S. 413-423. Vogt, Evon Z. und Albert, Ethel M. (Hg.) -- The People of Rimrock: A Study of Values in Five Cultures, Cambridge 1966. -- »Obligation and Right: The Durkheimians and the Sociology of Law«, in: Besnard, Philippe (Hg.): The Sociological Domain: The Durkheimians and the Founding of French Sociology, Cambridge 1983, S. 177-198. Vygotsky, Lev S. -- Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes, Cambridge 1978. Wagner, Roy -- The Invention of Culture, Englewood Cliffs 1975. -- Lethal Speech, Ithaca 1978. -- Symbols that Stand for Themselves, Chicago 1986. Walens, Stanley -- Feasting with Cannibals: An Essay on Kwakiutl Cosmology, Princeton 1981. Wallace, Anthony F. C. -- »Revitalization Movements«, in: American Anthropologist, 58, 2, 1956, S. 264-281. -- »Dreams and Wishes of the Soul: A Type of Psychoanalytic Theory among the Seventeenth Century Iroquois«, in: American Anthropologist, 60, 2, 1958, S. 234-248. -- The Death and Rebirth of the Seneca, New York 1969. Wallace, Paul A. W. -- The White Roots of Peace: The Iroquois Book of Life, Philadelphia 1946. Waterman, Thomas T. -- »Some Conundrums in Northwest Coast Art«, in: American Anthropologist, 25, 4, 1923, S. 435-451. Weber, Max
- -- Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriß der verstehenden Soziologie, 1. Halbband, Tübingen 1976 [1921]. Weeden, William B. -- Indian Money as a Factor in New England Civilization, Baltimore 1884 [Nachdruck 2009]. Weiner, Annette B. -- Women of Value, Men of Renown: New Perspectives on Trobriand Exchange, Austin 1976. -- »The Reproductive Model in Trobriand Society«, in: Specht, Jim und White, J. Peter (Hg.): Trade and Exchange in Oceania and Australia, Sydney 1978, S. 175-186. -- »Reproduction: A Replacement for Reciprocity«, in: American Ethnologist, 7, 1980, S. 71- 85. -- »Sexuality among the Anthropologists: Reproduction among the Informants«, in: Poole, Fitz John P. und Herdt, Gilbert H. (Hg.): Sexual Antagonism, Gender and Social Change in Papua New Guinea, Adelaide 1982. -- »Inalienable Wealth«, in: American Ethnologist, 12, 1985, S. 210-227. -- The Trobrianders of Papua New Guinea, New York 1988. -- Inalienable Possessions: The Paradox of Keeping-while-Giving, Berkeley 1992. -- »Cultural Difference and the Density of Objects«, in: American Ethnologist, 21, 1994, S. 391-403. Weiner, James F. -- The Heart of the Pearlshell: The Mythological Dimension of Foi Sociality, Berkeley 1988. Weiss, Brad -- The Making and Unmaking of the Haya Lived World: Consumption, Com-moditization, and Everyday Practice, Durham 1996. White, John -- »Maori Customs and Superstitions«, in: Gudgeon, Thomas (Hg.): The History and Doings of the Maoris: From the Year 1820 to the Signing of the Treaty of Waitangi in 1840, Auckland 1885, S. 95-225. -- The Ancient History of the Maori: His Mythology and Traditions, 6 Bde., Wellington 1887- 90. Widerspach-Thor, Martine de -- »The Equation of Copper: In Memory of Wilson Duff«, in: Abbott, Donald N. (Hg.): The World is as Sharp as a Knife: An Anthology in Honour of Wilson Duff, Victoria 1981, S. 157-174. Wiener, Margaret J. -- Visible and Invisible Kingdoms: Power, Magic and Colonial Conquest in Bali, Williams, William -- A Dictionary of the New Zealand Language, Wellington 1844. Williamson, W. L. -- »Kumara Lore«, in: Journal of the Polynesian Society, 22, 1913, S. 36-41. Wilson, Monica -- »Witch Beliefs and Social Structure«, in: Marwick, Max (Hg.): Witchcraft and Sorcery, Harmondsworth 1970, S. 252-263. Wolf, Eric R. -- Die Völker ohne Geschichte: Europa und die andere Welt seit 1400, übers, v. Niels Kadritzke, Frankfurt/M. 1986 [1982]. -- Envisioning Power: Ideologies of Dominance and Crisis, Berkeley 1999.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement