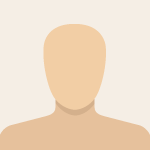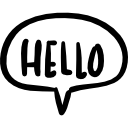Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- Die Geschichte der AfD : Frühe Radikale
- Angeblich war die AfD anfangs sehr bürgerlich. In Wirklichkeit ist die Entwicklung der Partei im Denken ihrer Gründer angelegt, das sich erst in der Masse verstärkte.
- Von Wibke Becker
- -Aktualisiert am 09.01.2020-16:20
- Es gibt eine Geschichte über die AfD, die sich tapfer hält. Sie erzählt, dass die Partei am Anfang bürgerlich und konservativ gewesen sei. Radikalisiert habe sie sich erst später, in zwei großen Häutungen.
- Diese beiden Häutungen gab es. Erstmals im Jahr 2015, da löste sich die Partei von ihrem Vorsitzenden Bernd Lucke. Ein zweites Mal, 2017, von der Vorsitzenden Frauke Petry. Aber folgt aus der Wahrheit dieser Häutungen auch die Wahrheit der ganzen Geschichte?
- Ihre Protagonisten waren im Gründungsjahr der AfD, 2013, bekannte Leute. Sie hatten hohe Posten in der Wirtschaft, in der Presse oder an der Universität. Sie publizierten oder hielten Vorträge, man wusste sehr viel über sie. Drei ihrer wichtigsten Köpfe waren der Wissenschaftler Bernd Lucke, der Politiker Alexander Gauland und der Manager Hans-Olaf Henkel. Schaut man sich heute an, was von ihnen schon damals bekannt war, erkennt man, dass das Radikale von Beginn an in der AfD angelegt war.
- Im Jahr 2000 erschien Hans-Olaf Henkels Buch „Die Macht der Freiheit – Erinnerungen“. Es war eine Autobiographie, die Henkels Leben von der Geburt bis zum Posten des Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie nachzeichnete. Er beschreibt sich darin als jemanden, der sich alles selbst erarbeitet hat, der gewitzt ist und schlauer als andere vorgeht; und als jemanden, der vieles früher als andere vorhergesehen hat. Diese Deutung seines Lebens und Charakters steht aber in einer gewissen Diskrepanz zu dem, was er tatsächlich über sich erzählt.
- Henkel lebte als Jugendlicher in einem Internat. Dort beschwerte er sich darüber, dass er als gläubiger Katholik gezwungen werde, den protestantischen Abendgottesdienst zu besuchen. Weil im Internat „großer Respekt vor solcher Frömmigkeit herrschte“, bekam Henkel den Sonntagmorgen frei, um in die heilige Messe zu gehen. Er schrieb: „Das waren für mich schöne Tage. Natürlich machte ich um die katholische Kirche einen großen Bogen, spazierte stattdessen stundenlang an der Alster entlang. Ich genoss meine ,Religionsfreiheit‘ in vollen Zügen.“
- 2014 trat Hans-Ofal Henkel für die AfD bei den Europawahlen an und vertrat die Partei anschließend bis 2019 im europäischen Parlament.
- Nach der Lehre wollte Henkel nicht zur Bundeswehr. Er war kein Pazifist, er befürwortete die Bundeswehr. Aber er wollte nicht selbst derjenige sein, der sich „einem strengen Reglement zu unterwerfen“ hatte. Also ließ er sich von der Mutter eines Freundes, einer „Seelenärztin“, ein Attest über eine „völlige Stiefelunverträglichkeit“ ausstellen. Später, im Beruf, gab er dann bei mehreren Vorstellungsgesprächen falsche Antworten, weil er ahnte, dass die bei den Vorgesetzten gut ankommen. Und noch später, nachdem „Der Spiegel“ aufgedeckt hatte, dass er einen verheimlichten, unehelichen Sohn hat, und die Zeitschrift ihm wegen vermeintlicher schwarzer Konten hinterhergespürt hatte, fühlte er sich gezwungen, Sozialabgaben für seine Putzfrau zu bezahlen, da er sie nach dem Presserummel ja „nicht ,schwarz‘ arbeiten lassen konnte“. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits BDI-Präsident.
- Henkel schämte sich nicht, diese Episoden aus seinem Leben zu erzählen, im Gegenteil. Er schien stolz auf sie zu sein. Dadurch verschaffte er sich etwas, was er „Freiheit“ nannte: ein Leben, das die eigenen Bedürfnisse befriedigte. Staat, Regeln und Ehrlichkeit, so könnte man zusammenfassen, waren dabei hinderlich – und schlau war deshalb derjenige, der sich all das vom Leib hält. An einer Stelle schrieb Henkel, dass seine Art von Liberalität die Ungebundenheit sei. Man könnte es auch so ausdrücken: Freiheit bestand für ihn aus Rechten, nicht aus Pflichten.
- „Freiheit“ nannte es Henkel auch, als seine Mutter auszog, aber die Miete für die Fünf-Zimmer-Wohnung weiterhin bezahlte. Da war er sechzehn Jahre alt, und sie sagte zu ihm, er solle doch einige der Zimmer untervermieten und davon leben. „Du stehst also jetzt auf eigenen Beinen“, zitierte Henkel seine Mutter. Und sinnierte dann: „Ich ahnte, dass ich nun, mit meinen sechzehn Jahren, ein absolut freier Mann sein würde, ein Unternehmer . . .“ Und so nannte er es denn auch „Geld verdienen“, dass er zu einer Zeit, als „gewaltige Wohnungsnot“ in Hamburg herrschte, drei Zimmer untervermietete, die seine Mutter bezahlte.
- Er selbst, gerade mal in der Pubertät, bewohnte zwei Zimmer. In seinem nächsten Buch deutete Henkel diese Lebensphase dann so: „Ich hatte nichts. Und das motivierte mich. Ich arbeitete so fleißig und konzentriert wie möglich, weil ich die Zukunft fürchtete.“
- Geringschätzung für alles Staatliche
- Dieses nächste Buch war „Die Ethik des Erfolges“, erschienen 2002. Es war weit politischer als die Autobiografie. Henkel hatte schon dort gegen „die Parteien“ ausgeteilt, die sich „unseren ganzen Staat . . . unter den Nagel gerissen haben“, die „unseren Staat fest im Griff“ haben und „sich nach Belieben“ bedienen. Er hatte beschrieben, welche guten Vorschläge er damals Helmut Kohl machte – Kohl sie aber nicht genau so umsetzte und deshalb Niederlagen einstecken musste.
- In seinem Nachfolgewerk wurde nun seine Geringschätzung für alles Staatliche deutlich, gegen die „meinungsbildende Elite“ insgesamt, die aus Parteien, Politikern, Behörden und Presse bestand. Für ihn war Deutschland ein Land geworden, in dem sich „politische Korrektheit auf Heuchelei reimt“, in dem „die Wahrheit verpönt“ war, weil „offene Rede sogleich Sanktionen nach sich zieht“.
- Es ging Henkel im Grunde um eine Spaltung der Gesellschaft in „die“ und „wir“. Zu „denen“ zählte er etwa den „Wasserkopf von Beamten . . ., die eifrig damit beschäftigt sind, dem Volk über den wahren Zustand seines Arbeitsmarktes blauen Dunst vorzumachen.“ Oder die Politiker, die „schleunigst ins Wochenende streben“ und sich ihre Freizeit nehmen, „wo sie zu haben ist“. Die „Gutmenschen“ und „grüne Moralapostel“ zählten zu „denen“ ebenso wie Gewerkschaftler, Sozialpolitiker und Klimaaktivisten. Für Kinderarbeit in Indien hatte er Verständnis und lehnte das „deutsche Dogma“ der menschenwürdigen Arbeit ab. Das Wort „menschenwürdig“ setzte er in Anführungszeichen. Das alles schrieb Henkel schon im Jahre 2002.
- Wie schon in der Autobiographie zeigte sich in der „Ethik“ ein Mann, der größtenteils verachtete, was ihn zu solidarischem Verhalten mit anderen Teilen der Gesellschaft zwang. Henkel erschuf das Feinbild einer faulen, dummen, verlogenen und freiwillig „gleichgeschalteten“ politischen Elite. Dagegen setzte er das Wir, das „Volk“. „Auch wir Deutschen“, so schrieb er in seinem Vorwort zur „Ethik des Erfolgs“, hätten das Bedürfnis, „wieder stolz . . . auf unser Land“ zu sein „was immer uns Medien und Politiker einreden wollen“.
- Hier traf sich Henkel für einen kurzen Moment mit Alexander Gauland. Der hatte nämlich im selben Jahr das Buch „Anleitung zum Konservativsein, Zur Geschichte eines Wortes“ geschrieben. Darin argumentierte auch er, dass das Volk Patriotismus brauche – Symbole, Heimat, Identität, Tradition, Glaube. Sein Schluss folgte allerdings aus einer anderen, feineren Herleitung. Gauland meinte, nationale Identität gehöre zu den „unausrottbaren menschlichen Bedürfnissen“.
- Besonders die ökonomisch Abgehängten brauchten diese „konservativen Gegenwelten zur Ökonomie“, weil sie ihren Eigenwert, ihre Identität und ihren Stolz nicht aus „materiellem Erfolg“ speisen könnten. Gauland nannte das „kompensatorische Befriedung“. Er zeichnete ein Bild von einer ungerechten Gesellschaft, in der das Volk den Patriotismus gleichsam als Opium brauche, und die Herrschenden ihm dieses Opium liefern sollten.
- In der Bundesrepublik gab es für Gaulands Geschmack einen Mangel an Nationalpathos. Und deshalb arbeitete er sich in den folgenden Jahren als Gastautor des „Tagesspiegels“ immer wieder an diesem Fehlen eines deutschen Patriotismus ab und an dem, was er für die Ursache dieses Mangels hielt: dem Dritten Reich.
- Seine Argumentation ging so: Der Umgang mit dem Dritten Reich sei ein Grund für die Misere, in der die Deutschen heute steckten, zudem werde der Umgang immer „aufgeregter und irrationaler“. Einerseits sei es heute nicht mehr denkbar, über Hitlers „wahre geschichtliche Größe“ zu schreiben, wie es Joachim Fest in den siebziger Jahren getan hätte. Andererseits drohe Hitler „mythisch überhöht“ und diese „längst ins historische Dunkel abgetauchte Figur stets von Neuem als Gefahr“ beschworen zu werden.
- In Wirklichkeit habe deshalb Hitler gerade den Deutschen „die größte Beschädigung“ zugefügt, stimmte Gauland einer Feststellung des Publizisten Sebastian Haffner zu. Und weiter: „Denn so furchtbar die materiellen Verluste von Russen und Polen auch waren, nur den Deutschen ist ein Teil ihrer Identität, ihres geistigen Erbes zerstört worden. . .“ Das Dritte Reich dürfe deshalb nicht mehr dazu dienen, „deutsche Geistesgeschichte in richtig und falsch einzuteilen“. Konkret: Erst wenn man wieder „Entartung“ sagen dürfe, „ohne jedes Mal von der Goebbelskeule getroffen zu werden“, ist „das notwendige Gleichgewicht . . . einer Gesellschaft wieder im Lot.“
- Gauland ist kein Lebemann wie Henkel, sondern ein Intellektueller, belesen, subtil und wortgewandt. Sein Weltbild ist nicht neoliberal, der Begriff Freiheit spielte in seinen Texten keine wesentliche Rolle. Seine Themen waren schon damals, Mitte der nuller Jahre, die „moralischen Verbote aus dem Fundus der politischen Korrektheit“, die „Wortpolizisten“, die „Gutmenschen“ und die „gelenkte Demokratie“. Zu einem großen Thema machte er auch das Volk und wer dazu gehört und wer nicht.
- Nach seinem Austritt aus der AfD im Jahr 2015 gründete Bernd Lucke die Partei „Allianz für Fortschritt und Aufbruch“ (Alfa).
- Gauland stellte schon damals klar: das Volk verbindet einen Menschen mit dem anderen, nichts anderes. In einem Beitrag schrieb er: „In Deutschland ist die Auflösung des nationalen Gefühls so weit fortgeschritten, dass zuerst nach den menschlichen und politischen Inhalten und erst danach nach der Zugehörigkeit zum eigenen Volk gefragt wird.“ Er schrieb „Volk“, nicht „Staatsangehörigkeit“. Denn ein Deutscher könne auch „nur dem Namen nach“ Deutscher sein, nämlich dann, wenn seine „Liebe“ einem anderen Land, seine „Seele einem anderen Gott als dem hierzulande mehrheitlich angebeteten“ gelte. Volkszugehörigkeit war Gauland zufolge also nicht durch Geburt erworben oder durch den Staat zugewiesen, sondern musste sich erst durch eine bestimmte Haltung beweisen.
- In einem zwei Jahre später abgedruckten Beitrag fragte Gauland rhetorisch: „Warum dürfen Grundfragen der Nation, wie die nach dem Maß an Fremden, das eine Gesellschaft ohne Überforderung verträgt, nicht dem Volk vorgelegt werden?“ Er schien damit der direkten Demokratie das Wort zu reden. Verbindet man diesen Satz aber mit seinem zuvor skizzierten Verständnis vom Volk, bedeutet es, dass eine homogene Volksmasse darüber entscheiden soll, wer zu ihr gehört und wer nicht. Das war völkisches Gedankengut, und Gauland schrieb das 2008, also Jahre vor der Gründung der AfD.
- Das Volk gegen das Fremde, darauf lief Gaulands Abgrenzung hinaus. Bei ihm hörte es sich freilich umgekehrt an: das Fremde gegen das Volk. Und Fremde, das waren vor allem Menschen muslimischer Herkunft ohne „abendländische Identität“, oder eben das „kulturell Fremde“. In einem „Tagesspiegel“-Beitrag von 2005 schrieb er mit Blick auf den Nachbarn Frankreich und die Unruhe in den Banlieues: „Nun ist es bestimmt richtig, dass die französische Krise auch soziale Ursachen hat, doch dass die soziale Deklassiertheit eben diejenigen trifft, die schwarz, braun, Maghrebiner und Moslems sind, müsste auch denen zu denken geben, die ausschließlich wirtschaftliche Faktoren am Werk sehen.“ Das Fremde stand also auf einer niedrigeren sozialen Stufe, und der Grund dafür lag in ihm selbst.
- Liest man weitere Beiträge Gaulands aus dieser Zeit, wird klar, dass Gauland das Fremde als etwas dauerhaft anderes ansah. In seinem Geschichtsverständnis gibt es „unlösbare Konflikte und unvereinbare historischen Traditionen.“ Für einen EU-Beitritt der Türkei disqualifizierte sich das Land nicht etwa durch das Zypern-Problem oder unwürdige Zustände in Gefängnissen, sondern durch „eine mehr als 1000-jährige andere Geschichte, eine tiefe kulturelle Differenz“. Auch 85 Jahre kemalistische Modernisierung könnten daran nichts ändern, Europa sei nun mal „ein Christenklub, also ein Kontinent mit gemeinsamen Wurzeln“.
- Die „Eroberung Konstantinopels mit ihren kulturellen Folgen“ konnte nach Gauland also nicht – wie die Hitler-Jahre –, irgendwann ins „historische Dunkel“ abtauchen. Dabei ist Hitler gerade mal siebzig Jahre her, der Fall des Oströmischen Reiches über 550 Jahre. Das Fremde sollte fremd bleiben. Denn wie Henkel die heuchlerische Elite brauchte, brauchte Gauland schon damals das Fremde, um das Bild von einem zusammengehörigen Volk zu evozieren.
- Interessant hierbei: Europa hatte für Gauland so lange „gemeinsame Wurzeln“ und die Europäer hatten so lange eine „abendländische Identität“, wie es um eine Abgrenzung mit islamischen Ländern ging. War aber von der Europäischen Union und den „Brüsseler Eliten“ die Rede, schrieb der Autor: „Es gibt. . . keine europäische Kultur.“
- Das schließt an Bernd Lucke an, den Dritten im Bunde. Der Professor für Makroökonomie war vor seiner Tätigkeit in der AfD öffentlich nicht groß aufgefallen. Im Jahr 2012 hatte er nach 33 Jahren die CDU verlassen und die „Wahlalternative 2013“ gegründet, eine Vorgängerorganisation der AfD, bei der Gauland und Henkel auch schon dabei waren. Mit der Gründung der Partei „Alternative für Deutschland“ wurde Lucke schlagartig bekannt und zum Gesicht der Partei. Journalisten interessierten sich für ihn, diesen nerdigen, hibbeligen Mann, immer in Anzug und Krawatte oder im gestrickten Wollpulli, mit fünf Kindern und dann noch jeden Sonntag in der Kirche. Er schien äußerlich das Gegenteil eines Radikalen zu repräsentieren.
- „Deutschland braucht eine Alternative“
- Von Lucke gibt es kaum politisches Material aus der Zeit vor der AfD. Aufschlussreich sind seine Reden aus den ersten Monate der Partei. Sie schienen größtenteils vom Euro zu handeln. Aber eigentlich ging es immer um etwas anderes: nämlich um den baldigen Untergang Deutschlands. In Weinheim, im Juli 2013, begann Lucke so: „Deutschland braucht eine Alternative. Die Altparteien, die Deutschland regiert haben seit 1949, sind gefährlich.“ Weil sie „blind geworden sind für die Gefahren, die unserem Land drohen“, weil sie sich „lieber mit Pöstchen und Possen befassen statt mit den wirklichen Problemen unseres Landes“. In diesem Ton ging es weiter. Es drohten dramatische Zahlungsverpflichtungen, die Bundesregierung habe keinen Plan B für die Krise, da laufe was ökonomisch aus dem Ruder; mit einem Wort: „Können wir denn da überhaupt noch raus. . .? Nun, es ist spät, aber es ist noch nicht zu spät, um nicht noch Schlimmeres zu verhindern.“
- Bernd Lucke lebte in seinen Reden von der Angst seiner Zuhörer. Er beschwor sie, er nährte sie und er machte sie zu seinem Werkzeug. Die Alternative für Deutschland schien wie ein Erlösungsversprechen, die Mitglieder und Sympathisanten konnten sich wie der erlesene Kreis einer Gruppe fühlen, die verstand – denn „nur die wenigsten Menschen verstehen leider, was da vor sich geht“. Als es in den folgenden Monaten immer mehr Kritik an der AfD gab, schadete das der Partei deshalb nicht. Es half ihr.
- Gleichzeitig baute Lucke durch seine Untergangsmetaphorik ein Feindbild auf. Es gebe Leute, die für die „fatale Entwicklung“ in Deutschland verantwortlich seien: die sogenannten Altparteien, die Regierung und im Besonderen die Kanzlerin Angela Merkel und der damalige Finanzminister Wolfgang Schäuble. Ihnen schlug plötzlich ein Hass entgegen, der durch Lucke geschürt worden war. Denn der Professor schlug auf sie ein.
- Die CDU habe „das Vertrauen der Wähler . . . schamlos missbraucht“, es fehle ihr an „Wahrheit und Wahrhaftigkeit“, die Koalition „schwindele dem Bürger eine heile Welt vor“ und setze „klammheimlich“ ein Vermögen an Steuergeldern in den Sand. Die Kanzlerin „täusche“, man könne sich auf ihr Wort „nicht verlassen“, die Regierung sei „unseres Vertrauens nicht mehr würdig“. Es ging um „Lügen“ von Christine Lagarde und eine „infame Strategie“ der Regierung, die mit „den Mitteln der Schmähung und der Verunglimpfung“ versuche, den demokratischen Wettbewerb gegen die AfD zu entscheiden.
- Bald war Lucke dann auch schon nicht mehr bei „Deutschland“, sondern beim „Volk“ angelangt. Der Übergang war leicht, ging es Lucke doch auch immer darum, vor anderen europäischen Staaten zu warnen, die das mühsam erarbeitete Geld des deutschen Steuerzahlers verprassten, nach dem Motto „Spanien hat schon angeklopft, . . . Italien steht vor der Tür.“ Die Untergangslogik funktionierte wie ein Schwamm. Sie konnte alles aufsaugen, was Angst machte. Und so prangerte Lucke die „völlig ungeordnete Zuwanderung“ an – wohlgemerkt war es das Jahr 2013, nicht 2015.
- Die neuen Feindbilder waren nach Politik, Medien und Brüssel etwa die Sinti und Roma; Menschen mit „mangelnder Bildung“, die wegen „der Höhe des deutschen Kindergeldes“ kämen, aber sich nicht integrierten „oder nicht integrieren wollen“. Deutsche, besonders Akademiker, hatten Lucke zufolge zu wenige Kinder.
- Von dort war es nicht mehr weit zu Luckes bekanntem Spruch am Wahlabend 2013 über die „Entartungen von Parlamentarismus und Demokratie“. Und seiner Versicherung, es sei „nicht im mindesten von meiner Seite beabsichtigt, auf nationalsozialistische Politik anzusprechen“. Es tue ihm nicht leid, und dieses Beispiel zeige, wie „man versucht, meine Sprache zu kontrollieren“, das sei eine „abgefeimte Strategie“ seiner politischen Gegner.
- Dieses Vorgehen, nämlich ein belastetes Wort zu gebrauchen und dann zu behaupten, so sei das nicht gemeint gewesen, wurde zu einer beliebten Strategie der AfD. Sie konnte dadurch einerseits Begriffe salonfähig machen, weil alle darüber diskutierten. „Lügenpresse“, „Umvolkung“ oder „Altparteien“ sind heute gängig. Andererseits konnte die AfD so ihren Wählern zeigen, wie ungerecht die Partei von allen anderen behandelt würde. Bei Lucke klang das alles schon früh an.
- Die AfD war von Beginn an eine bürgerliche und konservative Partei und sei es immer noch – das behauptet Alexander Gauland ständig. In Wirklichkeit werden heute weite Teile der Partei, nämlich der „Flügel“ und die Jugendorganisation „Junge Alternative“, vom Verfassungsschutz überprüft. Sie stehen im Verdacht, extremistisch zu sein, also gegen die Verfassungsordnung zu kämpfen.
- Eigentlich scheinen das Bürgerliche und das Radikale wie ein natürlicher Gegensatz. Dem Bürgerlichen wird unterstellt, politisch gemäßigt zu sein. Übersehen wird dabei, dass es im Bürgertum immer einen Salonradikalismus gab. Henkel, Gauland und Lucke sagten radikale Dinge, aber sie waren Einzelgänger in einem gesitteten Umfeld. Erst als sie sich in der AfD sammelten, wurde deutlich, was aus ihren Ideen wird, wenn sie sich in der Masse verstärken.
- Nach seinem Austritt aus der AfD sagte Henkel, er habe mitgeholfen, „ein richtiges Monster zu erschaffen“.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment