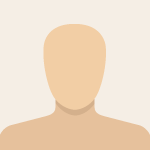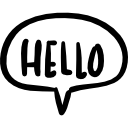Advertisement
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- JOSEF RATTNER Hrsg.
- Menschenkenntnis durch Charakterkunde
- Inhalt
- Vorwort 7
- Josef Rattner
- Zur Theorie des Charakters 9
- Josef Rattner
- Ehrgeiz 34
- Roswitha Neiß
- Eitelkeit 57
- Josef Rattner 110
- Geiz 85
- Wolfgang Köppe Eifersucht 133
- Irmgard Fuchs Neid Katja Kaminski/Martin Bauknecht Wut und Zorn 157
- Josef Rattner Haß 184
- Günther Köhnlein/Riidiger Schlott Angst 209
- Günter Keesen/Bernd Strauß Melancholie, Schwermut und Traurigkeit 235
- Elke A. Pilz Schüchternheit 2 62
- Richard Hitzler/Ulrike von Saalfeld-Urbasek Bequemlichkeit
- und Riesenerwartungen 282
- Gert Janssen Der Zwangscharakter 308 Klaus Ohm Freude 337
- Josef Rattner
- Liebe 362
- Anmerkungen 386
- Literaturhinweise 392
- Autoren 403
- Register 406
- Vorwort
- Die Beschreibung des Charakters war jahrhundertelang die Aufgabe der schönen Literatur; vor allem in der Theaterlitera- tur, aber auch in Romanen wurden Charaktereigenschaften oft sehr kenntnisreich, aber natürlich ohne wissenschaftliche Ver- tiefung dargestellt. Erst die moderne Charakterologie schuf eine Wissenschaft von der Wesensbeschaffenheit des Men- schen, die durch Erziehung und Umwelt, durch Selbstgestal- tung und Fremdbeeinflussung entsteht. Tiefenpsychologisches und phänomenologisches Bemühen um Verständnis erweiter- ten unsere charakterologischen Einsichten, ohne die heute Selbst- erkenntnis und Menschenkenntnis kaum vorstellbar sind. Das vorliegende Buch soll jene Struktureigentümlichkeiten der menschlichen Persönlichkeit durchleuchten, die meist nur im Bereich des Gefühls und der Ahnung verbleiben und daher im Alltag nicht fruchtbar gemacht werden können. Wir sind hierbei vom psychotherapeutischen Erfahrungsfeld ausgegangen und haben in erster Linie Charakterzüge berück- sichtigt, die in neurotischen und psychosomatischen Störun- gen, aber auch in Verhaltensanomalien des Alltagslebens eine ganz entscheidende Rolle spielen. Daher setzt dieser Band ein mit Analysen des Ehrgeizes, der Eitelkeit, des Geizes, des Neides, der Eifersucht, des Hasses, der Wut und des Zorns, der Trauer, der Schüchternheit usw. Um uns aber nicht auf die psychische Pathologie zu beschränken, haben wir auch Cha- raktereigenschaften wie Liebe und Freude dargestellt. So möch- ten wir durch Beschreibung wichtiger menschlicher Wesens- und Verhaltensmerkmale das Sensoriuin des Lesers für die Selbst- und Menschenkenntnis verfeinern und ihm die Gelegen- heit geben, anhand der vorliegenden Charakterstudien die Kunst des tiefenpsychologischen Denkens und Urteilens zu lernen. Uberall haben wir den Nutzen für die Lebenspraxis höher gestellt als die rein theoretische Stringenz: Unser Text ist
- 7
- kein Lehrbuch für den Liebhaber wissenschaftlicher Abstrak- tion, sondern ein Handbuch für den interessierten Laien oder >Lebensforscher<, der durch die Psychologie >Lebenskenntnis< und ein bißchen >Weisheit< erwerben will. - In Kürze wird diesem Band ein Buch mit dem Titel >Neurosenlehre< folgen, worin wir die grundlegenden Neurosenformen erläutern und verständlich machen wollen.
- Berlin, im Herbst 1982 Josef Rattner
- 8
- Josef Rattner
- Zur Theorie des Charakters
- Die Charakterologie ist eine Wissenschaft, deren Wurzeln tief in die Vergangenheit hinabreichen. Schon in der griechischen Antike gab es gedankliche Systeme, die die Vielfalt menschli- cher Verhaltensweisen auf einige Grundtypen zu reduzieren versuchten. Bekannt ist die Lehre von den >vier Temperamen- ten<, die schon Hippokrates (460-377 v. Chr.) vertreten hat. Danach unterscheiden sich die Menschen je nach den >Körper- säften< (humores), die in ihnen besonders wirksam sind. Im Sanguiniker ist die Blutfülle auffällig; im Choleriker erzeugt die >gelbe Galle« heftige und leidenschaftliche Reaktionen; der Me- lancholiker wird bestimmt durch ein Ubermaß an >schwarzer Galle<; der Phlegmatiker schließlich ist >schleimig< und daher träge und unansprechbar. Sehr hübsch wird die Wesensart der vier Typen veranschaulicht durch die Geschichte, in der jeder von ihnen einen Spaziergang machen will und auf seinem Wege einen großen Stein als Hindernis vorfindet. Der Sanguiniker setzt mit einem lebhaften Sprung über den Steinblock hinweg und wandert munter wei- ter. Der Choleriker gerät in Wut und Zorn, weil er sich wieder einmal bei seinen Unternehmungen gestört fühlt: er schleudert den Stein beiseite und hat für längere Zeit die gute Laune verloren. Der Melancholiker bleibt stehen, verfällt auf traurige Gedanken, die sich dahingehend verdichten, daß in seinem Leben noch nie etwas >reibungslos< verlaufen ist: er gibt sich seiner Trübsal hin und setzt sich bekümmert am Wegrand nieder. Der Phlegmatiker jedoch fand schon zu Hause das Aufstehen und Weggehen reichlich mühsam; beim Anblick des Steins wird ihm alles zuviel, und er kehrt in seine Wohnung zurück, um sich wieder ins Bett zu legen. Dieses etwas grobe Schema wurde von dem Philosophen Theo- phrast (372-287 v. Chr.), einem Schüler des Aristoteles, we- sentlich verfeinert. Von ihm stammt die heute noch lesenswerte
- 9
- Schrift über >Die Cbaraktere<, die viele Bewunderer und Nach- ahmer gefunden hat. Theophrast war ein scharfer Beobachter der Menschen, die er in seinem Büchlein sehr treffend be- schrieb. So handelt er einzelne Charaktertypen in kurzen Auf- sätzen ab, z.B. den Geizhals, den Aufschneider, den Angstli- chen usw. Noch der Franzose Jean de la Bruyère (1645-1696) trat in die Fußtapfen seines antiken Vorläufers und veröffent- lichte ein ebenfalls vielgelesenes Buch mit demselben Titel. Am französischen Königshof stand die Kunst der geistreichen Men- schenbeschreibung in hohem Ansehen. Zur Zeit der Aufklärung wurden diese Bemühungen noch verstärkt. Neue >Wissenschaften vom Charakter< etablierten sich, so etwa die Physiognomik von J. C. Lavater, die Phreno- logie (Schädelkunde) von F. J. Gall und bald darauf auch die Anfänge der Graphologie. Letztere wurden systematisch durch J. H. Michon (1806-1881) begründet, der dieser Disziplin auch ihren Namen gab. Das Wort Charakterologie stammt von dem Philosophen Julius Bahnsen, der stark von Schopenhauer und Hegel geprägt war. Sein Buch mit dem gleichnamigen Titel erschien 1867. Trotz vieler feiner Beobachtungen ist sein System heute in Vergessenheit geraten, da es in einem ziemlich schwerfälligen Stil geschrieben ist. Von da an ging aber die Entwicklung der wissenschaftlichen Charakterkunde und der mit ihr verbundenen Ausdruckspsy- chologie in beschleunigtem Tempo weiter. Nachhaltige Förde- rung verdanken diese Wissenschaftszweige dem Graphologen Ludwig Klages (1872-1956), der mit seinen zahlreichen Publi- kationen das Interesse am Studium der Charakterprobleme populär machte. In den letzten Jahrzehnten ist geradezu eine Flut von Büchern über Charakterologie erschienen. Wichtig in unserem Zusam- menhang sind die Arbeiten über >Konstitutionspsychologie< (Ernst Kretschmer: >Körperbau nnd Charakter<), die psycho- analytischen, die neopsychoanalytischen und die individual- psychologischen Charakterlehren (Freud, Schultz-Hencke, Fromm, Horney, Erikson, A. Adler) und die modernen T y - pent lieoricn (C. G. Jung, Eduard Spranger). Mit Hilfe dieser Koii/epie ist man heute in der Lage, Menschen sehr differen- 'iri 1 zu beschreiben und zu beurteilen.
- '»«> wertvoll die I'linde zum Charakterthema in allen Bereichen
- 10
- der psychologischen Forschung sein mögen, sind doch unseres Erachtens die tiefenpsychologischen Gedankengänge die ein- drücklichsten und hilfreichsten zum Selbstverständnis und zur Erkenntnis des Mitmenschen. Da sie aus dem Bestreben der Hilfeleistung für seelisch gestörte Menschen stammen, sind sie lebensnah und in besonderer Weise tiefgründig.
- Charakter, Konstitution und Temperament
- Ernst Kretschmers erstmals 1921 veröffentlichte Untersuchung über 'Körperbau und Charakter< schien für die naturwissen- schaftlich-medizinische Forschung einen Zugang zum >biologi- schen< Verständnis der menschlichen Wesenseigenschaften zu eröffnen. Kretschmer war Psychiater und beobachtete in seiner Klinik, daß die beiden häufigsten >endogenen Psychosen< (das manisch-depressive Irresein und die Schizophrenie) sich be- stimmten Körperbautypen zuordnen ließen. Bei der manisch- depressiven Psychose waren rundwüchsige Menschen überre- präsentiert, die sogenannten Pykniker mit zarten Knochen und kurzen Gliedmaßen und starker Entwicklung der Körperhöh- len (Brust- und Bauchraum). Die Schizophrenie jedoch >bevor- zugte< die Dünnleibigen und Schlankgliedrigen, die sogenann- ten Leptosomen. Sodann konnte noch als Zwischentyp der sogenannte Athletiker (starker Knochenbau und kräftige Mus- kulatur) ermittelt werden. Alle drei Charaktertypen sind nach Kretschmer konstitutionell bedingt und bestimmen körperlich-seelische Krankheitsneigun- gen der betreffenden Individuen und sehr ausgeprägt auch Eigentümlichkeiten des jeweiligen Temperaments. Pykniker neigen zu einem zyklothymen Temperament^ sie unterliegen Stimmungsschwankungen (heiter-traurig usw.), sind extraver- tiert und ausdrucksfreudig. Die Leptosomen sind >schizothym< (spaltsinnig) und zeigen Züge der Introversion, der Hypersen- sibilität und der Ausdrucksarmut. Athletiker schließlich haben ein >zähflüssiges Temperamente ihr Gefühls- und Affektleben ist langsam, schwerblütig und nachhaltend. Dieses Schema reicht nach Kretschmer weit über das Gebiet der Psychopathologie hinaus; die psychiatrischen Fälle zeigen nur in einer gewissen Zuspitzung bio-psychologische Zusammen- hänge, die auch für annähernd normale Menschen Geltung
- besitzen. Kretschmer behauptet, seine Lehre sei von der AVeis- heit des Volkes< in wesentlichen Teilen schon vorweggenom- men worden. So kann man sich den verstiegenen und verträum- ten Ritter Don Quijote kaum anders als dünn und hoch auf- geschossen (leptosom) denken, indes sein bodenständiger, realitätsbewußter Begleiter Sancho Pansa von Zeichnern und Malern stets als dickbäuchig und eßfreudig dargestellt wird. Be- rühmt ist auch jene Textstelle aus Shakespeares >Jnlius Cäsar<, worin der Diktator den Wunsch äußert, man möge ihn mit wohlbeleibten Männern umgeben, mit glattem Kopf und dik- kem Bauch, welche nachts gut schlafen: der dünne Cassius denke zuviel und sei unberechenbar in seinen Handlungen und Verhaltensweisen! In seinem Buch >Geniale Menschen< (1929) wandte Kretschmer seine Konstitutions- und Temperamentenlehre auch auf bedeu- tende Vertreter des Kultur- und Geisteslebens an und konnte demonstrieren, daß die von ihm entdeckten Korrelationen auch für Naturforscher, Dichter und Philosophen gültig sind. So seien praktisch orientierte Naturforscher meistens Pykniker und Athleten, Philosophen und Theologen jedoch, die abstrak- te Systeme entwickeln, tendierten zur Leptosomie. Epiker, deren Werke sich durch starken Wirklichkeitssinn auszeichnen (z.B. A. Stifter, G. Keller, Goethe in seiner zweiten Lebens- hälfte usw.) sind rundwüchsige Typen, Dramatiker dagegen (Schiller, Kleist) und Lyriker (Hölderlin, Eichendorff, Heine usw.) eher schlankwüchsig. Sie weisen viele Merkmale der >Schizothymie< auf. Da Kretschmer ein glänzender Schriftsteller war und seine Denkweise dem dominierenden Biologismus der Medizin ent- sprach, wurde seine Typentheorie äußerst populär und löste beinahe eine >konstitutionspsychologische Modewelle< aus: die Anzahl der Arbeiten auf diesem Gebiet füllt ganze Bibliothe- ken! Gleichwohl muß man feststellen, daß der psychodiagno- stische Wert der Kretschmerschen Hypothese weniger groß ist, als man zuerst meinte. Die Zuordnung zwischen Körperbau und Temperament gilt nur sehr >approximativ<, und der Cha- rakter des Menschen ist schon gar nicht linear auf seinen Konstitutionstyp zurückzuführen. In diesem Sinne ist der Titel von Kretschmers Hauptwerk irreführend ( >Körperbau und Charakter<) - es hätte eigentlich >Körperbau und Tempera- ment< heißen müssen! Mit dem Begriff >Temperament< bezeich-
- nen wir so etwas wie die seelische Grundstimmung und die durchschnittliche Verlaufsweise (Bewegungsform) der seeli- schen Reaktionen. Diese sind sicherlich auch im Körperbau verankert, aber damit ist die menschliche Charakterstruktur noch nicht annähernd erfaßt. Charakter und Temperament sind nicht identisch.
- Charakter und Intelligenz Wer sich mit Charakterforschung befaßt, wird notwendiger- weise auch das Intelligenzproblem in Betracht ziehen müssen. Ist Intelligenz unabhängig von Charakter? Muß man sie als »angeborene Qualifikation« einstufen, während der Charakter eher dem Sozialisationsschicksal zuzuordnen ist? Der Streit über diese Problematik ist so alt wie die wissen- schaftliche Psychologie. Viele Psychologen sahen in der Intelli- genz eine reine >Verstandesdisposition<, deren Grundzüge angeboren sind. William Stern formulierte die folgende Defini- tion: Intelligenz ist die allgemeine Fähigkeit eines Individuums, sein D e n - ken bewußt auf neue Forderungen einzustellen; sie ist allgemeine geistige Anpassungsfähigkeit an neue Aufgaben und Bedingungen des Lebens. 1
- David Wechsler ergänzte diese Bestimmung mit den Worten: (Intelligenz ist) die zusammengesetzte Fähigkeit des Individuums, zweckvoll zu handeln, vernünftig zu denken und sich mit seiner U m g e b u n g wirkungsvoll auseinanderzusetzen. 2
- Nun ist es nicht sinnvoll, sich das Seelenleben als eine Reihe voneinander isolierter Funktionen vorzustellen: alles hängt mit allem zusammen. Daher kann man den Verstand kaum als eine >für sich bestehende Größe< betrachten; Gefühle, Einstellun- gen, Motivationen, Stimmungen und Affekte wirken dauernd auf seine Tätigkeit ein. Schopenhauer war sogar der Meinung, der >Intellekt< sei ein >Sklave der Triebe<. Auf diese komplizierte Debatte können wir in unserem Gedan- kengang nicht eingehen. Für uns genügt der Hinweis, daß man niemals eine >reine Intelligenz< messen kann, sondern stets einen Menschen vor sich hat, dessen Verhaltensweisen und Reaktionsmöglichkeiten sowohl von biologischen Ausgangspo-
- T 3
- sitionen als auch von lebensgeschichtlichen Entwicklungen ab- hängig sind. Wenn tatsächlich intelligenzmäßige Unterschiede bei den Menschen >dispositionell< vorkommen, dann haben Kindheit und Jugend eine formende Kraft<, die das allenfalls Gegebene weitgehend überlagern und verändern kann. Unseres Erachtens kann man diese Relation keineswegs zahlenmäßig erfassen. Bekannt ist etwa die Schätzung von H. J. Eysenck, daß 80% der Intelligenz von den >Erbanlagen< stamme, 2 0 % von der Umwelt. Man fragt sich nur, welche >höhere Instanz< dem englischen Forscher (und seinen amerikanischen Kollegen C. Burt, A. R. Jensen) dieses >exakte Resultat eingegeben hat. Nichts davon ist bewiesen. Aber auch die Meinung der Milieu- theoretiker und der Behavioristen, >alles< sei von Erziehung bestimmt, kann nicht schlüssig bewiesen werden: sie hat nur den Vorzug, den starren Determinismus in die Schranken zu weisen und jedem Menschen gute Chancen einzuräumen. Für den Tiefenpsychologen ist es nicht nötig, in diesem Disput die eine oder die andere Partei zu ergreifen. Alfred Adler z.B. warf den Hereditariern >Vererbungsfatalismus< und den >Mi- lieugläubigen< Oberflächlichkeit vor. Er betonte nachdrück- lich, daß wir dem Kind auch eine gewisse schöpferische Kraft< zuschreiben müssen, mittels welcher es auf biologische Voraus- setzungen und Umweltsfaktoren >reagiert< - es ist nicht nur >Produkt seiner Umstände<, sondern gestaltet diese auch mit. Demnach kommt es nicht so sehr darauf an, >was einer mit- bringt, sondern was er daraus macht<. Daraus ist zu schließen, daß etwa ein >hoher Intelligenzquo- tient< noch nichts über den Lebenserfolg und den Kulturbeitrag eines Menschen aussagen kann. Goebbels z.B. mag einen IQ gehabt haben, der ihn in die Nähe eines Einstein rückt: aber niemand wird zweifeln, daß ein gewaltiger Unterschied zwi- schen diesen beiden Persönlichkeiten besteht. Diese Differenz kann annähernd erfaßt werden, wenn wir zwischen operationa- ler (technischer) und sozialer Intelligenz unterscheiden. Die erstere ist gewissermaßen wertneutral und eine Abstraktion: ein Krimineller kann hier unter Umständen mit einem Genie kon- kurrieren. Die letztere jedoch beurteilen wir im Sinn der Fra- gen: Wie lebt ein Mensch im Hinblick auf seinen Beitrag für die soziale Gemeinschaft, auf menschliche Kommunikation, auf Verständnis und Förderung seiner Mitmenschen, auf Kulturre- zeption und Kulturentwicklung?
- H
- So gesehen ist Intelligenz eindeutig ein Element des Charakters oder der Persönlichkeit. Ihr kommt nur in dem Maße eine positive Funktion zu, wie sie mit einem reichen und sensiblen Gefühlsleben verbunden ist. Was wir soziale Intelligenz nen- nen, ist wesentlich mit Gefühlsdifferenziertheit und Wertbe- wußtsein identisch. Hierin allerdings spielt die frühkindliche Sozialisation und das individuelle Schicksal eine gewaltige Rol- le. Lebensklugheit und Entwicklung zur Reife sind nicht von- einander zu trennen.
- Charakter und Triebhaftigkeit
- Ahnliche Überlegungen wie bei der Intelligenz müssen zum Thema »Triebhaftigkeit« angestellt werden. Wir verstehen unter >Trieb< eine kontinuierlich fließende, somatische Reizquelle, die sich als periodische Spannung (Bedürfnis) im Seelenleben repräsentiert und dazu drängt, bestimmte Handlungen zu voll- ziehen. Der Trieb wird stets im Zusammenhang mit Gefühlen erlebt und von äußeren >Reizsituationen< beeinflußt. Der Nah- rungs- (Selbsterhaltungs-) und der Sexual-(Arterhaltungs-) Trieb gehören zu den wichtigsten Triebarten; aber fast jede Schule der Psychologie unterteilt die Antriebserlebnisse des Menschen in eine andere Summe von Trieben, die auch ver- schiedene Hierarchien bilden. Da Triebe in der Biologie des Organismus verankert sind, erwecken sie den Eindruck von etwas Fundamentalem. Vor allem im 19. Jahrhundert galten sie als die eigentlichen Motoren des Seelenlebens. Man meinte, eine psychische Erscheinung bis zu ihren letzten Ursprüngen aufgedeckt zu haben, wenn man sie auf >Triebregungen< zurückführen konnte. Heute ist man diesbezüglich vorsichtiger geworden. Seit man den Menschen nicht mehr als >ein Tier wie alle anderen Tiere< beschreibt, sondern die menschliche Besonderheit im Reich der Lebewesen berücksichtigt, ist die >Trieblehre< nicht mehr das A und O der Psychologie. Für Freud galt das noch nicht. Als Materialist und leidenschaftlicher Anhänger der Darwinschen Entwicklungs- theorie wurde er zum einflußreichsten >Triebpsychologen< der Neuzeit. Als Freud auf Grund seiner psychotherapeutischen Erfahrun- gen eine Charakterologie zu entwerfen begann, war es für ihn
- *5
- von vornherein klar, daß Charakterzüge eine >triebhafte Basis< haben müßten. Sein erster Schritt in diese Richtung war der Aufsatz über >Cbarakter und Analerotik< aus dem Jahre 1908 (GW Bd. VII). Darin wird behauptet, es gebe Personen, die >ordentlich, sparsam und eigensinnig< (auch reinlich und gewis- senhaft) seien. Diese könne man >Analcharaktere< nennen, da ihre charakterlichen Wesenszüge aus der Sublimierung >analer Libido< entstanden seien. Die meisten Menschen dieses Typs hätten als Kleinkinder Mühe mit der Reinlichkeitsgewöhnung gehabt - als >Reaktionsbildung< auf diese übersteigerte Trieber- ziehung käme die oben erwähnte Eigenschaftstrias zustande. Bald wurden auch von den Psychoanalytikern orale, phallische und genitale Charaktere beschrieben. Immer ging man von den bekannten >Phasen der Libidoentwicklung< aus, die nach Freud die Seelenthematik der ersten fünf Lebensjahre beherrschen. Von der oralen Phase geprägte Menschen seien etwa sonnig- heiter oder düster-verstimmt: je nach den >Ernährungsschick- salen< und der Bewältigung der Entwicklungsprobleme dieser frühen Stufe der >Libidoorganisation<. Bei phallischen Typen dominieren die Züge einer kindlichen Eitelkeit (Penisstolz des Knaben, Penisneid des Mädchens) oder entsprechende Minder- wertigkeitsgefühle; der genitale Charakter jedoch sei gekenn- zeichnet von günstiger Bewältigung der Odipussituation, die ihn zur Entfaltung von Reife und Produktivität befähigt. Das große Verdienst dieser Charaktertypologie (die in der einschlägigen psychoanalytischen Literatur breit abgehandelt wird) besteht u.a. darin, daß sie die Charaktere der Menschen als von einem psychosozialen Werdegang< abhängig darstellt und auch den >Leib< in die Charakterkunde einbezieht. Charak- terzüge sind nicht einfach >seelische Formationen<; in ihnen muß auch das Somatische repräsentiert sein. Fraglich ist jedoch, ob man hierbei dem sexuellen Bedürfnis im weitesten Sinne des Wortes (Libido) so viel Platz einräumen darf. Hinter dieser Charakterologie stehen offensichtlich die Freudschen Neuro- sen- und Perversionstheorien, die selbst wiederum vielfältige Kritik erfahren haben. Vor allem die Umkehrung von Freuds Gedankengang lag für viele Kritiker nahe: nicht die Sexualität bestimmt den Charak- ter, sondern der Charakter determiniert eventuell die Sexuali- tät. In diesem Falle kann man mutmaßen, daß z.B. Perversio- nen nicht primär Triebanomalien sind. Gestört ist der Charak-
- 16
- teraufbau, die soziale Interaktion des Individuums, und aus dieser Störung erwachsen die Triebdeformationen, die das je- weilige Krankheitsbild beherrschen. Fehlen etwa charakterliche Wesenszüge wie Zärtlichkeit, Ver- trauen, Hoffnung, Hingabe, Sympathie usw., muß das sexuelle Bedürfnis in die Kanäle des Exhibitionismus, des Voyeurismus, des Sadomasochismus u.ä. geleitet werden, da Nähe und Ver- trautheit mit einem Du um jeden Preis vermieden werden soll. Libidoverteilung und Charakterstruktur mögen sich gegensei- tig bedingen, aber Libido kann nicht als das tragende Funda- ment des Charakters akzeptiert werden.
- Charakter als soziale Stellungnahme
- In kämpferischer Gegenposition zur psychoanalytischen Cha- rakterologie entwarf Alfred Adler seine »individualpsychologi- sche< Charakterkunde, die jede >Triebmythologie< als fragwür- dig einstuft und daher vermeiden will. Hier wird der Charakter als eine »soziale Stellungnahme« des Individuums verstanden. Nichts davon sei angeboren oder durch Konstitutionsmerkmale eindeutig determiniert. Das Kind werde in die >Welt der Mit- menschen« hineingeboren und müsse während seines Heran- wachsens Stellung beziehen zu den Gegebenheiten seines biolo- gischen, sozialen und kulturellen Daseins. Es entwickle hierbei gewohnheitsmäßige Reaktionsweisen, die sich zu einem ein- heitlichen >Lebensentwurf< zusammenschließen. Wichtig sei der Ausgangspunkt beim sogenannten »Minderwer- tigkeitsgefühl des Kindes«. Da Hilflosigkeit und Abhängigkeit am Anfang jeglichen Menschenlebens stehen, seien Unzuläng- lichkeitsgefühle die »Urtatsachen der psychischen Entwick- lung«. Verstärkte Unzulänglichkeit kann auch als »Daseins- angst« beschrieben werden. Dies ist ein stark bedrückender Zustand, den das Kind mit allen seinen Kräften zu überwinden trachtet. So richtet es sich unbewußt und dunkel nach Zielen wie Überlegenheit, Vollkommenheit, Geltung und Macht aus, um im »Chaos des Lebens« Richtpunkte zu haben. Die »psychi- sche Strömung« geht von unten nach oben: Selbstbehauptung und Überwindung von Schwierigkeiten sind die prinzipiellen Themen der Lebensgestaltung. Nun kann aber das »Überlegenheitsziel« in tausendfältige For-
- U
- men und Varianten eingekleidet werden. Manche Kinder stre- ben nach Herrschaft über andere, nach Wissen, Schönheit, Reichtum, Ansehen usw. Andere wieder haben ihrer frühen Umwelt >abgelauscht<, wie man auch durch Leiden, Dienen, Selbstaufgabe und Selbsterniedrigung Aufmerksamkeit auf sich konzentrieren kann. So entstehen scheinbar Umkehrungen des primären Macht- und Geltungsprinzips: es bedarf des feinen Gespürs eines geübten Menschenkenners, um z.B. in der Trau- er des Depressiven, in den psychosomatischen Krankheitser- scheinungen, im Masochismus vieler Neurotiker den >Weg nach oben< zu erkennen, indem nämlich so mancher durch Klagen, Dulden und Kränkeln einen pathologischen >Ehrgeiz< befriedigen kann. Minderwertigkeitsgefühl und Geltungsstreben sind für Adler nicht nur die Grundpfeiler der Neurosenlehre, sondern auch der wohlverstandenen Charakterologie. Als dritter Faktor ist noch das »Gemeinschaftsgefühle in Betracht zu ziehen, das als die stärkste Kraft im menschlichen Seelenleben eingestuft wer- den muß. Der Mensch ist von Natur ein soziales Lebewesen. Alles Psychische an ihm ist auf >Mitmenschlichkeit< ausgerich- tet. Diese entdeckt man bereits im Zärtlichkeitsbedürfnis des Kindes, in seinem Willen zum Wachsen und Werden, in vielfa- chen sozialen Anpassungsprozessen. Sind aber die Entwick- lungsbedingungen in der Familie und Umwelt ungünstig, dann verkümmert der soziale Impuls frühzeitig: alle Fehlschläge der psychischen Entfaltung sind durch eine Verringerung der zwi- schenmenschlichen Anschlußbereitschaft und des >Sozialinter- esses< gekennzeichnet. Je geringer das Gemeinschaftsgefühl ausgebildet ist, um so schwieriger wird das Leben für das betreffende Individuum. Denn alle Aufgaben des Lebens erfordern Beziehungsfähigkeit, um befriedigend gelöst werden zu können. Adler spricht etwa von den Aufgaben der Arbeit (Beruf), der Liebe (Sexualität und Partnerschaft), der Gemeinschaft und der (kunstvollen) Le- bensgestaltung. Wer weder soziale Geschicklichkeit noch Kon- taktbereitschaft aufbauen konnte, wird diesen (naturgemäßen) Aufgaben ausweichen müssen oder sich mit Teillösungen zu- friedengeben. In seiner Seele werden Minderwertigkeitskom- plexe und übersteigertes Geltungsstreben die Vorherrschaft erlangen. Anstelle realer und sinnvoller Lebensführung wird oft der AVille zum Schein< (Selbstbetrug, Lebenslüge) treten.
- 18
- Der Charakter steht also im Dienst richtiger oder falscher Lebensziele. Seine Wesenszüge ähneln »Leitlinien«, mit denen ein unbewußtes Überlegenheitsideal angestrebt wird. Adler spricht auch von »Charakterschablonen«, um anzudeuten, daß flexibles und schöpferisches Reagieren durch starre Verhaltens- muster ersetzt wird. Je »neurotischer« der Charakter ist, um so mehr spielen in ihm offene und geheime Macht- und Geltungsambitionen die Hauptrolle. So kommt es vor allem zu Charaktereigenschaften trennender Art wie etwa: Ehrgeiz, Eitelkeit, Machtgier, Trau- er, Angst, Schüchternheit, Neid, Geiz, Haß, Eifersucht, Lau- nenhaftigkeit, Menschenverachtung usw. Verbindende Cha- rakterzüge jedoch sind: Mut, Lebensfreude, Wohlwollen, Mit- leid, Güte, Einsicht, Geduld, Kooperation, Weisheit usw. In den letzteren werden Angst und Nichtigkeitsgefühl sinnvoll kompensiert, indem soziale Einfügung und Kulturbeitrag zu- stande kommen.
- Verhalten, Eigenschaft und Personkern
- Gegen das Studium des Charakters ist in neuerer Zeit von Seiten der Behavioristen eingewendet worden, man könne nie und nirgendwo »Charakterzüge« beobachten: einzig feststellbar und empirisch zu fassen seien Verhaltensweisen und Handlungen, die aus den jeweiligen Situationen hervorgehen. Diese behavio- ristische Kritik ist sehr radikal, soll aber nicht einfach vom Tisch gewischt werden. Denn tatsächlich ist der Begriff »menschliche Eigenschaften« ein Konstrukt: wir summieren vielfältige Eindrücke an einem Menschen und postulieren dann gewissermaßen, daß sich in ihnen »eine Eigenschaft« manifestie- re. Man kann sich aber kaum vorstellen, in der Wissenschaft und im Alltagsleben ohne diese Hypothese auszukommen; mit Recht sagt William Stern: Wir haben das Recht und die Pflicht, den Begriff der Eigenschaft bestimmt zu umreißen; denn in jeder Betätigung der Person findet sich neben einem veränderlichen Anteil zugleich ein beständiger zielstrebi- ger Anteil, und diesen letzteren isolieren wir im Begriff der Eigen- schaft. 3
- Natürlich muß man sorgfältig genug vorgehen, um von Fall zu
- 19
- Fall zu ermitteln, ob ein Verhalten weitgehend situationsbe- dingt ist oder eher dem >Innern der Person< entspringt. Wenn jemand z.B. in materieller N o t ist und sich deshalb weigert, für soziale Zwecke zu spenden, werden wir ihn nicht >geizig< nennen. Beobachten wir jedoch, daß ein wohlhabender oder reicher Mensch nicht bereit ist, von seinem Uberfluß abzuge- ben, wird sich die Assoziation >Geiz< aufdrängen. Konstant wiederkehrende Verhaltensweisen und Handlungen wurzeln in Eigenschaften oder Haltungen, die sich zwar im Laufe des Lebens wandeln, aber irgendwie zum Dauerinstru- mentarium einer Persönlichkeit gehören. Praktische Menschen- kenntnis besteht u.a. darin, daß der geübte Menschenbeobach- ter aus den flüchtigen Reaktionen seiner Mitmenschen solche Dauermotivationen herausspürt und demzufolge voraussagen kann, wie sich X oder Y in einer bestimmten Situation beneh- men wird. Solche Prophezeiungen sind zweifelsohne möglich, und manch ein Menschenkenner kann darin eine gewisse Per- fektion erreichen. Ein Vorteil ist ihm hierbei an die Hand gegeben: die Charakter- eigenschaften des Menschen sind immer »strukturell zusam- mengefügte, d.h., beim Vorhandensein der einen Eigenschaft kann man mit einiger Sicherheit eine Gruppe von weiteren Eigenschaften voraussetzen. So wird etwa ein Geizkragen mit großer Wahrscheinlichkeit auch mißtrauisch, gefühlskarg, herrschsüchtig und lieblos sein. Bei einem gütigen Charakter werden wir leicht auch Mitleid, Wohlwollen, Aufgeschlossen- heit, Humor und Fähigkeit zur Selbstkritik vorfinden. So existiert zu jedem Charaktermerkmal ein ganzes >Biindel von Merkmalen<, die »sinngemäß dazugehören. Man muß sich dies nicht als ein »Naturgesetze vorstellen, das mit mathematischer Sicherheit arbeitet; aber seit Dilthey wird der >Strukturbegriff< in den Humanwissenschaften mit größtem Nutzen angewen- det, ohne daß der »Mangel an Stringenz< als Nachteil empfun- den wird. In vielen Bereichen der Forschung genügen Wahr- scheinlichkeitsbefunde durchaus. Nicht nur die Eigenschaftsgruppen der Menschen sind Struktu- ren, sondern auch die Persönlichkeit selbst ist ein strukturiertes Ganzes. Auch hier wieder können Behavioristen einwenden, daß wir von etwas Unsichtbarem und Unkonkretem reden. Niemand hat eine »Persönlichkeit mit »leiblichen Augen gese- hene. Wohl aber pflegen wir, bei wohlwollendem Interesse für
- 20
- unsere Mitmenschen, die Person des anderen irgendwie zu >schauen<, d.h. mit dem »dritten Auge< zu sehen. Wir erblicken dann gleichsam »sein Inneres«, das Gefüge seiner Gefühle, Gesinnungen, Strebungen, Wertungen, deren Summe wir Ich, Selbst, Persönlichkeit oder Charakter nennen. Nur ein Beha- viorist kann, von seiner Theorie gefangen, bestreiten, daß wir hiermit etwas Realem gegenüberstehen; die Person ist offenbar »Wirklichkeit«. Dieser »Personkern« in uns selbst und im Du ist schwer zugänglich und wird viel häufiger verkannt als erkannt. Ohne geduldige gefühlsmäßige Zuwendung hat man wohl kaum die Chance, derart ins Innere eines fremden Ichs Eingang zu finden. Die Gesinnungs- oder Lebensleitlinie einer Person ist immer hinter einer Fassade von konventionellen Verhaltensmustern, Zufallsreaktionen, erworbenen Gewohnheiten und auch be- rufs- oder epochebedingten Haltungen verborgen; das »Wesen« eines fremden Individuums wird nur dann und wann im Spek- trum der Beobachtungen sichtbar, und zwar ist es am ehesten erspürbar, wenn man in »liebender Kommunikation« mit dem Betreffenden steht und nichts an ihm »herausfinden will«. Test- methoden, Fragebogen, künstliche Prüfungsbedingungen tref- fen von vornherein nicht auf das Personzentrum, welches allein den Schlüssel zum Verstehen des Mitmenschen bietet. Das wußte Friedrich Schiller, als er seinen Wallenstein sagen ließ: Des Menschen Taten und Gedanken, wißt, sind nicht wie Meeres blind bewegte Wellen. - Die innere Welt, sein Mikrokosmos ist der tiefe Schacht, aus dem sie ewig quellen. Sie sind notwendig, wie des Baumes Frucht, sie kann der Zufall gaukelnd nicht verwandeln. - Flab' ich des Menschen K e r n erst untersucht, so weiß ich auch sein Wollen und sein Handeln. 4
- Charakterologie und Ausdruckskunde
- Die obige Aussage, daß sich der »Personkern« eines Men- schen nur gelegentlich in seiner Eigenart enthüllt, muß relati- viert werden: gewiß trifft dies zu, aber andererseits liegt auch die Person als Ganze in allen ihren Lebensäußerungen - nur pflegen wir sie nicht wahrzunehmen. Aus der Tatsache, daß im
- 21
- kleinsten Ausdrucks- und Verhaltensphänomen >der ganze Mensch< enthalten ist, leitet sich die sogenannte Ausdruckskun- de ab. Sie will wissenschaftlich untersuchen, wie man über das Verständnis des Ausdrucks zum Verständnis der Person ge- langt. Für diese Methode steht umfängliches Material zur Verfügung. Hauptsächlich befaßt man sich mit Physiognomik (Ausdrucks- merkmale der Gestalt und des Gesichts), Mimik (Bewegungen des Gesichts), Gestik und Motorik (Körperbewegungen), Stim- me, Sprechweise und Handschrift. Im Laufe der letzten Jahr- zehnte sind zahllose Arbeiten zu diesen Themen veröffentlicht worden. Die Ausdruckskunde wurde zu einem Hilfsgebiet der diagnostischen Psychologie und der Charakterologie entwik- kelt. Aber es ist längst noch nicht eindeutig klar, auf welchem Wege wir >Ausdruck< begreifen und wie wir zu einiger Sicherheit im Verstehen kommen. Fast alle Autoren betonen, daß wir auf Ausdruckserscheinungen emotional reagieren, d.h., daß Aus- druck stets Eindruck macht. Wir beurteilen »blitzschnelle den Ausdrucksgehalt von mimischen, gestischen, stimmlichen und anderen Äußerungen; das Grundfaktum ist vielleicht hierbei die unmittelbare »Einsfiihlunge von Mensch zu Mensch, auf Grund derer auch Einfühlung stattfinden kann. Da Menschen stets durch »Gefühlsansteckunge aufeinander wirken, können sie »einfühlende sich darum bemühen, die »Botschaftern zu zergliedern, die ihnen fortwährend bei Begegnungen mit ande- ren zuströmen. An dieser Stelle hilft uns die Hypothese weiter, daß alles Psychische wesensmäßig »Kommunikatione ist. Die Gesichts- züge eines Menschen, seine Handbewegungen, seine Körper- haltung, seine Stimme, seine Wortwahl, seine Schreibbewegun- gen usw. sind nicht einfach »Zufallsäußerungene, sondern sie stellen stets eine Beziehungsaufnahme dar oder bereiten sie vor. In diesem Sinne legt unbewußt jeder Mensch in seine Aus- druckserscheinungen eine »Wirkungsintentione hinein; er ge- staltet sie so, daß er im Erlebnis der Ausdrucksempfänger jene Eindrücke erweckt, die ihm als wünschbar vorschweben. Es war unseres Wissens Ludwig Klages, der als erster die »Zielvor- stellungene im Ausdruck erkannte; als »Reflexe ist derlei kaum einzuordnen, wohl aber als Mitteilung, in der stets »Selbstmit- teilunge intendiert wird.
- 22
- Ausdruck jeglicher Art ist Sprache, aber leider sind wir in dieser Sprache wenig geschult und können sie nur äußerst mühevoll in die Umgangssprache übersetzen. So war z.B. die Physiogno- mik lange Zeit auf die Beurteilung der festen Gesichts- und Schädelkonturen beschränkt, die großenteils konstitutionell ge- geben sind - richtiger wäre jedoch, dem »lebendigen Ausdruck« der Gesichtszüge nachzuspüren, der durch die Knochen- und Weichteilformen gewissermaßen »hindurchschimmert«. Für ciie Handschriftdeutung (Graphologie) wurden fast mechanische Deutungsregeln vorgegeben, und erst Autoren wie Klages und Max Pulver haben betont, daß jedes Detail einer Handschrift erst in die Gesamtinterpretation eingeordnet werden kann, wenn man durch die »Kunst des Schauens« vom Gesamtein- druck her das »Formniveau« (Klages) oder den »Wesensgehalt« (Pulver) der Schreibbewegung ermittelt hat. Bedauerlich bleibt, daß bei solchen Beurteilungen dem Gefühl gegenüber dem Verstand die größere Kompetenz eingeräumt werden muß: von daher wird jeder Ausdrucksdeutung ein gewisser Unsicherheitsfaktor anhaften. Wie hier die wissen- schaftliche Psychologie notwendigerweise an Grenzen stößt, sagt Hubert Rohracher in >Kleine Charakterkunde< folgender- maßen:
- N i e m a n d kann genau sagen, worin der Unterschied zwischen einem fröhlichen, spöttischen, ironischen, gezwungenen, höhnischen, ver- gnügten, befreienden, verlegenen, herzlichen oder hämischen G e - sichtsausdruck besteht, aber jeder erfaßt diesen Unterschied mit gro- ßer Sicherheit und ohne Überlegung - der Eindruck des Hämischen, Spöttischen oder Fröhlichen entsteht ganz von selbst, ohne unser Zutun, eben »unmittelbar«, ohne Nachdenken und Uberlegen. Nichts wäre lächerlicher, als etwa den Menschen mit wissenschaftlichen M e - thoden beibringen zu wollen, wie sich das verlegene vom herzlichen Lachen unterscheidet, aber nicht einmal dazu wäre die Psychologie in der Lage. 5
- Der Tiefenpsychologe und Psychotherapeut lernt sein Aus- drucksverstehen nicht im psychologischen Laboratorium, son- dern im Umgang mit seelisch leidenden Menschen, die er verstehen und fördern will. Da sich psychologische Behandlun- gen über Monate und Jahre hinweg erstrecken, kann man bei geduldiger Forscherhaltung unzählige Beobachtungen über Charaktere in allen Lebenssituationen machen. Aber Material- sammlung ist immer erst die »Vorstufe zum Verständnis«: letz-
- 23
- teres erfordert eine »synthetisierende Kraft des Schauens«, für die nicht jedermann in gleicher Weise begabt ist. Wahre Menschenkenner sind jene, die die Summe der Detailbe- funde lange >in der Schwebe« halten können und mit größtmög- licher Behutsamkeit alles Beobachtete auf das »Personganze« beziehen, das in ihm »zum Ausdruck kommt«. Die Phantasie des Interpreten, gezügelt von kritischem Verstand und wachsa- mem Gefühl, ist hierbei von erstrangiger Bedeutung. Auch muß man unermüdlich den »hermeneutischen Zirkel« durchlau- fen, der von den Details zum Ganzen und revidierend-korrigie- rend vom Ganzen zu den Details geht. Voreilige Schlußfolge- rungen und Festlegungen führen lediglich zu vorurteilsbeding- ten Schematisierungen, denen sich die »lebendige Person« ent- zieht. Ein bedeutender Psychologe des 18. Jahrhunderts erklärte dazu: Es liegt in den Charakteren eine gewisse Notwendigkeit, eine gewisse K o n s e q u e n z , vermöge welcher bei diesem oder jenem G r u n d z u g eines Charakters gewisse sekundäre Z ü g e stattfinden. Dieses lehrt die E m p i - rie g e n u g s a m . . . Soviel weiß ich: wenn ich jemand eine Viertelstunde gesprochen habe, so will ich ihn gut zwei Stunden reden lassen. 6
- Tiefenpsychologische Charakterdiagnostik
- Der Tiefenpsychologe achtet wohl genau auf Mimik, Gestik, Stimme und Verhalten seines Patienten, aber er holt seine Beurteilungskriterien aus ganz anderen Regionen des bewußten und unbewußten Seelenlebens. Dabei kann er die »Einheit der Persönlichkeit« bis in alle ihre »Tiefenschichten« hinein viel deutlicher ans Licht rücken als seine Berufskollegen, die mei- stens nur kurzfristige Kontakte mit ihren »Versuchspersonen« aufbauen. a) Freud wies uns als erster darauf hin, daß neurotische Sympto- me einen unschätzbaren Wert für die Persönlichkeitsdiagnose besitzen. Vor den Entdeckungen der Psychoanalyse sah man im Symptom ein »kausal verursachtes Geschehen«, das letztlich nur auf eine »Gesamtdegeneration« des Organismus verwies. Freud jedoch faßte die Symptomatik als »sinnhaltig« auf; er begriff sie als »Botschaft des Patienten«, die dieser selbst nicht verstand. So deutete er etwa eine hysterische Abasie (Unfähigkeit zu gehen)
- 24
- als Mitteilung, daß die Patientin keinen Weg sehe, auf dem sie »vorwärts gehen< könne; ein hysterischer Gesichtsschmerz drückte aus, daß die Patientin »sich geohrfeigt fühlte< usw. Seit den epochemachenden >Studien über Hysterie< (1895) wissen wir, daß sich in den neurotischen Symptomen die ganze Le- bens- und Weltanschauung der Patienten »zusammendrängte man kann regelrecht auch eine Typologie aufstellen, die von den jeweiligen Neurosen her Charakterstrukturen definiert. So spricht die Psychoanalyse von hysterischen, zwangsneuroti- schen (zwanghaften), angstneurotischen, depressiven und schi- zoiden Charakteren - Begriffsbestimmungen, die allesamt aus der Neurosenlehre und Psychopathologie stammen. Beobach- ten wir etwa an einem Menschen Zwangsgedanken oder -hand- lungen, dann können wir auf Grund neurosenpsychologischer Erfahrung von ihm ein mutmaßlich zutreffendes Charakterpor- trät skizzieren, das allerdings im Einzelfall der konkreten Veri- fizierung bedarf. b) Nicht nur Symptome erschließen uns den Charakter: auch Träume sind hierzu eine entscheidende Hilfe. Freuds Buch >Die Traumdeutung< (1900) ist eine subtile Interpretationsanleitung, mittels derer aus dem »manifesten Traum< auf die »latenten Traumgedanken< zurückgedacht werden kann. Dabei soll die infantil-triebhafte Basis der Persönlichkeit zum Vorschein kommen. Das Unbewußte des Seelenlebens sei im Traum noch vollständiger oder deutlicher enthalten als in der neurotischen Symptomatik: der Traum und seine Deutung seien der »Königs- weg zum Unbewußtem. Vereinfacht ausgedrückt kann man sagen, daß die Träume stets ein >Charakterresümee< darstellen, denn der Mensch ist faktisch so, »wie er träumt<. Oft zeigen Traumszenen die Einstellung des Träumers viel offener als sein bewußtes Reden und Argumen- tieren. So wird der Angstliche angsthaft träumen, der Mutige mutig, der Triebhafte triebhaft usw. Allerdings muß die Inter- pretation sehr behutsam vor sich gehen, da der Traum - wie alle Ausdruckserscheinungen - vieldeutig ist. Man liegt erst dann annähernd richtig, wenn der Befund aus der Traumbeurteilung mit den Befunden aus den übrigen Lebensäußerungen des Exploranden einigermaßen in Ubereinstimmung ist. c) Auch Fehlleistungen können blitzlichtartig einen Einblick in die Charakterstruktur gewähren. Solche Funktionsentgleisun- gen (Versprechen, Verlegen, Vergessen, Verschreiben, Unfälle
- usw.) sind nicht einfach sinnlos, sondern können tiefere Inten- tionen enthüllen. Die Beispiele in Freuds >Zur Psychopathologie des Alltagslebens< (1904) sind diesbezüglich oft verblüffend. Wenn etwa ein Abgeordneter in seiner Reichstagsrede versi- chert, daß seine Fraktion >rückgratlos< (anstatt >rückhaltlos<) hinter dem Kaiser stehe, dann hat er seine Gesinnung ganz gut verraten. Oder wenn ein Untergebener anläßlich einer Jubelfei- er die Anwesenden dazu auffordert, zum Wohle des verehrten Chefs »aufzustoßen« (anstatt >anzustoßen<), dann wird dieser Chef nicht gerade übertrieben beliebt sein. Aber auch hier ist Vorsicht geboten. Nicht jede Fehlleistung enthält eine unbe- wußte Absicht: es gibt wahrscheinlich auch viele harmlose Funktionsstörungen, die aus Aufregung, Ermüdung, Unsicher- heit usw. stammen. d) Psychosomatische Symptome sollen ebenfalls auf die Charak- terstruktur des betroffenen Patienten bezogen werden. Auch in ihnen verdichtet sich oft die gesamte Lebenseinstellung und Lebensproblematik des jeweiligen Individuums, das »körper- lich« erkrankt, weil es »seelisch« nicht mit seinen Lebensaufga- ben fertig wird. Die Hilflosigkeit angesichts drängender und bedrängender Konflikte führt dazu, daß »Leben« sich in »Lei- ben« verwandelt (wie sich die sogenannte »Daseinsanalyse« von L. Binswanger und M. Boss ausdrückt): die Erkrankung des Leibes bekundet deutlich genug das »existentielle Versagen«. Wiederum sind wir darauf verwiesen, den »Sinngehalt« solcher Krankheiten aufzudecken. So betonen die Autoren, daß z.B. Magen- und Zwölffingerdarmgeschwi'ire bei Menschen auftre- ten, deren Lebensgefühl dauernd auf »Ernährt-sein-Wollen« gestimmt sei; passive Abhängigkeitswünsche kollidieren mit dem ausgeprägten Autonomiestreben des Ulcuspatienten, der damit in unlösbare Konfliktsituationen hineingerät. Uberstei- gerter Ehrgeiz scheint hierbei eine wesentliche Rolle zu spielen. Die Daseinsanalytiker behaupten, nur derjenige bekäme ein Magengeschwür, dessen Existenz dauernd auf ein aggressives Verschlingenwollen der Welt und der Mitmenschen gestimmt sei. So ist erkennbar, daß die Geschwürerkrankung im Charak- ter des Patienten wurzelt und erst dann entscheidend beeinflußt werden kann, wenn die Charakterbeschaffenheit durch Selbst- erkenntnis und therapeutische Nacherziehung geändert wird.
- Das Asthma bronchiale mag eine biologische Basis haben (spe-
- 26
- zifische Reizempfindlichkeit der Bronchialschleimhaut), aber auch hier spielt >das Seelische« oder die >Wesensstruktur< eine gewichtige Rolle. Asthmatiker haben oft Mühe, den vom Le- ben geforderten Wechsel von Passivität zu Aktivität (und um- gekehrt) zu vollziehen. Eine allgemeine >Hingabestörung< liegt meistens ihrem Leiden zugrunde, respektive eine Unfähigkeit, sich bei den jeweils passenden Gelegenheiten zu >öffnen< und zu >verschließen<. e) Bis jetzt haben wir einzelne Tatsachen ins Auge gefaßt, in denen - gemäß den tiefenpsychologischen Hypothesen - das Ganze des Seelenlebens bzw. der >Existenz< zum Ausdruck gelangt. Nun soll aber auch daran erinnert werden, daß die gesamte Biographie des Patienten für die Charakterdiagnostik besonders wertvolle Materialien liefert. Nichts gibt uns so viel Aufschluß über den Charakter eines Menschen wie seine Le- bensgeschichte. Der Mensch ist, wie Sartre sagt, nicht mehr und nicht weniger als >die Summe seiner Taten< (wozu auch seine Leiden gehören). Daher ist die Erarbeitung des inneren und äußeren Werdeganges der Persönlichkeit seit den Anfängen der Tiefenpsychologie das Kernstück der Charaktererfassung und der therapeutischen Intervention. Leider ist es sehr schwierig, eine annähernd »objektive Biogra- phie< eines Patienten zu erhalten. Wenn dieser nämlich seine »Geschichte« erzählt, dann geschieht dies unweigerlich tenden- ziös: er beleuchtet die »Tatsachen« in sehr eigenwilliger Weise, vergißt und verdrängt das Unangenehme oder ihm nicht Pas- sende, so daß schließlich von historischer Wahrheit in keiner Weise gesprochen werden kann. Die Psychotherapeuten wissen um die Unzulänglichkeit aller Patientenberichte, haben sich aber damit abgefunden, da sich ja auch in solchen bewußten oder unbewußten Entstellungstendenzen der Charakter des Erzählers dokumentiert. Nur muß man nach und nach einen Schlüssel finden, um Phantasie und Realität auseinanderhalten zu können. Erst dann wird die Biographie lesbar wie ein Text, zu dem man den >Code< gefunden hat. f) Die Auslegung der Patientenberichte (mit Textkritik und wahrscheinlichen Korrekturen und Konjekturen) erfolgt be- kanntlich am Leitfaden jener Erfahrungen mit der Charakter- struktur des Patienten, die der Therapeut während der Therapie selbst gemacht hat. Da er in eine langdauernde und intensive Beziehung zu seinem Gegenüber tritt, kann er dessen Wesens-
- 2 7
- art am eigenen Leibe empfinden, erleben und erleiden. So werden die Schicksale innerhalb von Übertragung und Gegen- übertragung zu Hilfsmitteln der Charakterdiagnostik. Wie der Patient sich draußen im Leben zu seinen Bezugsper- sonen verhält, vernimmt der Therapeut meistens nur durch die Patientenberichte, in denen Wahrheit und Irrtum sich bunt durcheinandermischen. Will er in diesem Chaos von Mitteilun- gen einen festen Standort finden, dann ist ihm dieser dadurch gegeben, daß sich der Patient auch ihm gegenüber so gibt, wie er ist: hier ist authentische Beobachtung möglich, die allerdings den totalen Einsatz des Therapeuten erfordert. Weiß man etwa aus eigenen Erfahrungen, daß der Patient nachtragend, miß- trauisch, kämpferisch, unverständig, reizbar und gefühlsblok- kiert ist, dann wird man seinen Bericht über eheliche Kalamitä- ten ganz anders auswerten, als wenn man ihn als freundlich, gütig, verständig, heiter und wohlwollend kennengelernt hat. Zwischen Lebensgeschichte und Gegenwartsverhalten muß >hermeneutisch< hin- und hergependelt werden: aus der ersteren wird das letztere verstanden, und das letztere beleuchtet drama- tisch immer auch die erstere. Je kenntnisreicher und souveräner der Psychotherapeut ist, um so mehr Fakten aus dem Patientenleben und aus dem unmittel- baren Verhalten, das ihm sein Gegenüber darbietet, kann er überblicken, behalten und »synthetisch verknüpfen«. Diese Wahrnehmungs- und Erlebnissynthese ist ein schöpferischer Akt, der mit künstlerischer Arbeit durchaus vergleichbar ist: man bringt derlei nur zustande, wenn man dem Psychothera- peutenberuf jähre- und jahrzehntelang seine ganze Konzentra- tion widmet und sich dabei ständig theoretisch weiterbildet. Die Erfahrung der Konkordanz aller Einzelbefunde - trotz äußerlicher Disparatheiten aller Art - führt erst zu einem evidenten Verständnis, das Nähe zwischen den beiden Beteilig- ten des Therapieprozesses herbeiführt. Solange der Beurteilte dem Beurteiler noch als »sehr widersprüchlich« erscheint, muß weiter geforscht werden. Der Mensch ist kein Chaos von Strebungen und Tendenzen; in seinen Trieben, Ausdruckser- scheinungen, Gedanken und Uberzeugungen steckt jeweils ein bestimmtes »Lebensgesetz«. So wird etwa der »traurige Patient« nicht nur hängende Gesichtszüge, matte Augen, eine leise und dumpfe Stimme, sparsame Gesten, geringen Mitteilungsdrang
- 28
- usw. zeigen, sondern auch dazu passende Gedankengänge, Wertvorstellungen und eine spezifische Welt- oder Lebensan- schauung. Die Einheit dieses Weltentwurfs oder Lebensstils wahrzunehmen ist die erste Bedingung der psychotherapeuti- schen Intervention.
- Dialektik zwischen Charakterdiagnose und Charakterdiagnostiker
- Wiewohl der Tiefenpsychologe neben den üblichen Ausdrucks- erscheinungen neurotische und psychosomatische Symptome, Träume, Fehlleistungen, freie Assoziationen, lebensgeschichtli- che Berichte und Ubertragungsphänomene als Material zur Verfügung hat, sind seine Charakterdiagnosen keineswegs über jeden Zweifel erhaben und können oft genug in die Irre führen. Die wichtigste und in keiner Weise auszuschaltende Fehler- quelle liegt in der Persönlichkeit des Beurteilers, in seiner eigenen Charakterstruktur. Diese bestimmt nämlich, was er an seinem Exploranden wahrnehmen (tendenziöse Wahrneh- mung!) kann und wie er diese Eindrücke gemäß seinen persön- lichen Motivationen, Gefühlen, Vorurteilen und Lebensan- schauungen einzuordnen versucht. Ist etwa der Psychothera- peut ein Geizkragen, dann wird er »normale Konsumlust< seines Patienten als »Verschwendungssucht« taxieren; ist er ein asketi- scher Puritaner, dann wird er trotz seines ausgiebigen Studiums von Freuds »Gesammelten Werken« und seiner »Lehranalyse« ein Gefühl des Befremdens angesichts der »Leichtlebigkeit« von Patienten nicht loswerden; führt er schließlich selbst eine un- glückliche Ehe (was auch bei Therapeuten häufig genug vor- kommt), dann wird er bei Eheschwierigkeiten seiner Klienten unwillkürlich aus seinen eigenen Bedrängnissen heraus Stellung beziehen; diese Stellungnahme wird oft »erschreckend subjek- tiv« sein. Und diese Subjektivität des Therapeuten kommt nicht erst bei genauerer Beurteilung des Patienten zum Tragen. Sie determi- niert bereits das »Erfahrungsfeld«, das in der psychotherapeuti- schen Situation selbst gegeben ist. Die Persönlichkeit des Pa- tienten ist ja keine feste Größe, die sich immer in derselben Weise kundtut (wie etwa ein Stein immer ein Kilo schwer ist, ob ihn Hinz oder Kunz trägt). Wie sich ein Charakter manife-
- 29
- stiert, ist durchaus abhängig von der zwischenmenschlichen Lage, in der er sich befindet. So kommt es, daß derselbe Patient bei zwei verschiedenen Therapeuten ganz andere Kindheits- erinnerungen zutage fördert, andere Träume träumt, andere Phantasien entwickelt und in andere Stimmungen und Gefühle versetzt wird. Wenn zwei Menschen einander begegnen (und länger zusammenarbeiten), dann spielen sich blitzschnell Kom- munikationsbedingungen ein, die den Rahmen abstecken für das, was in dieser Beziehung lebendig werden kann und was nicht. Daher geht der Beobachter in solchen Erfahrungsberei- chen nahezu vollständig in seine Beobachtungsresultate ein. Tut er dies unkritisch, dann kann es zu jener unerfreulichen Situation kommen, die schon Spinoza beschrieb: Wenn Paul über Peter Aussagen macht, dann erzählt er uns mehr über Paul als über Peter. 7
- Die Konsequenz daraus darf natürlich nicht dazu führen, daß man jegliche Bemühung um Objektivität in der Seelen- und Charakterforschung aufgibt. Die Schwierigkeit, zwischen Sub- jektivität und Objektivität zu vermitteln, ist groß, aber nicht unüberwindlich. Jedenfalls kann der Mensch mit einiger Diszi- plin so etwas wie eine »kritische Subjektivität« entwickeln. Kenner auf diesem Gebiet wissen, daß dies ohne lebenslange Selbsterziehung und Kulturbemühung nicht zu schaffen ist. Wer sich zu einem gelassenen und souveränen Wissenschaftler entwickeln will, muß sich allen erdenklichen Konflikten stel- len, um aus eigenem Verhalten in tausendfältigen Notlagen zu erfahren, wieweit er belastbar ist und welche Konturen sein >Wesen< aufweist. Viktor von Weizsäcker pflegte zu sagen: »Wer das Leben verstehen will, muß an ihm teilnehmen!« Und Teilnahme heißt hier nicht, in irgendeinem Schlupfwinkel über Büchern zu brüten oder sich in die komplizierte Arbeitsweise irgendwelcher Apparate zu vertiefen, sondern sich dem Leben in seiner »gesamten Breite« zu stellen, was meist die Folge hat, daß man da und dort von der Realität kräftig gezaust wird. Lebenserfahrung wird teuer erkauft, aber nach dem Urteil der Kundigen ist sie ihren Preis wert (wenn man sie richtig verar- beitet). So kommt es, daß gewiegte Praktiker, die sich überall den Wind um die Ohren wehen ließen, oft bessere Menschenkenner und Charakterbeurteiler sind als Psychologieprofessoren, die
- 30
- sich - geschützt von Titeln, Ehren und Ämtern - von der Wirklichkeit fernhalten können und in dieser Realitätsferne ihre Theorien konstruieren. Andererseits mangelt es den Prak- tikern an einer Theorie, die Beobachtungen zusammenfaßt und durchschaubar macht. Das Ideal wäre ein Zusammentreffen von Lebenspraxis und theoretischem Weitblick, eine Synthese, die man jedoch nur in seltenen Fällen vorfindet. Die Übung in geistiger Arbeit bietet die Chance zur Korrektur subjektiver Vorurteile, da jede Wissenschaft Techniken der Vorurteilsüber- prüfung vermittelt. Noch bedeutsamer aber als Praxis und Theorie ist das Ethos des Charakterbeurteilers. Man kann in der Charakterdiagnostik nur dann gute Resultate erzielen, wenn man selbst viele Werte und Tugenden in sich verinnerlicht hat, so daß man für Werte und Tugenden an einem Du empfänglich ist. Der egozentri- sche, gefühlsarme, überwiegend auf Selbstdurchsetzung ge- stimmte Mensch wird an seinem Gegenüber nur jene Eigen- schaften wahrnehmen, die er >zu seinem Nutzem ausbeuten kann oder die er >für seinen Nutzen« befürchten muß. Der heitere, reife, lebensernste und lebenskluge Mensch jedoch wird sich von der Andersartigkeit des Du nicht bedroht fühlen, sondern sie als Möglichkeit zur eigenen inneren Bereicherung erkennen. Aus dem Reichtum des eigenen Wesens kann er fremde Wesensbeschaffenheit anerkennen und eventuell sogar lieben. Er wird den Blick für die Nuancen und Konturen der Fremdpersönlichkeit in sich schärfen und ausbilden. Denn man versteht nur andere Menschen, wenn man sich selbst entwickelt und entfaltet. Ist man in sich verschlossen und blockiert, dann kann man dem Andersartigen, Andersdenken- den und Andersgläubigen nicht gerecht werden, da man menschliche Beziehungen allzusehr nach einem schroffen Freund-Feind-Schema strukturiert. Aus allen voraufgegange- nen Schilderungen sollte deutlich geworden sein, daß sich zur Charakterbeurteilung nur jener eignet, der Eigenschaften in sich entfaltet hat, die man seit jeher als >gut< und >human< eingestuft hat, nämlich: Wohlwollen, Hilfsbereitschaft, innere Sicherheit, Humor, Toleranz, Liberalität, Mitgefühl, relative Angstfreiheit und Lebensmut.
- 3i
- Charakterforschung als Lebensstudium
- In Abwandlung eines bekannten Ausspruchs über den Krieg und die Generale kann man den Satz formulieren: »Die Cha- rakterologie ist eine zu wichtige Sache, als daß man sie den Charakterologen und Psychologen überlassen dürfte.« Damit wollen wir zum Ausdruck bringen, daß es für jedermann notwendig ist, sich selbst und seine Mitmenschen zu erkennen und sich über Charakterbeschaffenheiten seine Gedanken zu machen. Das Lebensglück und der Lebenserfolg ist weitgehend davon abhängig, ob man diese Aufgabe zufriedenstellend löst. Wie aber soll man Charakterologie studieren? Der Laie gewinnt schon einiges, wenn er gelegentlich die Texte der Fachliteratur zur Hand nimmt und deren Beschreibungen und Deutungen mit seiner eigenen Erfahrung vergleicht. Hat er einigen Über- blick in der charakterologischen Spezialdisziplin erlangt, ist es nützlich, die übrigen Gebiete der Psychologie (Tiefenpsycholo- gie, allgemeine Psychologie, Erziehungslehre, Kulturpsycholo- gie, Psychologie der Kunst, der Geschichte, der Literatur und sogar Philosophie) mit einzubeziehen. Man muß den Bogen möglichst weit spannen, um die Fülle menschlicher Wesens- merkmale >in den Griff zu bekommen«. Auch die moderne Psychosomatik, die uns Gesundheit und Krankheit viel gründ- licher hat verstehen lassen als die materialistische Medizin des 19. Jahrhunderts, ist für den Charakterforscher (Laie und Fachmann) unentbehrlich. Das Pensum ist groß, und man muß ein ganzes Leben hindurch Kraft investieren, um brauchbare Erkenntnis zu gewinnen. Aber das ist in allen Wissenschaften so und auch in der Kunst. Das Menschenleben ist so reich, bunt und vielfältig, daß es noch niemandem gelungen ist, seinen Gehalt voll und ganz »auszuschöpfen«. Am besten kommt man in diesem Studium voran, wenn man es zum Zwecke der Selbsterkenntnis und Selbsterziehung betreibt. Man soll die eigene Person und den Mitmenschen intensiv erforschen mit der Absicht, nicht nur >klug für ein nächstes Mal«, sondern »weise für immer« zu werden. Wer dieses Ziel anstrebt, wird nach und nach die Geduld, die Heiterkeit des Gemüts und die Schärfe der Selbst- und Fremdbeobachtung erwerben, ohne die man den in jedem Kopfe vorhandenen
- 32
- Wust von Vorurteilen und überlieferten Irrtümern nicht abbau- en kann. Ohne die Selbstwerdung der eigenen Persönlichkeit erschließt sich dem Forscher nicht die Vielfalt individuellen Lebens und die Subtilität unserer kulturellen Verankerung. Studium der Individuen und Studium der Kultur- und Zivilisa- tionsstrukturen müssen einander stützen und ergänzen, da man die Menschen stets aus ihrem kulturellen und epochalen Kon- text heraus verstehen soll. Das ist ein philosophisches Anliegen: Charakterkunde berührt stets den Bereich der Philosophie. >Das Leben aus ihm selbst heraus verstehen und deuten«: seit Dilthey ist dies das Pro- gramm einer »Philosophie des Lebens«, die auch zur >gelebten Philosophie« werden kann.
- 33
- Josef Rattner
- Ehrgeiz
- Im »Wörterbuch der Psychologie< von Wilhelm Hehlmann lesen wir unter dem Stichwort >Ehrgeiz<: D a s Streben, Leistungen zu vollbringen, die besonders anerkannt werden oder Ehrungen einbringen. >Gesunder< Ehrgeiz ist ein norma- les Antriebserlebnis zu eigenen Leistungen. Übertriebener Ehrgeiz ist häufig schon ein S y m p t o m dafür, daß der betreffende Mensch seine tatsächlichen oder eingebildeten Schwächen und Mängel durch über- steigerte Leistungen v o r sich und den anderen auszugleichen oder zu verdecken sucht. Bei aktiven Menschen (auch Kindern) kann er dann zu mehr oder minder rücksichtsloser Durchsetzung der eigenen Per- son führen. 1
- Man spürt aus dieser Beschreibung eine ambivalente Einstel- lung zum Ehrgeiz heraus: halb erscheint er als Tugend, halb aber auch als Laster. Offenbar gibt es verschiedene Bedeu- tungsnuancen des Wortes, die von »Schaffenskraft«, »Betäti- gungsdrang«, »Selbstwertstreben«, »Auszeichnungsverlangen« bis zu »Selbstdarstellung«, »Aggression« und »eitlem Getue« rei- chen. Um Unklarheiten zu vermeiden, ist es daher sinnvoll, zwischen »gesundem« und »pathologischem« Ehrgeiz zu unterscheiden. Für den ersteren gilt, daß er im Dienst sozialer und kultureller Zielsetzungen steht und die Selbstverwirklichung des Individu- ums auch gesellschaftlich nutzbar macht. In diesem Sinne ehr- geizige Menschen sind in allen Bereichen kultureller Leistung zu finden. Normalerweise stößt man sich nicht an ihrem Be- streben, durch Werke und Taten über ihre Mitmenschen hin- auszuragen, da früher oder später sichtbar wird, daß sie in ihrem Leben und Wirken die Interessen der Gesamtheit nicht vernachlässigen. Beispiele für diesen Ehrgeiztypus sind Goethe und Nietzsche, deren Existenz durchaus auf Größe und Genialität hin angelegt war. Goethe schrieb (als Dreißigjähriger!) an J. C. Lavater:
- 34
- Diese Begierde, die Pyramide meines Daseins, deren Basis mir angege- ben und gegründet ist, so hoch als möglich in die L u f t zu spitzen, überwiegt alles andere und läßt kaum augenblickliches Vergessen zu. Ich darf nicht säumen, ich bin schon weit in den Jahren vor, und vielleicht bricht mich das Schicksal in der Mitte und der babylonische T u r m bleibt stumpf unvollendet. Wenigstens soll man sagen, es war kühn entworfen. 1
- Und Nietzsche, der sich in einem >Tanzlied< mit dem provenza- lischen Sturmwind Mistral vergleicht, wendet sich an die "Windsbraut mit den beschwörenden Worten: - und daß ewig das Gedächtnis solchen Glücks, nimm sein Vermächtnis, nimm den Kranz hier mit hinauf! Wirf ihn höher, ferner, weiter, stürm empor die Himmelsleiter, häng ihn - an den Sternen aufP
- Wer seinen Ruhmeskranz an die Sterne heften will, darf gewiß nicht zu den Bescheidenen und Demütigen gerechnet werden. Auch Freud, Adler und Jung, die der Tiefenpsychologie näher stehen als der Dichter und der Philosoph, waren außerordent- lich ehrgeizige Menschen, die sich durch ihre Leistungen ins >Buch der Menschheit« einschreiben wollten. Wahrscheinlich geschieht in der Welt nichts Bedeutendes ohne ein Ingrediens von Ehrgeizmotivation. Der pathologische Ehrgeiz, der gewissermaßen >Ehrsucht< und »Ehrbegierde« ist, hat nicht in erster Linie »Kulturarbeit« im Sinn, sondern will seine Eitelkeit befriedigen. Sie äußert sich darin, daß der Betreffende immer und überall an die Spitze drängt, um möglichst alle Rivalen zu übertrumpfen. Wer hier- von infiziert ist, will mehr »gelten« als »schaffen«, d.h. der Oberste, der Erste und der Einflußreichste sein. Ein typisches Beispiel hierfür ist Julius Cäsar, der sich als römischer Statt- halter nach Spanien versetzen ließ. Als man ihn fragte, warum er so weit vom »Zentrum der Welt« lebe, gab er die berühmt gewordene Antwort: »Lieber in der spanischen Provinz der Erste als in Rom der Zweite!« Ahnlich mögen Diktatoren und Machthaber aller Epochen gedacht haben. Und von diesem Motiv sind auch eher durchschnittliche Charaktere beseelt, die mit allen Mitteln danach trachten, in ihrer oft winzigen Da- seinssphäre überragenden Einfluß zu gewinnen, um einem
- 35
- offenen oder geheimen Größenwahn zu genügen. Plato hat tief in das innere Getriebe der Menschenseele geschaut, als er die These aussprach: »Jeder Mensch will Herr über alle Menschen sein!« Das Streben nach Ehrung ist tief in der menschlichen Natur verankert. Dies hängt damit zusammen, daß wir uns leichter selbst respektieren können, wenn andere uns Achtung und Wertschätzung entgegenbringen. Die >gute Meinung der ande- ren« ist die Substanz unseres Selbstwertgefühls. Es bedarf er- heblicher Charakterstärke, um ohne Anerkennung von außen die Selbstbejahung aufrechtzuerhalten. Das Urteil unserer Mit- menschen berührt uns tief, und meistens sehen wir uns nicht nur mit unseren, sondern auch mit ihren Augen.
- Tiefenpsychologische Ehrgeizanalyse
- Die Tiefenpsychologie befaßt sich seit ihren Anfängen mit den Problemen des Ehrgeizes, da dieser Befund bei seelisch kranken Menschen mit erstaunlicher Regelmäßigkeit auftritt. In Neuro- se, Psychose und anderen psychischen Anomalien haben wir mit Charakteren zu tun, die allesamt bedrückende Kleinheits- und Nichtigkeitsgefühle kompensieren müssen. Seelisch kranke Patienten haben daher oft ein starkes Bedürfnis, anerkannt und beachtet zu werden: ihre Krankheitssymptome resultieren zu- mindest teilweise aus diesem Anliegen. Der Patient präsentiert sich als hilfloser und leidender Mensch, aber bei genauerem Hinsehen entdeckt man auch in seinen Krankheitsmanifestatio- nen mehr Ehrgeiz und Eitelkeit, als der Laie je ahnen würde. Alfred Adler pflegte die Neurose sogar als eine »Ehrgeizkrank- heit« zu bezeichnen. Freuds Theorien über den Ehrgeiz haben allesamt ein »biologi- sches« Fundament. Sie suchen eine »triebhafte Quelle« für ehr- süchtiges Verhalten und sehen dieses als weitgehend in der Biologie des Menschen verankert. Gemäß der Konzeption von »Phasen der Libidoentwicklung« wird in der Psychoanalyse von einem »oralen«, einem »analen«, einem »phallischen« und einem »ödipalen« Ehrgeiz gesprochen. Orale Charaktere sind unter gewissen Umständen vom Drang getrieben, gewissermaßen von der ganzen Welt Besitz zu ergreifen. Anale Charaktere zeigen dagegen eher einen ausgeprägten Perfektionismus; auch
- 36
- wenn um jeden Preis besser sein als die anderen nur mit steriler Pedanterie zu erreichen ist. Der phallische Charakter versucht durch seine körperlichen Attribute, aber auch durch Besitz und Status zu gelten. Im ödipalen Menschen schließlich finden wir Ehrgeiz als zwanghafte Rivalität mit dem Geschlecht, dem der oder die Betreffende angehören, verbunden mit ängstlich-ag- gressiver Begehrlichkeit in bezug auf das andere Geschlecht. - Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß Freud auch von einem sogenannten »urethralen Ehrgeiz« spricht. Dieser sei ein Sublimierungs- oder Reaktionsprodukt der »urethralen Erotik«, der Lust an der Blasenentleerung, die vor allem beim Mann mit einem spezifischen Machtgefühl verknüpft sei. Solche Charak- tere, die als Kinder in vielen Fällen Bettnässer waren, träumen von einem grenzenlosen »Sichverströmendürfen«: sie wollen in jeder Hinsicht frei und uneingeschränkt sein, was sie auf ihrem ehrgeizigen Weg vorantreibt. In seiner Abhandlung >Hemmungy Symptom und Angst< (GW Bd. X I V ) aus dem Jahre 1926 stellte Freud den »Kastrations- komplex« in den Mittelpunkt des gesunden und des kranken Seelenlebens. Entsprechend seiner damaligen theoretischen Po- sition behauptete er, jede Angst sei im Grunde eine »Kastra- tionsangst«. Man darf hierbei jedoch nicht nur an den mögli- chen Verlust des Genitals denken. So kann man etwa das Abstillen des Säuglings eine erste »Kastrationserfahrung« nen- nen, denn er verliert in dieser Phase den Kontakt zur mütterli- chen Brust und damit einen Teil der zärtlichen Betreuung. Psychoanalytiker behaupten auch, das Hergeben oder Aussto- ßen der Exkremente könne vom Kind als »kastrierend« empfun- den werden. Erst in der phallischen und in der ödipalen Phase wird - nachdem der biologische Unterschied zwischen Mann und Frau erkannt worden ist - die Kastrationsangst mit dem Sexualorgan in Verbindung gebracht. Im späteren Leben kön- nen auch Beschämung, Erniedrigung oder materielle Verluste den »Kastrationskomplex« konstellieren. Nunmehr erscheint der Ehrgeiz und die in ihm enthaltene Aggression als eine »Antwort« auf Kastrationserfahrungen, de- ren Wiederkehr vermieden werden soll, indem das betreffende Individuum nach Macht und Einfluß strebt. Wer fast süchtig danach ist, andere Menschen zu überragen und zu übertreffen, leidet in der Regel an demütigenden oder frustrierenden Erin- nerungen im Laufe seiner Entwicklung, die er durch seine Jagd
- 37
- nach Prestige kompensieren oder verdrängen will. Diese These von Freud ist sinnvoll und mahnt uns daran, beim Ehrgeiz- und Machttyp verborgene Inferioritätsgefühle zu vermuten, die durch >phallisches Gebaren« verdeckt werden sollen. Im Gegensatz zur Psychoanalyse bekennt sich die Individual- psychologie zu einer »soziologischen« Ehrgeiztheorie. Alfred Adler spricht in seinem Hauptwerk >Über den nervösen Cha- rakter (1912) und in allen seinen übrigen Büchern sehr ausführ- lich über den neurotischen Ehrgeiz, für ihn ein kompensatori- scher Charakterzug, der als Antwort auf lastende Minderwer- tigkeitsgefühle verstanden werden muß. Ausgangssituation in der Kindheit ist immer das Unzulänglichkeitsgefühl, das dem Menschen »angeboren« ist. Verschärft wird diese Minderwertig- keitserfahrung durch Organminderwertigkeit, verwöhnende, autoritäre oder lieblose Erziehung, durch die Hierarchie inner- halb der Geschwisterreihe, durch Außenseitersituation der Fa- milie, durch Geschlechtszugehörigkeit (z.B. Minderwertig- keitskomplex der Frau in der patriarchalischen Gesellschaft), durch Armut, permanente Verängstigung und anderes mehr. Da der Mensch Unterlegenheitspositionen schwer erträgt, rea- giert er darauf, indem er charakterliche Leitlinien ausbildet, die von unten nach oben streben. Der Schlüssel zum Charakter ist allemal das eigene Persönlichkeitsideal, das in der Regel als Ziel Geltung, Macht und Überlegenheit oder gar Gottähnlichkeit anvisiert. Menschen, die aus ausgeprägten kindlichen Minussituationen kommen, werden ehrgeizig, eitel, aggressiv und durchset- zungshungrig, da sie sich nur dann sicher fühlen, wenn sie andere beherrschen oder von sich abhängig machen können. Die Kultur mit ihrem »Heldenideal« fügt ein weiteres hinzu, um fast jedermann mit einem nervösen Hunger nach Geltung zu versehen, der ihn nie zur Ruhe kommen läßt. Korrektur kann das fiebrige Pendeln zwischen Kleinheitsgefüh- len und Größenbedürfnissen erfahren durch das Gemein- schaftsgefühl, das nach Adler die stärkste Kraft im menschli- chen Seelenleben ist. Dieses arbeitet aber nicht mit der Untrüg- lichkeit eines Instinkts, sondern bedarf der Pflege und Förde- rung durch Eltern und Erzieher. Schlägt die Erziehung in irgendeiner Weise fehl, dann entfaltet sich das kindliche Sozial- interesse nur rudimentär. Der spätere Lebenslauf ist durch vielfache Isolierungstendenzen gekennzeichnet, die letztlich auf
- 38
- Angst vor den Menschen und mangelhafte Kenntnis von deren Wesensart beruhen. Das kontaktgeschädigte Menschenkind entwickelt sich nicht zum Mitmenschen, sondern zum Gegen- menschen, der nicht darauf vorbereitet ist, die sozial struktu- rierten Aufgaben des Lebens (Arbeit, Liebe und Gemeinschaft) befriedigend oder konstruktiv zu lösen. Vor diesem Hinter- grund entstehen dann unliebsame Charakterzüge wie Ehrgeiz, Eitelkeit, Neid, Geiz, Haß, Trauer, Ängstlichkeit, Pessimis- mus und Gleichgültigkeit, die Trennwände zwischen Ich und Du oder zwischen Ich und Wir errichten. Wer nicht an die voranstrebende Gemeinschaft aller Menschen angeschlossen ist, erlebt nach Adler die Wirklichkeit als sinnlos und sinnwidrig. Es gibt keine Sinnfindung im Dasein ohne mehr oder minder ausgewogene Beziehung zur mitmenschli- chen Welt. Kämpferische Charakterzüge aller Art sind Reak- tionen auf die Lebensangst, die aus der asozialen Grundorien- tierung hervorwächst. Sehr ähnlich argumentiert Harald Schulu-Hencke (>Der ge- hemmte Mensch<, 1940), der von den drei Fundamentalantrie- ben des Habenwollens, des Geltenwollens und des Liebenwol- lens spricht (Besitz- und Geltungsstreben, Zärtlichkeit und Sexualität). Die Geltungsmotivation bezieht Schultz-Hencke in die »Aggression« ein, wobei er allerdings mit diesem Worte eigentlich die »Aktivität« (im Sinne von ad-gredi = herangehen) beschreibt. Wo die Handlungsfähigkeit eines Menschen durch unsachgemäße Erziehung blockiert oder »gehemmt« ist, entsteht Aggression im destruktiven Sinn, d.h. Feindseligkeit, Rivali- tätssucht und überspanntes Gebaren. So ist es typisch für den Ungeschickten und Unbeholfenen, daß er stets Auszeichnun- gen begehrt. Wer wirklich etwas kann oder weiß, hat es nicht nötig, fortwährend Beifall zu heischen. Pathologischer Ehrgeiz muß immer unbewußte Nichtigkeitsgefühle übertönen und ist eigentlich ein Palliativ für tieferliegende Persönlichkeitspro- bleme. Das ist auch die Meinung von Harry Stack Sullivan (·>Concep- tions of Modern Psychiatry<, 1940), der von einem »power principle« in der Entwicklungspsychologie ausgeht. Dieses be- sagt, daß jedes Kind Kompetenz, Tüchtigkeit und Geschick- lichkeit erwerben will, weil es dabei - in der Ausübung seiner natürlichen und sozialen Funktionen - Lust und Sicherheit empfindet. Wo die Entfaltung von »social skill« unterbleibt,
- 39
- kommt es zu Aggression und Machtstreben, die psychische Defizienzsymptome sind. Mit offenkundiger Übereinstimmung erklären Vertreter aller tiefenpsychologischen Schulen und Lehrmeinungen den patho- logischen Ehrgeiz als eine charakterliche oder gesamtpersön- liche Fehlentwicklung, die aus einer irgendwie »schiefen« Sozia- lisation im Kindesalter stammt. Der Persönlichkeitsaufbau sol- cher Menschen ist durch ungünstige Erziehungseinflüsse wesentlich deformiert; darum haben sie keinen festen Schwer- punkt in sich selbst und suchen fieberhaft Zustimmung bei ihrer Umwelt, wodurch sie ihr schwankendes inneres Gleichge- wicht zu stabilisieren versuchen. Da aber die soziale Einbettung und Beziehungsfähigkeit nicht richtig entwickelt worden ist, wird der Ehrgeiz regelmäßig >flankiert< von einer ganzen Reihe ängstlicher und aggressiver Charakterzüge, die im Daseinskampf entweder Vorteile ver- schaffen oder Nachteile vermeiden sollen. Wer stets und immer die Überlegenheit über andere gewinnen will, wird kaum je ohne Mißtrauen, Vorsicht, Überempfindlichkeit, Distanzver- halten und psychische Rigidität auskommen. Des weiteren wird er seine Eitelkeit kultivieren, um jeglichen Selbstzweifel zu unterdrücken, der nicht zu seinen perfektionistischen Ideal- vorstellungen paßt. Auch wird ihn unterschwellig stets die Angst vor Prestigeverlust begleiten, die sich zur allgemeinen Ängstlichkeit ausweitet: wer gegenüber seinen Mitmenschen >oben< sein will, hat allen Grund zu befürchten, daß er auf Grund widriger Umstände auch einmal nach >unten< kommen kann, was für den Ehrgeizling nichts Geringeres als die K a t a - strophe seines Lebens« bedeutet. Wir haben es somit im Seelenleben nie mit isolierten und isolierbaren Eigenschaften zu tun, sondern mit Strukturen und Ganzheiten, wobei alle Teile einen sinnvollen Komplex bilden. Wo Ehrgeiz im übersteigerten oder pathologischen Sinne vor- handen ist, da wird man nicht nur die oben geschilderten >neurotischen Eigenschaften« antreffen; gewöhnlich wird auch der >Leib< von der psychischen Pathologie affiziert. Bis in die Körperfunktionen hinein wird die ehrgeizige Lebenseinstellung wirksam werden: Nicht selten setzt sich nagendes Geltungs- streben in Gastritis, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre, Gallenbeschwerden, Schlaflosigkeit, Kopfschmerz, Kreislauf- beschwerden und ähnliche Symptome um. Fast jede psychoso-
- 40
- matische und neurotische Erkrankung enthält irgendwo einen >Ehrgeizkern<: Der Patient hat sich mit dem Leben und den Grenzen, die ihm darin gesetzt werden, nicht ausgesöhnt, wobei er Leib und Seele durch verworrene Auflehnungstenden- zen zu desorganisieren vermag. Auch die Kriminalität, die Perversionen und die Psychosen müssen unter dem Gesichts- punkt des Ehrgeizes betrachtet werden. Der psychiatrische Kranke und der Delinquent wollen anders sein als die anderen, und oft sehen sie dazu kein anderes Mittel, als eben die Perver- sion, die Delinquenz und die Psychose, in die sie ihr aufgesta- cheltes Geltungsstreben nolens volens hineintreibt. Die menschliche Gesellschaft bietet dem Kundigen ein wunder- liches Bild: jedermann will von seinen Mitmenschen geachtet, geschätzt und bewundert werden. Die Wege, die man hierzu einschlägt, sind oft recht seltsam.
- Pathologischer Ehrgeiz
- Der Ehrgeiz kann fast alle Bereiche des Lebens und des Verhal- tens betreffen: so gibt es z.B. sexuellen, religiösen, künstleri- schen, wissenschaftlichen, gesellschaftlichen, militärischen, ge- schäftlichen und noch manchen anderen Ehrgeiz. Wir geben hierzu nur einige wenige Andeutungen, i. Sowohl der männliche als auch der weibliche Don-Juanismus zeigen uns den Sexualehrgeiz in Reinkultur. Für den Don Juan ist es ein Machtkitzel, eine Frau zu erobern oder sich geneigt zu machen. Im Augenblick aber, wo er sein Opfer als gefügig erkannt hat, erlischt sein Interesse. Sein wichtigstes Ziel hat er nämlich erreicht: sich von seiner persönlichen Unwidersteh- lichkeit zu überzeugen. Er betrachtet die Gefilde der Liebe und Sexualität als Möglichkeiten des Prestigegewinns; dabei zeigt er »nebenbei«, daß er »männlicher als die anderen Männer« ist. Diesen fraglichen Ruhm verkündet auch die »Leporello-Liste«, die genau wiedergibt, wie viele Frauen in den einzelnen Län- dern »umgelegt« wurden; die Rekordleistung wurde bekanntlich in Spanien erbracht, wo es nicht weniger als »tausendunddrei« waren. Don Juan gleicht einem Indianer, der anstelle von Skalpen erlegter Feinde gebrochene Frauenherzen sammelt. Diese Sammelwut wird weder von Gefühlen noch von Moral- vorstellungen behindert. Man muß sich Don Juan als einen
- 4i
- innerlich kalten und hartherzigen Menschen denken, dem es einzig darauf ankommt, sich als attraktiven Mann zu bestäti- gen. Er ist ein typischer Repräsentant des Patriarchats, der Liebe zur Selbstglorifikation pervertiert. 2. Die religiöse Sphäre erscheint auf den ersten Blick als eine Domäne der Demut und der Innerlichkeit, aber auch sie eröff- net weite Räume für Ehrgeiz und Geltungsstreben. Da es in der Religion u.a. darum geht, die irdische Unzulänglichkeit zu überwinden, wetteifern die Frommen mit allen nur erdenkli- chen Mitteln, edler, frommer und unanfechtbarer zu sein als ihre Rivalen - auch wird kaum ein Tugendhafter der Verlok- kung entgehen können, sich darüber zu freuen, daß er besser und vornehmer ist als die Sünder, die durch Mißachtung menschlicher oder göttlicher Gebote im Vergleich zu ihm relativ schlecht abschneiden. In der Geschichte aller Konfessionen trieb das Verlangen der Gläubigen, sich vor allen anderen auszuzeichnen, mitunter sehr seltsame Blüten. Um zu demonstrieren, wie sie Herrschaft, Hunger, Sexualität, die Liebe zum Leben und die Todesangst besiegt hatten, peinigten sich viele >Helden des Glaubens« ex- zessiv, manchmal bis hin zur Selbstverstümmelung. Viele Män- ner und Frauen, die zu >Heiligen< erhoben wurden, wuschen sich nie, gingen in zerlumpten Kleidern und ernährten sich von Abfällen; noch radikalere Asketen zogen sich in die Wüste zurück, um nur noch mit ihrem Gott allein zu sein. Bußpredi- ger aller Art verkündeten oft genug den »Weltuntergang«, um ihre Menschenbrüder zur inneren Umkehr zu bewegen. Die offene und geheime Zielsetzung dieser Art von »Lebensgestal- tung« war offenbar, schon auf Erden >gottähnlich< zu werden. Man verzichtete auf Glück und »diesseitiges Leben«, um diejeni- gen zu übertrumpfen, die der Welt »hörig blieben«. 3. Seit dem Anbruch der Neuzeit änderte sich das Ehrgeizver- halten der europäischen Gesellschaft radikal: Die »Heiligkeit« wurde abgewertet, dagegen etablierte sich das Ethos von Besitz und Produktivität. Nun werden Menschen nach ihrem Geld und ihren Gütern, nach geschäftlichen und technischen Lei- stungen gewertet. Natürlich war dies in Ansätzen auch früher schon so gewesen. Aber seit dem 15. und 16. Jahrhundert wurde diese Wertorientierung vorherrschend. Sie hat, wie Max Weber meint, ihre Ursprünge in Veränderungen des religiösen Weltbildes, u.a. in der Parole von der Selbsterlösung durch
- 42
- Arbeit und beruflichen Erfolg, die von der Reformation ver- kündet wurde. Seit jenen Tagen dominiert in den gesellschaftlichen Schichten, in denen Bereicherung möglich ist, ein Wettlauf um Geld und Macht, der von einer schier unmenschlichen Hektik ist. Die kapitalistische Wirtschaftsordnung bekennt sich zu einem un- eingeschränkten Konkurrenzkampf, der den Wert des Men- schen danach bemißt, ob er seine Konkurrenten schädigen oder gar zugrunde richten kann. Es wurde ein permanenter Wirt- schaftskrieg entfesselt, der nicht nur zwischen den Individuen, sondern auch zwischen Cliquen, Völkern und Kontinenten sich austobt. Daraus erwuchs eine kompetitive Weltanschauung, die in alle Formen und Verhältnisse des gesellschaftlichen und privaten Lebens ausstrahlt: jeder will mehr haben als die ande- ren, da er nur dadurch sein Prestige glaubt aufrechterhalten und verbessern zu können. Die Anbetung von Geld, Macht und Gewalt gehört zu den Konstanten des »kollektiven Bewußt- seins«, so daß sich der einzelne ihr kaum entziehen kann. 4. Auch in Kunst und Wissenschaft ist der Geist des Wettbe- werbs ungemein lebendig. Das ist an sich noch kein Hindernis für den Fortschritt der genannten Disziplinen. Wenn der Wett- eifer mit echtem Sachinteresse verbunden ist, führt er immerhin dazu, daß Künstler und Wissenschaftler alle ihre Kräfte einset- zen, um bessere und wertvollere Resultate zu erzielen als ihre Rivalen. So kämpften etwa die Künstler der Renaissance in Italien oft leidenschaftlich um öffentliche Anerkennung, wobei jeder einzelne die Leistungen seiner Mitbewerber durch überra- gende eigene Werke und Taten zu entwerten versuchte. So entstanden Glanzstücke von einer Genialität, wie sie in einer derartigen Häufung in kaum einem anderen Zeitalter wieder gefunden werden. Oft aber ist die Jagd nach Titeln, äußerlichen Triumphen, Geld und Geltung in keiner Weise abgedeckt durch eigentliche Sach- bezogenheit. Das Glück der Inspiration und des Schaffens wird fast vollkommen ersetzt durch direkte Machtambitionen: es geht schließlich mehr um das Scheinen als das Sein. In einer Welt, die vom Urteil der Mehrheit und der Menge beherrscht wird, ist es in der Regel lukrativer, die gerade gängigen Mode- weisheiten zu verkünden, als sich der redlichen Wahrheitsfor- schung zu widmen. So hängen Künstler und Wissenschaftler ihr Mäntelchen nach dem jeweils wehenden Wind, wobei sie
- 43
- materiell, aber auch in der Hierarchie oft besser vorwärts kom- men als jene, die wirkliche Kulturwerte schaffen. Durch kon- ventionelle Leistungen wird man am ehesten zu Ruhm und Ansehen emporgetragen. 5. Noch ausgeprägter stellt sich Ehrgeizverhalten in der Politik dar: hier sind Macht und Geltung die offen eingestandenen Ziele allen Energieaufwandes. Der Politiker ist besonders stark in Gefahr, ein >Ehrgeizling< zu werden. Er muß sein Wahlvolk mit großen Gesten beeindrucken und ihm suggerieren, daß eine Art »Übermensch« vor ihm stehe, der ihm Schutz, Sicherheit und Fortschritt bieten kann. Da politische Amter oft mit sehr großen Machtbefugnissen verbunden sind, verleiten sie ihre Inhaber nicht selten zum Größenwahn; selbst der kleinste Beamte fungiert noch in seinem Bereich mitunter wie ein Miniaturherrgott, der seine »Kreaturen« mit Zepter und Insi- gnien regiert. Der Machtkampf in der Politik ist hart, und nur die Härtesten und Schlauesten können in ihm obenauf sein. Politiker gehören daher oft zu jenem Menschentypus, den Fritz Künkel als Stars und Cäsaren beschrieben hat. In Demokratien und Diktaturen spielen diese extremen Ehrgeizlinge, in denen große Ambitio- nen, Gewalttätigkeit und Menschenverachtung eine schlimme Synthese eingehen, eine verhängnisvolle Rolle. Alles drängt sie zur »Führerposition« und wenn sie diese innehaben, mißbrau- chen sie die Macht zur Selbstglorifikation. Man denke etwa an die Geschichte der autoritären Bewegungen und der Diktaturen in unserem Jahrhundert. Im Grunde waren es klägliche Gestal- ten mit tiefliegenden Defekten, die an die Spitze der Gesell- schaftspyramide gelangten. Gestützt von der Blindheit und vom Masochismus ihrer Anhänger, inszenierten sie eine De- struktion der Kultur, unter deren Folgen wir heute noch leiden. 6. Wie in der Politik kommen hierarchische Strukturen und entsprechende Ehrgeizhaltungen auch beim Militär, das seit jeher für ambitiöse Charaktere den passenden Rahmen anbot, überdurchschnittlich häufig vor. Wer in die militärische Welt einsteigt, findet sich innerhalb einer Stufenleiter von Positionen und Prärogativen, die Macht über Menschen und Dinge einräu- men. Da die unteren Ränge fast immer unter der Willkür der oberen Ränge zu leiden haben, entsteht ein permanentes Stre- ben nach Überlegenheit, sofern auch nur die minimalsten Vor-
- 44
- aussetzungen dazu vorhanden sind. Beförderungen, Titel und Auszeichnungen kultivieren die Ehrgeizmotivation im Solda- tentum, wobei die Feindschaft gegen die Menschen in anderen Ländern durch kunstvolle Indoktrination und Propaganda auf- rechterhalten wird. Wenn irgendwo, dann lebt die Ideologie des Kampfes aller gegen alle im Militarismus mit besonderer Hartnäckigkeit wei- ter. Heerführer wie Alexander der Große, Julius Cäsar, Karl der Große, Friedrich II., Napoleon, Moltke u.a.m. sind die Archetypen der militärischen Antihumanität, die durch Tradi- tion und Institution über die Generationen hinweg weitergege- ben wird. Bis zum kleinsten Gefreiten hinunter wirkt der Mythos der Menschenführung durch Macht, die dem eigenen Stolz so billige Gratifikationen ermöglicht. - Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Autoriturismus und Ehrgeiz irgendwie koexistent sind: wo der eine blüht, gedeiht auch der andere. Daher wird das pathologische Geltungsstreben nicht weniger, solange in der Gesellschaft autoritäre Lebens- und Denkformen existieren; Nationalismus, Rassismus, Militarismus, Patriar- chat, Kapitalismus, Konfessionalismus und Kommunismus sind Brutstätten des ehrgeizig-autoritären Menschentums, das den Fortbestand der Menschheit bedroht. 7. Auch der Sport züchtet ehrgeizige Einstellungen und Ge- fühlslagen. Es geht seit langem nicht mehr um »Gesundheit des Körpers als Grundlage für die gesunde Seele<, sondern um Sucht nach Rekorden, die mit allen Mitteln angestachelt wird. Wer sich in sportlichen Leistungen auszeichnen will, muß mit unerhörter Energie trainieren und fast sein gesamtes Leben in den Dienst seiner Überlegenheit in irgendeiner Sportart stellen. Athleten der verschiedensten Disziplinen werden zu »Lei- stungsmaschinen«, die auf ein Startsignal hin auf Hochtouren laufen. Die Zeitgenossen machen diesen Rummel bereitwillig mit und verwöhnen ihre Stars in der Leichtathletik, im Fußball und anderswo mit einem Ruhm, nach dem ein großer Gelehrter oder Künstler meistens vergeblich strebt. Auch gefährliche und destruktive Sportarten haben ihren Publi- kumserfolg, da sich die Masse auf der Tribüne nur allzugern mit jenen identifiziert, die unter dem Einsatz von Gesundheit und Leben etwa mit rasender Geschwindigkeit Autos über eine Rennstrecke steuern oder im Boxring einander mit Fäusten zu Boden schlagen. Solche Champions amüsieren die Menge, die
- 45
- durch >Brot und Spiele« bei guter Laune gehalten wird oder doch über die andauernde Langeweile hinwegkommt. Man muß solche sportlichen Massenveranstaltungen mit den bei ihnen entfesselten Leidenschaften gesehen haben, um die »wah- ren Helden unserer Zeit« zu kennen. 8. Und ähnlich geht es im Alltagsleben zu. Jeder mißt sich am anderen und vergleicht sich mit ihm: man will das schönere Kleid, den kostbareren Schmuck, das teurere Auto, die luxu- riösere Wohnung, die klügeren Kinder, die besseren Verwand- ten, die einflußreicheren Freunde usw. haben. Das Habenwol- len erscheint als die wichtigste Motivation des Menschen, der geradezu sein Sein danach bestimmt, wieviel er eben besitzt. Dieses Ehrgeizverhalten krankt offenbar an einer tiefliegenden Anomalie des Wertempfindens, durch welche niedere Werte wie Geld, Prestige, äußerliche Überlegenheit und gesellschaftlicher Erfolg über alles andere gestellt werden. So kommt der Ge- fühlsbereich zu kurz: das produktive Leben, die liebende An- teilnahme an Menschen, Tieren und Dingen, das Glück, die Freude und die Zufriedenheit. Die durchgehende Veräußerlichung bei allen pathologischen Ehrgeizcharakteren läßt vermuten, daß das Fehlen einer ent- wickelten Innerlichkeit das Hauptsymptom dieser Erkrankung des Selbstwerterlebens ist. Wer ein eigentliches Selbst hat, wird sich selbst nicht quantifizieren und sich auch nicht danach bemessen, ob er in diesen oder jenen Belangen immer und überall >an erster Stelle« steht. Selbstsein ist einzigartig und unvergleichlich; wahre Individualitäten können einander ken- nen und respektieren, ohne die Frage nach dem »Mehr- oder Wenigersein« aufwerfen zu müssen. Mit diesem Problem setzt sich Martin Heidegger in seinem Hauptwerk >Sein und Zeit< (1927) eindringlich auseinander. Der Philosoph unterscheidet im Rahmen seiner »Analyse des menschlichen Seins« zwischen dem sogenannten »Man-Selbst- Sein« und dem »eigentlichen Ich-Selbst-Sein«. Nach seiner Be- hauptung sind die Menschen zunächst und zumeist ihrer Kol- lektivexistenz verhaftet, so daß sie nur nach großen Anstren- gungen zum Bewußtsein ihrer selbst gelangen. Die kollektive Lebensform wird als das »Man« bezeichnet: In ihr wird jeder nivelliert und »sozialisiert«, so daß jedermann tut, denkt, fühlt und handelt, wie »man« eben zu tun, zu denken, zu fühlen und zu handeln pflegt. Das Soziale und Gesellschaftliche beherrscht
- 46
- das Menschenleben bis in alle Details hinein. Es erzeugt eine gewisse Selbstvergessenheit oder Selbstentfremdung, die teil- weise unvermeidlich ist, denn die Menschen können nur »ge- meinschaftlich funktionieren«, wenn sie sich von ihrem »Milieu« ergreifen und prägen lassen. Ein unerfreulicher Grundzug des Man-Selbst-Seins ist u. a., daß die selbstvergessenen und selbstentfremdeten Existenzen sich dauernd miteinander messen und vergleichen, einander be- kämpfen und übertrumpfen wollen, da sie so ihre innere Leere und Gehaltlosigkeit zudecken. Heidegger beschreibt den Weg der Umwandlung vom Man- Selbst-Sein zum eigentlichen Ich-Selbst-Sein und legt die Schlußfolgerung nahe, daß nur das letztere jene Seinsfülle und Seinssicherheit kennt, die eine Bejahung und Förderung des Mitmenschen zuläßt. Wer sich selbst nicht »besitzt«, wird auf Kosten anderer gelten und scheinen wollen, um dem Gefühl der eigenen Nichtigkeit zu entrinnen.
- Ehrgeiz und Neurose
- Es war eine der bedeutenden Entdeckungen Alfred Adlers, daß neurotische und andere seelische Erkrankungen durchweg von der Ehrgeizmotivation der Patienten beherrscht sind. Gewiß dominieren in den psychischen Irritationen auch Angst, Isolie- rung, soziale Ungeschicklichkeit, Hoffnungslosigkeit, Mangel an Sinnfindung und vieles andere mehr; aber alle diese Befunde sind untermalt durch den Ehrgeiz des Neurotikers, der irgend- wie aus der Menge herausragen möchte und seine Beziehungs- personen dauernd mit sich beschäftigen will. Das Bedürfnis nach Anerkennung und Beachtetwerden kann man sich bei den diesbezüglichen Fehlentwicklungen kaum stark genug vor- stellen. Schon die Kinderfehler weisen diese Eigentümlichkeit auf. Das Kind, das infolge erzieherischer Unbeholfenheit in Sackgassen der Entwicklung geraten ist, verlegt sich auf Funktionsanoma- lien, mit denen es den Gang des Familienlebens behindert und sich auffällig macht. Bettnässen, Stottern, Daumenlutschen, nächtliches Aufschreien, Eßschwierigkeiten, Trotz, Angst, Streitsucht, Schulversagen usw. sind Revolten, die aus kindli- cher Unsicherheit und dem daraus folgenden Eigensinn ent-
- 47
- springen. Wo ein Kind diese oder andere Symptome mobili- siert, rückt es unwillkürlich in den Mittelpunkt des familiären Interesses und wird sozial entlastet, ein Vorgang, den die Psychoanalyse als sekundären Krankheitsgewinn beschreibt. In der Schule ist es dem mangelhaft sozialisierten Kind unmög- lich, sich durch Leistungen hervorzutun; bei geeigneter Dispo- sition oder Anregung durch die Umgebung werden dann Cha- rakterzüge wie Faulheit, schlechte Manieren, Unpünktlichkeit, Schwatzen im Unterricht, Unaufmerksamkeit usw. dazu einge- setzt, den Ablauf der Schulstunden zu stören und den Lehrer hauptamtlich mit dem Störenfried zu beschäftigen. Man ragt aus der Schulklasse heraus, wenn man nicht mitmacht und den Lehrer durch Trotz oder Nachlässigkeit schier auf allen Ebenen scheitern läßt. Der schlimmste Ehrgeizling einer Schulklasse ist nicht der »Musterschüler«, sondern der notorische Faulpelz und Störenfried, der die Arbeit des Klassenverbands sabotiert. Die Neurose ist - im Gegensatz zur Verwahrlosung und zum Verbrechen - eine passive Auflehnung gegen die Umwelt. Da- her liegt es eher in der neurotischen Leitlinie, durch Ängste, Krankheitssymptome, Trauer und Demonstration von Unfä- higkeit die Hilfe der Erwachsenen in Anspruch zu nehmen. Die dabei entwickelte Symptomatik hat einen hohen Stellen- wert im Seelenleben des Patienten - er kreist in Gedanken oft um sie, sie ist beinahe sein Lebensinhalt. Hört man diese Menschen über ihre Störungen und Ausfallerscheinungen re- den, dann bekommt man den Eindruck, daß sie immer auch ein bißchen stolz darauf sind: hat ihnen doch die Krankheit als Schutz vor den Anforderungen des Lebens gedient und hebt sie insofern vom sozialen Hintergrund ab, als sie eben »anders sind als die anderen«. Auch durch Angst, Leiden und Traurigsein kann man sich einer »Elite« zugehörig fühlen - man ist nicht so robust wie das »einfache Volk« und bedarf dauernd der Scho- nung. Man achte etwa darauf, mit welchem Respekt und mit welch gedämpfter Stimme die Angehörigen eines neurotischen Men- schen von dessen Leidenszuständen sprechen. So wird darauf hingewiesen, daß Frau X eine Depression hat und daher mit Glacehandschuhen anzufassen ist; wenn Frau Y ihre Migräne hat, dann muß die Familie auf Zehenspitzen durch die Woh- nung gehen, und selbst dann sind alle diese Rohlinge zu laut für das arme, kränkelnde Geschöpf, das an einer geheimnisvollen
- 48
- Verkrampfung der Blutgefäße im Kopf leidet. Oder man denke an die Brutalität der Gattin von Herrn Z, die es gewagt hat, ihren Gatten zum Einkaufen zu schicken, wiewohl er habituell von Platzangst befallen wird. Natürlich hat dieser unglückseli- ge Mensch auf den belebten Straßen und Plätzen sofort seine Agoraphobie bekommen, die ihn nach Hause eilen ließ. Herrn Z's bedenkenlose Ehefrau hat nun genug damit zu tun, diesen Anfall zu beheben, Medikamente zu besorgen und Trost für den armen Kranken zu spenden, der immerhin den >guten Willen« aufbrachte einzukaufen, aber leider an der Aktivität seines Unbewußten scheiterte. In der halbwegs humanen Gesellschaft hat der Patient An- spruch auf Schonung und Zuvorkommenheit aller Art. Für viele Charaktere >zahlt es sich aus«, ein psychisches oder psy- chosomatisches Leiden zu haben. Würden wir diese Dynamik etwas mehr durchschauen, dann könnten wir immer noch rücksichtsvoll gegen Leidende aller Art sein, aber ihren >Krank- heitsgewinn« wesentlich verringern. Dies würde die Heilung beschleunigen, oft sogar überhaupt erst ermöglichen. Der Neurotiker ist - nach Adler - ein Ehrgeiziger auf dem Rückzug vor der Front des Lebens. Da er ungenügend darauf vorbereitet ist, die sozialen Fragen des Lebens - Arbeit, Liebe und Gemeinschaft - zu lösen, muß er zu Ausweichtaktiken greifen und nach rückwärts gehen. Man findet ihn selten vorn in den Kampflinien, dafür um so eher im geschützten Raum der Familie, die er mit seiner Symptomatik dauernd in Spannung hält. Die Intensität des neurotischen Ehrgeizes wird sichtbar an »begleitenden Charakterzügen«, die oft deutlicher ans Licht treten als das Geltungsstreben selbst. So kommt es zur Ausbil- dung von distanzierend-kämpferischen Eigenschaften wie etwa Mißtrauen, Kontaktscheu, Vorsicht, Eigensinn, Aberglaube, Überempfindlichkeit, Angstsymptomen, Zornausbrüchen, Launen, Idiosynkrasien. Man kann auch die Faustregel aufstel- len, daß bei jeder Ehrgeizhaltung mit Gewißheit Züge des Neids, des Geizes, der Eifersucht, der Eitelkeit und der Ängstlichkeit auftreten. Allerdings sind diese Mechanismen nicht immer sofort zu erkennen. Man muß sich gewissermaßen in das geheime Phantasieleben des Patienten versetzen, um seine sozial unadäquaten Reaktionen verstehen zu können. In seinen Phantasien ist er der >Ausnahmemensch«, der fast überall
- 49
- Widersacher und Unverständige um sich hat. Er leidet an der Welt, die ihn nicht in seinem Sinn gelten läßt. Daraus resultiert seine Kampfstimmung, und es ist nicht abwegig, bei jeder Neurose oder psychosomatischen Erkrankung zu fragen, gegen wen der Patient so krank ist. Denn aus freundlichen und wohlwollenden Gefühlen ist nie- mand imstande, eine Neurose aufzubauen. Eine Kampfstim- mung gegen die Umwelt dagegen zementiert neurotische Verhaltensstrukturen, in denen echte Mitmenschlichkeit sich niemals durchsetzen kann. Adler beobachtete auch bei den meisten seelisch kranken Menschen eine typische Entwertungs- tendenz, die jedoch nur umwegig und verhüllt geäußert wird. Aber der ehrgeizige Neurotiker ist kaum je bereit, Menschen und Verhältnisse in ihrem Eigenwert zu taxieren und anzuer- kennen: Er mißt alles daran, ob es seinem Sicherheits- oder Auszeichnungsverlangen dienlich ist. Kam etwa ein Ehrgeiziger bei einer Zusammenkunft von Menschen nicht genügend zur Geltung, dann wird er behaupten, daß die Leute langweilig und oberflächlich waren. Versteht er ein Buch nicht auf den ersten Anhieb, dann ist es natürlich ein schlechtes Buch und sein Verfasser ein Schaumschläger und Scharlatan. In ähnlicher Wei- se kann man Studium, Beruf, Frauen, Männer, Intellektualität, kulturelle Interessen usw. abwerten, mit dem offenen oder geheimen Ziel, sich selbst aufzuwerten. Dieses Verhalten behindert die Entwicklung des neurotischen Menschen sehr. Wäre er nicht Opfer seines Ehrgeizes, dann könnte er wohl nach und nach alle seine Lebensschwierigkeiten überwinden, die ihm so sehr zu schaffen machen. Ginge er seine Probleme jedoch an, wäre er mit seinen Ängsten, Unbe- holfenheiten, Schwächen und Kleinheitsgefühlen konfrontiert: er müßte dazu stehen, daß er ein >Anfänger< ist. Vor dieser Erfahrung scheut der hochmütig-ängstliche Patient zurück, weshalb er in seiner Entwicklungshemmung verharrt. Da die Patienten in der Psychotherapie meistens im Stadium ihrer Entmutigung oder ihres Zusammenbruchs erscheinen, kann der Irrtum entstehen, man müßte sie lediglich ermutigen und ins Leben zurückführen. Diese Optik erweist sich aber in der Regel als kurzsichtig. Ermutigung ist immer nützlich und bildet ein Kernstück jeder psychotherapeutischen Behandlung. Sie soll aber stets ergänzt werden durch die Entmutigung beziehungsweise Korrektur des neurotischen Gottähnlichkeits-
- strebens, an dem die Therapie oft genug scheitert. Der Patient muß in die Wirklichkeit zurückgeführt werden und sich mit den Bedingungen, unter denen er lebt, aussöhnen. Er muß seine Mitmenschen als gleichwertige und gleichberechtigte Partner annehmen, die nicht nur dazu da sind, auf seine Neuro- se Rücksicht zu nehmen. Das Leben ist hart für alle, und es ist keine richtige Antwort auf diese allgemein bestehenden Schwie- rigkeiten, wenn man für sich eine Ausnahmeposition bean- sprucht. Der ehrgeizige Neurotiker kann es mitunter nicht ertragen, von seinem Analytiker abhängig zu sein und von diesem Rat und Hilfe zu empfangen. Dies verzögert in vielen Fällen die Hei- lung, da auch ein Machtkampf in der Therapie entbrennt. Diesen Verwicklungen und Verstrickungen auszuweichen, ist hohe Kunst der seelenärztlichen Behandlung. Läßt man sich in Kämpfe mit dem Patienten ein, dann wird die Heilungsarbeit rasch vergessen. Ist auch der Analytiker ein Ehrgeizling, dann entsteht die tragikomische Situation, daß er zum Zwecke seiner Selbstbestätigung den Patienten heilen will, dieser aber aus derselben Motivation heraus die Heilung blockiert! Am ehesten gelingt die Psychotherapie, wenn der Psychothera- peut eine in sich ruhende, gefestigte und reife Persönlichkeit ist, die Machtkämpfe mit dem Analysanden tunlichst vermeidet und auch nicht Therapie betreibt, um vor den Patienten als der >große Heiler« dazustehen. Es ist schon viel wert, wenn der Analytiker versucht, saubere und sorgfältige Arbeit zu leisten, d.h., wenn er sich ganz in den Dienst der Selbsterforschung seines Schützlings stellt und zu dessen Selbsterkenntnis und Selbsterziehung beiträgt und dabei die kritische Betrachtung seines Ichs nicht außer acht läßt. Auch muß er darauf achten, daß ihm sein Privatleben, seine wissenschaftlichen und anderen kulturellen Neigungen ein möglichst großes Ausmaß von Freu- de und Selbstverwirklichung ermöglichen, so daß er nicht fiebrig auf Lob und Anerkennung von seiten des Patienten warten muß. Spürt dieser nämlich die innere Schwäche und den Hunger nach Anerkennung bei seinem Therapeuten, beginnt er in der Regel, diesen zu »behandeln«, anstatt sich von ihm »behandeln zu lassen« - nicht wenige Psychotherapien enden damit, daß der Analysand seinen Analytiker manipuliert und manövriert, bis diesem Hören und Sehen vergehen. Eine schlichte, warmherzige, sachbezogene Forscherhaltung ist
- 5i
- die beste Grundbedingung für eine erfolgreiche Therapie. Der Therapeut soll in seinem Verhalten Sinn für die Realität und die Gemeinschaft wecken, die der Patient mißachtet oder nicht ausreichend kennengelernt hat. So kann er einen ängstlich- ehrgeizigen Charakter umerziehen in Richtung auf Koopera- tion, Lebensmut und echtes Wertbewußtsein. Parallel zur Therapie muß auch eine weltanschauliche Wand- lung des Patienten angebahnt werden, denn das Weltbild des Neurotikers ist fast regelmäßig von Ehrgeiz geprägt, der seiner Heilung im Wege steht. Von Kindheit an haben solche Men- schen gelernt, daß das Leben eine vertikale Struktur hat: man muß oben sein, wenn man nicht unten sein will. In ihrem Gemüt wimmelt es von autoritären Imperativen, die die zwi- schenmenschliche Solidarität blockieren. So heißt es etwa bei näherem Zusehen: >Jeder ist sich selbst der Nächste!« Oder: >Das Leben ist ein Kampf aller gegen alle!« Oder: >Wer nicht Hammer ist, ist nur Amboß!« Oder: >Der Starke ist am mäch- tigsten allein!« Oder: >Hilfe annehmen heißt abhängig werden!« Oder: >Wenn ich ein Durchschnittsmensch wäre, wären meine Probleme leicht lösbar!« Die Verlockung, sich mit dem Schein zufriedenzugeben, ist für jedermann groß, da das Sein beschwerlich und mühsam ist. In einer Welt und Kultur, wo Eindruckmachen wichtiger ist als Echtheit, kann sich kaum einer dem allgemeinen Rummel auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten entziehen. Daher wird man wahrscheinlich keinen einzigen Menschen finden können, der von dem geschilderten neurotischen Ehrgeiz gänzlich frei ist. Wir kranken alle an jener Selbstentfremdung, die uns veräußer- licht und inneres Wachstum und gesamtseelische Entwicklung vernachlässigt. Da wir das Reifen und Werden nicht gelernt haben, wollen wir scheinen und gelten und in den Augen der anderen ein Popanz sein.
- Uberwindung des Ehrgeizes
- »Leichter findet man««, sagt der grimmige Menschenbeurteiler Larochefoucauld, »von der Liebe zum Ehrgeiz als vom Ehrgeiz zurück zur Liebe.« In diesem pessimistischen Urteil ist die Einsicht enthalten, daß Macht- und Geltungsstreben sich im- mer auf Kosten der Liebesfähigkeit ausbreiten: man kann nicht
- 52
- gleichzeitig der Selbstglorifikation und dem >Gotte Eros< huldi- gen. Wenn man sich fragt, wie man den Ehrgeiz überwinden soll, fragt man im Grunde auch, wie man Liebe und Verständ- nis erlernen kann. Der Antagonismus von >Eros< und pathologischem Ehrgeiz reicht viel weiter, als man zunächst annehmen möchte. Ge- nauere Beobachtung ehrgeiziger Menschen lehrt, daß sie - die sich ständig auf der Jagd nach Erfolgen und Triumphen befin- den - nicht nur wenig Fremdliebe empfinden, sondern auch wenig Selbstliebe. Das erstaunt den Tiefenpsychologen nicht, denn er weiß, daß die Einstellungen zum Du und zum Ich oft genug dieselbe >Färbung< oder >Tendenz< aufweisen. So kommt es zum einheitlichen Phänomen etwa des aggressiven Lebens- s t i l s wobei der kämpferische Mensch nicht nur seine Mitmen- schen, sondern auch sich selbst bekämpft. Fremdaggression und Autoaggression laufen weithin parallel. Wer fortwährend andere überrunden und überwinden will, wird meistens hart gegen sich selbst sein und sich stets neue Bestleistungen abfor- dern. Daher findet man in der Seele der Ehrsüchtigen stets zumindest tiefe Unzufriedenheit mit sich selbst, wenn nicht gar Selbstbaß. Er gehört zum Typ, von dem Kierkegaard sagt, er >wolle verzweifelt nicht er selbst sein<. Dies zeigt sich auch im Verhältnis des Ehrgeizigen zu seinem Körper, zu dem er meist nur eine instrumentale Beziehung< hat: Er hält ihn allenfalls fit und funktionstauglich, damit er ihn als verläßliches Werkzeug in seinem Daseinskampf einsetzen kann. Weniger vertraut ist ihm der eigene Körper in Gestalt des >Liebesleibs<, d.h. als Organ der sexuellen und liebenden Hin- gabe (die weit über die Mann-Frau-Beziehung hinausreicht). Der Leib ist nicht nur ein Instrument für den geschäftlichen und sonstigen Wettbewerb - er ist die Basis und das Zentrum unserer >kreatürlichen Existenz<. Aus dem lebendigen Leib steigen unsere Gefühle, unsere Hoffnungen, unsere Phantasien und die Erkenntnis unserer Möglichkeiten auf; nur durch Nähe zu unserer Leiblichkeit gewinnen wir die Dimension des Frei- seins, die mit Freude, Glück und Schaffenskraft verbunden ist. Ehrgeizige, eitle und rivalisierende Charaktere sind nicht nur innerlich unfrei, sondern auch ihrer >Kreatürlichkeit< entfrem- det, d.h. partiell >leblos< oder vitalitätsgeschwächt. Daher be- nötigen sie so dringend den >Blick der anderen-:: werden sie
- 53
- genügend beachtet, wird ihnen gleichsam von außen etwas Schwung und Spontaneität eingeflößt. Wo das Eigenleben im Menschen verstummt oder versickert, greift er süchtig nach der Zustimmung der anderen, um sich über die innere Verarmung hinwegzutrösten. »Das Glück«, sagt Chamfort im 18. Jahrhundert, »ist eine komplizierte Sache: man findet es schwer bei sich selbst und kaum je bei den anderen.« Jeder Ehrgeizling muß lernen, daß er einem Phantom nachjagt, wenn ihm fremde Zustimmung die Selbstzufriedenheit, die Liebe zum eigenen Leib und die Mühe der Selbstverwirklichung ersetzen soll. Selbstachtung und wahrer Stolz sind gute Heilmittel gegen den Ehrgeiz, der im gewissen Sinne eine kindische Demütigung vor jenen beinhaltet, die einem Lob und Anerkennung spenden sollen. Daher haben die Seelenkundigen aller Zeiten betont, daß Ehrgeizige und Eitle eigentlich Kinder sind und bleiben und nie wirkliche Reife erlangen. Es braucht eine schöne Portion Naivität, um sich am Strohfeuer des Ruhmes erwärmen zu wollen. La Bruyere sagt: D e r Ehrgeiz selbst heilt den Weisen v o m Ehrgeiz: Er strebt nach so hohen Dingen, daß er sich nicht auf das beschränken kann, was man Schätze, V e r m ö g e n und G u n s t nennt. Er sieht in so schwachen V o r z ü g e n nichts, was gut und beständig genug wäre, sein H e r z damit auszufüllen und seiner Sorgen und Wünsche wert zu sein; er muß sich sogar M ü h e geben, sie nicht allzusehr zu mißachten. Das einzige G u t , das ihn in Versuchung zu führen vermag, ist jener R u h m , der aus ganz reiner und einfacher Tugend entspringt - aber die Menschen gewähren diesen nicht gern, und so verzichtet er darauf. 4
- Noch deutlicher bezeichnet den wunden Punkt des Ehrgeizes Nietzsche, der im >Zarathustra< von den »Krämpfen der Ehrgeizi- gen« spricht. An anderen Stellen beobachtete der Philosoph den Zusammenhang von Ehrgeiz und Gewissenlosigkeit: Wer über die anderen hinausstreben will, kann sein Moralempfinden nicht voll entwickeln. Des weiteren war sich Nietzsche darüber im klaren, daß der Ehrgeizige vor allem sein Machtstreben pflegt - nach Adler tut er dies aus starken Ohnmachtsgefühlen heraus, die aus der Selbstvergessenheit und dem Sinnmanko, respektive aus der Beziehungslosigkeit zum eigenen Leib stammen. So wird man den Ehrgeizigen dazu anleiten müssen, eine gewisse >Lebensfreundlichkeit< zu erwerben. Er soll sich selbst
- 54
- so akzeptieren, wie er ist - was ein weiteres Streben nach Entwicklung und Entfaltung keineswegs ausschließt. Auch muß er die verstiegenen Maßstäbe und Anforderungen an sich selbst relativieren, die unter dem Druck seiner Erziehung und seiner sozialen Erfahrung entstanden sind. Die antike Tugend des >Maßhaltens< ist für ihn ein wichtiges Lernpensum; sie ist auch ein Ingrediens der Weisheit, einer Eigenschaft, die man bei Opfern unseres Rivalitäts- und Wettbewerbsdenkens kaum je antrifft. Gelingt es dem ehrgeizigen Menschen, seine zwischenmensch- lichen und erotischen Beziehungen wesentlich zu verbessern, dann eröffnet sich ihm der Ausblick auf ein Leben in der und für die Gemeinschaft. Man kann sich eine Lebenseinstellung erarbeiten, wonach all unser Tun und Streben wohl der Ich- expansion dient, zugleich aber auch die Interessen der Kultur und der Menschheit mitberücksichtigt. Wahrscheinlich ist dies die vernünftigste Lösung für unsere Probleme: wir müssen akzeptieren, daß unser eigener Fortschritt unlöslich mit dem Fortschritt der anderen verbunden ist. Wer so denkt und fühlt, wird mit der Zeit lernen, einen Großteil des persönlichen Ehrgeizes zu überwinden. Er wird auch dadurch lebensklüger, liebesfähiger, produktiver und weltoffener. Die Ruhe des Ge- müts, die innere Gelassenheit und die Freude am Dasein sind am ehesten zu finden, wenn man sich als ein verantwortliches »Instrument der sozialen Entwicklung« begreift. Wer aber nur oder überwiegend die eigene Person im Auge behält, wird früher oder später im Leben scheitern. Das klassische Porträt eines unglücklichen Ehrgeizigen schuf Stendhal in seinem Roman >Rot und Schwarza aus dem Jahre 1830. Julien Sorel entstammt bürgerlichen Verhältnissen und leidet als Kind unter der überstarken Vaterfigur und der Über- legenheit seiner Brüder. Er entwickelt einen >Inferioritätskom- plex< und will aus der Enge seiner Verhältnisse ausbrechen. Er wird Erzieher im Hause des Herrn de Renal und ruht nicht, bis er die Gattin des Präfekten in sich verliebt gemacht hat. In seinem leidenschaftlichen Wunsch, die oberen Stufen der ge- sellschaftlichen Leiter zu erklimmen, wägt er ab, auf welchem Wege ihm dies am leichtesten gelingen könne: soll er die schwarze Robe des Priesters oder das rote Kleid des Soldaten anziehen? Er entscheidet sich zunächst für den Talar. Aber die priesterliche Karriere erfüllt seine hochgespannten Erwartun-
- 55
- gen nicht. Daher beginnt er ein leidenschaftliches Intermezzo mit dem aristokratischen Fräulein Mathilde de la Mole, die, wie er selbst, außerordentlich ehrgeizig ist. Die beiden stolzen Naturen können keinen Modus für eine Übereinstimmung finden, weshalb sich die Beziehung nach und nach auflöst. Julien sieht seine Pläne zum sozialen Aufstieg blockiert und entschließt sich wahnhaft zum Mord an der ehemaligen Gelieb- ten Frau von Renal, den er in einer Kirche auch wirklich in die Tat umsetzt. Er endet als Verbrecher auf dem Schafott, und erst in seinen letzten Tagen sieht er ein, daß er an der Liebe vorbeigelebt hat, weil er nur von seinem Machtwillen bestimmt war. Stendhals Seelenanalyse nimmt die Tiefenpsychologie in vielen Punkten vorweg.
- Roswitha Neiß
- Eitelkeit
- Der Charakterzug der Eitelkeit ist von Moralisten aller Zeiten und Zonen beklagt, kritisiert und angeprangert worden. Die religiöse Moral bezeichnet dieses Wesensmerkmal ganz ent- schieden als »Laster«. In Tragödien und Komödien beschreiben die Dichter allerlei Kalamitäten als Resultat übertriebener Eitel- keit. Auch die Psychologen fühlten sich herausgefordert, dieser ubiquitären menschlichen Eigenschaft auf den Grund zu gehen. Vor allem die Tiefenpsychologie lieferte wertvolle Beiträge zur Entstehungsgeschichte und Struktureigentümlichkeit eitler Charaktere. Allerdings läßt sich nicht behaupten, daß es hin- sichtlich dieses Problems keine »dunklen Stellen« mehr gibt: die moderne Charakterologie steht noch in ihren Anfängen, und es bleibt Raum genug für vielfältige Forschungen. Die Lateiner sprachen von >vanitas<, welches übersetzt werden kann als: eitles Wesen, Nichtigkeit, Schein, Lüge, Prahlerei. Auch das deutsche Wort >eitel< weist auf Leere und Einbildung hin. Der allgemeine Sprachgebrauch bezeichnet als eitlen Men- schen einen, dessen banale Durchschnittlichkeit im Wider- spruch zu seiner aufgeblähten Selbsteinschätzung steht. Defi- niert man es so, dann wird man zugeben müssen, daß jeder- mann eine Spur von Eitelkeit besitzt: denn Kontraste zwischen Selbstbeurteilung und wirklichem Wert muß man gewiß nicht nur bei notorischen Wichtigtuern suchen. Schlägt man die >Maximen< des La Rochefoucauld (1613-1680) auf, findet man auf fast allen Seiten dieses klugen Büchleins scharfsinnige Polemik gegen die menschliche Eitelkeit; wir greifen aus dieser Fülle nur einige Beispiele heraus: Die Eigenliebe ist der Schmeichlerinnen beste. - Wendiger als der gewandteste Weltmann ist die Eigenliebe. - Trügen wir den H o c h m u t nicht in der eigenen Brust, wir beklagten uns kaum über jenen des Nächsten. - D e r H o c h m u t ist allen Menschen mit gleichem Maße zugeteilt; verschieden aber sind die Mittel und die Art, ihn sehen zu
- 57
- lassen. - Sich augenfällig nie zu zieren, ist auch eine A r t von Zie- rerei. 1 Schopenhauer und Nietzsche, die manches ähnlich empfanden wie die französischen Moralisten, geißelten in ihrer Weise die Eitelkeit, die für sie gleichfalls im Mittelpunkt der menschli- chen Untugenden stand. Schopenhauer teilt in >Parerga und Paralipomena< (1851) die Grundwerte des Lebens in die bekann- te Trias ein: 1. Was einer hat; 2. was einer vorstellt; 3. was einer ist. Besitz jeglicher Art und Reputation bei den Mitmenschen werden hierbei als zweitklassige Werte eingestuft; wahrhaft zählt eigentlich nur, was ein Mensch ist und was ihm kein anderer oder das Schicksal nehmen kann. Der Eitle versteift sich allzusehr auf seine Habe, auf Anerkennung äußerlicher Eigenschaften. Der Weise hingegen achtet auf seine inneren Qualitäten, die ihm allein maßgeblich erscheinen. Je geringer die innere Substanz eines Menschen ist, um so mehr verfällt er reiner Äußerlichkeit: Schopenhauer würde durchaus beim eit- len Menschen von >Selbstentfremdung< sprechen. Nicht anders dachte Nietzsche, dessen Aphorismen über die Eitelkeit so zahlreich sind, daß das >Nietzsche-Register< von Richard Oehler mindestens fünfzig wichtige Textstellen ver- zeichnet, in denen sich der Philosoph zu diesem Charakterzug geäußert hat. Auch hier nur einige fragmentarische Hin- weise: Eitelkeit ist die N e i g u n g , sich als Individuum zu geben, während man keines ist. - Wir legen mehr Wert auf die Befriedigung der Eitelkeit als auf alles übrige Wohlbefinden. - Das unbesiegbarste Ding ist die menschliche Eitelkeit. - Eitelkeit ist die Furcht, original zu erscheinen, also ein Mangel an Stolz, aber nicht notwendig ein Mangel an Origina- lität. - Die Eitlen. Wir sind wie Schauläden, in denen wir selber unsere angeblichen Eigenschaften, welche andere uns zusprechen, fortwäh- rend anordnen, verdecken oder ins Licht stellen, - um uns zu betrü- gen. - Verletzte Eitelkeit ist die Mutter aller Trauerspiele. 2
- So könnte man endlos fortfahren. Für unsere Zwecke mag es jedoch ausreichen, auf die lange und ruhmreiche Tradition der philosophischen Ethik zu verweisen, in der Eitelkeit und Ei- genliebe als Defizitverhalten den echten Tugenden der Liebe und Bescheidenheit entgegengestellt wurden. Kein Zweifel: der Charakterzug der Eitelkeit ist pathologisch, und die Vermu- tung liegt nahe, daß er bei Neurosen, Perversionen und Psy- chosen irgendwo im verborgenen zwar, aber dennoch ent-
- 58
- scheidend mitwirkt. Tatsächlich lehrt uns die psychotherapeu- tische Erfahrung, daß auch die kleinmütigen, selbstanklagen- den, selbstquälerischen Patienten des Seelenarztes oft eine Überempfindlichkeit und einen Größenanspruch hervorkehren, den man zunächst bei ihnen nicht erwartet hätte. Alfred Adler antwortete einmal auf die Frage, ob er das Wesen der Neurose mit einem einzigen Wort charakterisieren könnte, lakonisch: »Neurose ist Eitelkeit!«
- Tiefenpsychologie der Eitelkeit
- Aber wie nähert man sich dem Thema »Eitelkeit« tiefenpsycho- logisch? Für Freud war dieser Charakterzug offensichtlich mit einem Partialtrieb der Libido verknüpft. Er sprach von der »phallischen Phase« der kindlichen Libidoorganisation, wenn er den Ursprung der eitlen Verhaltensweisen verdeutlichen woll- te. In dieser Phase werde den Kindern beiderlei Geschlechts das Phänomen des Männlich- oder Weiblichseins transparent. Der kleine Knabe sei stolz auf sein Genitale und fühle sich über das Mädchen erhaben. Dieses wiederum fühle sich arg benachtei- ligt, weil ihr der Penis fehle, woraus wiederum die dem weibli- chen Geschlechtscharakter zugehörigen Minderwertigkeitsge- fühle entstünden. Bei jedem Mädchen der sogenannten Kultur- völker finde man bewußten oder unbewußten Penisneid, aus dem Charaktereigenschaften wie Kleinmut und Überheblich- keit, aber auch Symptome wie Frigidität und lesbische Neigun- gen entspringen können. Wenn sich nach der Pubertät weibli- che Reize (Brust usw.) entwickeln, richte sich »beim Weibe« (wie Freud sich auszudrücken pflegte) der Narzißmus auf diese äußerlichen Körpermerkmale, die für die frühen Minderwertig- keitskomplexe entschädigen. Immer aber finde man bei den Frauen die Trias der Wesenseigentümlichkeiten: Narzißmus, Masochismus und Infantilismus. Schon von der Biologie her neige die Frau zur Eitelkeit. Zur phallischen Phase gehören die beiden Partialtriebregungen des Exhibitionismus und des Voyeurismus, die gleichzeitig auftreten und sich im wesentlichen kompensatorisch zueinan- der verhalten. Populär gesprochen, handelt es sich um Tenden- zen der Selbstdarstellung und des »Sehenwollens«, was sich im Sinne Freuds hauptsächlich auf sexuelle Fakten bezieht. So
- 59
- wollen Kinder dieser Altersstufe (3. bis 5. Jahr) ihre Sexualor- gane (ihre Nacktheit) gern zeigen und beim anderen Geschlecht die entsprechenden Körpermerkmale wahrnehmen. Dieser Ab- sicht dienen unter anderem die Doktorspiele. Beim Urinieren erlebe der Knabe ein Macht-, das Mädchen aber ein Ohnmacht- gefühl: der Penis erlaubt ein souveränes >Lenken des Harn- strahls<, indes die weibliche Urethra nur ein >passives Rinnen- lassem gestattet. Dies beeinflusse zutiefst das Lebensgefühl der beiden Geschlechter: beim Mann entstehe eine >manipulative Beziehung zum eigenen Körper< und ähnlich auch zur Umwelt, indes die Frau eher Gefangene ihres Organismus bleibe. So entstehe die »geringere Kultureignung des Weibes<, das sich kaum je so intensiv für kulturelle Ambitionen engagiert wie der Mann. Um so stärker träten bei den Frauen Regungen der passiven Selbstdarstellung hervor, d. h. Zeigen der körperlichen Schönheit, der sekundären Geschlechtsmerkmale (Brüste), wo- von die Mode - die Enthüllen und Verbergen zugleich beinhal- tet - regen und auch die Männer faszinierend Gebrauch mache. So könne man den Exhibitionismus eine spezifisch weibliche Eigenschaft nennen; Männer aber, die exhibitionieren, werden stets weiblich anmuten. Nach Freud ist Eitelkeit etwas ausge- sprochen Infantiles und Feminines; wer zum >Mann< heranreift, hat nur wenig daran teil. Diese vom Ungeist des Patriarchats angekränkelte Theorie wurde von weiblichen Psychoanalytikerinnen teilweise blind- gläubig übernommen (z.B. von Helene Deutsch); andere wie- der (z.B. Karen Horney) setzten hier mit ihrer Skepsis gegen- über der orthodox-psychoanalytischen Theorie an und entwik- kelten neue kulturpsychologische Aspekte. Horney, Fromm u. a. waren der Meinung, daß der Penisstolz des Knaben keine zwangsläufige biologische Gegebenheit sei, sondern künstlich durch die Vorrechte des Mannes in der patriarchalischen Ge- sellschaft anerzogen werde. Ahnlich komme es beim Mädchen zum Gefühl eines tiefsitzenden Mankos nicht auf Grund eines Organmangels. Vielmehr spiele hierfür die Einsicht in die Mißlichkeiten der Frauenrolle, die schicksalhaft den späteren Lebensweg strukturieren, eine entscheidende Rolle. Gäbe es eine echte Gleichberechtigung von Mann und Frau innerhalb der Kultur, dann wäre vermutlich der >Kampf der Geschlech- ter« schnell am Ende, und viele Neurosen, die der unterschiedli-
- 60
- chen Bewertung von Männern und Frauen entspringen, wür- den unweigerlich hinfällig. Darum sprach Alfred Adler von einem spezifisch »weiblichen Minderwertigkeitsgefühl«, welches er allein auf erzieherische und gesellschaftliche Ursachen zurückführt. Die Frau hat es unter den gegebenen Umständen schwerer als der Mann, eine ausreichende Selbstachtung zu gewinnen. Sie wird von vorn- herein in die Rolle des »anderen Geschlechts« (Simone de Beauvoir) gedrängt. Sie dient als negatives Gegenbild, an wel- chem sich die Männer zu positiven »Lichtgestalten« hinaufstili- sieren. Die Einschätzung der Frau im Patriarchat ist ein Krebs- übel der bisherigen Unkultur. Folgt man späteren Analytikern (z.B. Erik H. Erikson), dann ist der Sinn der phallischen Phase nicht so sehr das Bewußtsein von Besitz oder Nichtbesitz eines Penis, sondern eher der Erwerb eines instrumentalen Umweltverhaltens, d.h. ein Erler- nen sozialer und anderer Geschicklichkeiten. Erlangen Knaben oder Mädchen solche »werktätigen Fähigkeiten«, dann lernen sie auch, sich selbst und ihren Körper »in Funktion« zu sehen: sie gewinnen Abstand zur Körperlichkeit an sich, da sie Leib und Seele als »Instrumente der Wirksamkeit« erfahren. Pathologisch würde die Sache dann, wenn durch Unbeholfenheit der Erzie- her oder traumatische Vorgänge eine künstliche Schwerfällig- keit erzeugt wird: der physisch, sozial und intelligenzmäßig gehandikapte Mensch ist Gefangener seines Körpers und könne sich »draußen« keine Erfolgserlebnisse holen. Reaktiv darauf käme es dann zur Überbewertung der Leiblichkeit, zur Effekt- hascherei ohne Leistung, zum demonstrativen Auffallenwollen um jeden Preis usw., was kaum je im Erscheinungsbild der Eitelkeit fehlt. Damit ist wieder etwas Richtiges getroffen. Jeder Beobachter eitler Menschen wird schon festgestellt haben, daß diese im allgemeinen hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Oft, aber nicht immer, sind sie irgendwie »Nichtskönner«, denn meistens ist man nur auf jene guten Merkmale stolz, die man in Wirklichkeit nicht besitzt. Wirkliche Könner und Menschen mit nachweisbaren Leistungen irgendwelcher Art werden eher zum Understatement neigen, wenn man von ihren positiven Eigenschaften spricht; der Selbstgefällige jedoch rühmt sich der Vorzüge, die er in der Regel nicht hat. Im Sinne von Adler und Schultz-Hencke (Harald Schultz-
- Hencke: >Der gehemmte Mensch<, Stuttgart 1940) kann man in jedem Fall von Eitelkeit von einer tiefsitzenden Hemmung im Persönlichkeitsaufbau sprechen. Dem oberflächlichen Betrach- ter mag dies zunächst paradox erscheinen: eitle Charaktere spielen sich oft genug in den Vordergrund, sprechen überall mit, ziehen eine Schau ab und bringen es oft sehr geschickt zuwege, im Rampenlicht zu stehen. Vor allem schüchterne Charaktere beneiden den eitlen Menschen ob dieser Fähigkei- ten, die ihnen als »höchstes Glück der Erdenkinder< erscheinen. So frisch und frech mit Menschen und Menschengruppen um- zugehen, das gilt bei den Zaghaften und Zurückhaltenden als Gipfel der Lebenskunst. Sieht man jedoch genauer hin, ist es mit dem Mut der Narziß- ten nicht sehr weit her. Sie raffen wohl in Gesellschaft alle ihre Lebensgeister zusammen und brillieren mit Gesten und Wor- ten, die den Schein von Souveränität aufrechterhalten. Sobald es aber darum geht, wirkliche Lebensaufgaben anzupacken, merkt man schnell, daß ihr Strohfeuer gar nicht wärmt. Diese »Ungehemmtem sind stark blockiert, wenn sie ernsthaft arbei- ten und wirklich lieben sollen. Dann kommen sie mit ihren >wenn< und >aber< und haben alle Argumente zur Hand, die angeblich >logisch< beweisen, daß die Umstände gegen sie sind und demnach ihren Rückzug in die Passivität oder in den Schmollwinkel rechtfertigen. Besonders ängstlich ist der eitle Mensch, wenn er lieben soll - gehört er doch zu jenen Neuroti- kern, die nach Adler wohl gelernt haben, sich lieben zu lassen, nicht aber, mit eigenem Engagement andere zu lieben. So steckt menschliches Scheitern hinter jeder Art von Eitelkeit oder ist gar ihr Wesenskern. Auf Zehenspitzen wird immer nur jener herumstolzieren, der im Grunde gar nicht gut gehen kann. Sich selbst vergrößern muß zwanghaft der Kleinmütige, der zutiefst darunter leidet, daß ihm die Stimme im eigenen Innern jeglichen Wert abspricht. Durch eine auffallende Feder auf dem Hut, eine ungewöhnliche Blume im Knopfloch, durch Tragen der neuesten Mode, durch Schmuck und verschiedene Statussymbole wird uns nur der Mensch imponieren wollen, der im übrigen oft nicht viel vorzuzeigen hat. Entdeckt man an einem Menschen aufgeblähtes Gebaren, muß man nur genauer hinschauen, um den Minuspunkt zu erkennen, der »ausgeblen- d e t werden soll. Hier soll wiederum Nietzsche zitiert werden, der in >Die fröhliche Wissenschaft die bissigen Verse einfügte:
- 62
- Die N a s e schauet trutziglich Ins L a n d , der Nüster blähet sich - D r u m fällst du, N a s h o r n ohne H o r n , Mein stolzes Menschlein, stets nach vorn! U n d stets beisammen findt sich das: Gerader Stolz, gekrümmte N a s . 5
- Wirkliche Persönlichkeiten treten schlicht auf und ruhen in sich selbst. Sie sind befähigt, ihre Arbeit zu tun und ein Du zu lieben. Sie nehmen echtes Interesse an ihrer menschlichen Umwelt. Aus ihrem Wesenskern heraus können sie teilhaben an Menschen, Tieren, Pflanzen, an der Natur und an der Gesellschaft. Nicht so der Eitle: er ist leer im Innern und muß stets vorgeben, daß er mitdenken, mitfühlen und mithandeln werde. Schein tritt anstelle von Sein, Fiktion anstelle von Faktum.
- Ausdruckskunde und Charakterologie
- Die Graphologen haben schon seit langem Zeichen für Eitelkeit in der Handschrift erkannt und beschrieben, die obige Thesen belegen. Der eitle Charakter wird erkennbar u.a. an folgenden Schriftzügen: unnötige Schnörkel, eigenwillige Verformung der Buchstaben, Unterstreichung des Namens, geringes Form- niveau (L. Klages), seltsame Raumgestaltung der Schrift, Stili- sierung des Namens in Abhebung von der übrigen Schreibwei- se, Tendenzen der Linksläufigkeit (nicht zum Empfänger hin, sondern zurück zum Schreiber) usw. Was in der Schrift haupt- sächlich »Mitteilung« sein sollte, wird beim Narzißten unwill- kürlich mehr zur Selbstdarstellung. Da die Schreibbewegung symbolisch (Max Pulver: Symbolik der Handschrift) den Weg vom Ich zum Du darstellt, muß sie durch Eitelkeit merklich »gebremst« werden. Dies findet man u.a. bei aufgebauschten Majuskeln, denen dann in den Wörtern selbst anspruchslosere Buchstaben folgen. Der große Anfangs- buchstabe verspricht etwas, was der folgende Schriftzug nicht hält. So ist ja oft auch das Benehmen des eitlen Menschen ein uneingelöstes und uneinlösbares Versprechen. Schlechte Men- schenkenner lassen sich von Theatralik und Selbstgefälligkeit beeindrucken und müssen sich dann lange in Geduld üben, bis »wirklich etwas kommt«. Meistens kommen aber nur »Schnör-
- 63
- kel<, Tuerei anstelle von Taten, Gebärden ohne Handlungen, Lippenspitzen, ohne daß tatsächlich gepfiffen wird. Der Um- gang mit eitlen Menschen ist frustrierend, da die Hoffnung auf zwischenmenschliche Wärme enttäuscht wird. Die >Groß-Spurigkeit< des Eitlen ist nicht immer leicht zu erkennen. Am deutlichsten zeigt sie sich in einem Verhalten, das mit aller Gewalt von der Norm abweichen will: so spazierte Oscar Wilde in London herum, mit einer riesigen Sonnenblu- me im Knopfloch. Auf die Frage nach den zwölf besten Bü- chern in der englischen Literatur antwortete er salopp: »Das kann ich nicht beantworten - ich habe erst drei Bücher ge- schrieben!« Und Charles Baudelaire, der stets >tout Paris< in Atem halten wollte und dabei Seitenhiebe auf seine Familie, mit der er im Streit lag, austeilte, ließ sich seine Haare grün färben: jeder sollte in dem Spaziergänger den einzigartigen Dandy sehen. Aber auch bewußte, d.h. kokette Tiefstapelei kann diesen Zweck erfüllen. Ein reicher Jüngling in Athen liebte es, in zerlumpten Kleidern auf den Marktplatz zu gehen. Sokrates, der ihn sah, soll gerufen haben: »Jüngling von Athen, dir schaut die Eitelkeit aus den Löchern deiner Kleider heraus!« Und als Rousseau, inzwischen berühmter Literat, an den Kö- nigshof geladen wurde, erschien er unrasiert und trat mit dem Anspruch auf, als >Naturbursche< die ganze feine Gesellschaft verachten zu dürfen. Dieses Glänzenwollen durch Unzivili- siertheit dringt sogar in seine >Confessions< (1771) ein, die nach der Devise größtmöglicher Wahrheitsliebe alle seine sexuellen Laster auswalzen und mit unverkennbarer Eigenliebe schildern, was für ein ungewöhnlich verquerer Mensch er schon von Jugend an war. Er liebäugelt mit seinen Perversionen, denn man ragt auch dann aus der Menge, wenn man sich als »größter Sünder< geriert. Nach Fritz Künkel (z.B. Einführung in die Charakterkunde<> 12. Aufl., Stuttgart 1957) müssen wir den eitlen Menschen innerhalb seiner Typologie in die Gruppe des Stars (neben Heimchen, Cäsar und Tölpel) einordnen. Diese vier Typen repräsentieren nach Künkel »Formen der Ichhaftigkeit<, d.h. einer mißlungenen Erziehung, die kein Gefühl für Sachlichkeit und Gemeinschaft wecken konnte. Der Star stammt aus einem Erziehungsmilieu, das verweichlicht und verwöhnt. Er antwortet auf diese Situation mit einer
- 64
- aktiven Lebenseinstellung, indem er - wie schon in seiner Kindheit - in allen Lebenskonstellationen zu einer Vorrang- und Ausnahmeposition drängt. Das Interesse der Mit- und Nebenmenschen wird hierbei wenig berücksichtigt. Stars haben immer nur sich selbst im Auge - alle anderen sind für sie Claqueure oder Publikum. Sind sie in Gesellschaft, finden sie diese nur dann interessant, wenn sie in ihr brillieren können. Nichtbeachtung hassen sie wie die Pest: sie fühlen sich dann »entwertet«. In Gesprächen reißen sie die Initiative an sich und bestreiten ganz allein die Unterhaltung. Wie zwanghaft das sein kann, berichtet die Anekdote von einem Schriftsteller, der mit einem Bekannten zusammentraf und fast zwei Stunden lang nur von sich selbst sprach. Sodann hielt er bestürzt inne und sagte mit ehrlichem Selbsttadel: »Es ist entsetzlich. Nun sprechen wir die ganze Zeit nur von mir. Wir müssen das Thema unbedingt wechseln. Was halten Sie denn von meinem neuen Roman}« Natürlich bestimmt die Eitelkeit auch die Partnerwahl eines Menschen. Beim Startyp ist ausschlaggebend, ob der Partner ihn hinreichend bewundern kann: ein »Heimchen« im Sinne von Künkel dürfte diesem Zweck am ehesten dienen. Endlose Part- nerschaftsstreitigkeiten entspinnen sich etwa daran, daß zwei Stars einander finden, und jeder den anderen in die Rolle des Applaudierenden drängen will. Das geht selten gut und endet oft genug mit Trennung. Der Witz hat sich dieses ergiebige Thema nicht entgehen lassen und behandelt in seiner Weise die prekäre Partnerschaftspro- blematik des eitlen Menschen. Hierzu eine kleine Tierfabel: Ein Pfau und ein Huhn gingen aufs Standesamt und wollten heiraten. »Nanu«, sagte der Standesbeamte angesichts des sehr unterschiedlichen Paares, »was hat denn euch beide zusam- mengeführt?« - »Oh«, erwiderte der Pfau stolz, »meine Braut und ich haben unerhört viel Gemeinsames. Um nur beim Wichtigsten zu beginnen: Meine Braut und ich sind rasend in mich verliebt/« Nicht nur der »Star« ist ein Ausbund von Eitelkeit: auch die übrigen drei Typen der »Ichhaftigkeit« kranken an derselben psychischen Deformation. Beim »Cäsar« ist diese Tatsache ganz offenkundig; wer andere Menschen beherrschen und unterjo- chen will, ist nicht weit davon entfernt, sich selbst als eine Art Gott zu sehen. Aber auch »Heimchen« und »Tölpel« sind stolz
- 65
- hinter der Fassade von Ängstlichkeit oder Stumpfheit - Künkel hat dies in seinen charakterologischen Studien feinsinnig be- schrieben, so daß wir auf seine Publikationen verweisen können.
- Eitelkeit und Neurose
- Wir haben bereits die Meinung Alfred Adlers erwähnt, daß die Eitelkeit im Mittelpunkt aller neurotischen Fehlentwicklungen stehe. Diese These ist auf den ersten Blick hin nicht leicht einzusehen. Man denke etwa an den Angstneurotiker mit sei- nen quälenden Angstanfällen oder Phobien, den Depressiven mit seiner düsteren Verstimmung und seinen selbstquälerischen Verhaltensweisen, den Zwangsneurotiker mit seinen irritieren- den Zwangsgedanken oder -handlungen, den psychosomati- schen Patienten mit der Fülle möglicher Symptome, die fast jede Körperfunktion beeinträchtigen und zum Entgleisen brin- gen können: wo soll da das Moment der Selbstbespiegelung und Selbstgefälligkeit zu finden sein? Der Patient in der Psy- chotherapie tritt als »exquisit Leidender< in Erscheinung; er ist von Hemmnissen aller Art betroffen und darum ist nicht ohne weiteres zu erkennen, wo er selbst die Ursache ist, weil er der allgemein üblichen Jagd nach Erfolg seinen Tribut entrichtet. Für den Kranken sieht es so aus, als hätte ihn seine Neurose oder sein psychosomatisches Leiden >von außen her< überfallen: Die tiefenpsychologische Erkenntnis jedoch lehrt uns, daß er dies >unbewußt< selber konstelliert. Was als »Kausalität des Schicksals« imponiert, ist im Grunde unbewußtes oder unver- standenes Wollen, d.h. eigener Daseinsentwurf, von dessen unliebsamen Folgen der »Entwerfende« heimgesucht wird. Mit dieser Optik steht und fällt jegliche Krankheitslehre in der Tiefenpsychologie, die davon ausgeht, daß das sogenannte »Unbewußte« im Seelenleben Urheber unserer Träume, Fehllei- stungen, neurotischen Symptome usw. sei. Freud vertrat be- kanntlich die These, daß die Symptomatik »das Liebesleben der Patienten« beinhalte: was andere Menschen an Interesse und Kraft in Erotik investieren, konzentriere der Patient auf seine Neurose, die ihm schließlich »das Liebste in der Welt« wird. Vorsichtiger formuliert können wir sagen, daß die neurotischen Symptome »das Ersatzleben des Neurotikers« verkörpern: an-
- 66
- stelle von Arbeit, Freundschaft, Zwischenmenschlichkeit usw. setzen die Kranken die Beschäftigung mit ihren realen und eingebildeten Schmerzen. Aus den Ereignissen ihres Lebens sammeln sie emsig die Bausteine ihres »Leidens«: da die Neurose >selbstgeschaffen< ist, aus allem Erlebten und Erlittenen gleich- sam ausgewählt, gilt für den Lebenslauf der Patienten die Parole: >Prüfe alles, und behalte das neurotischste!< - ein Satz, der trotz seiner scheinbaren Unglaubwürdigkeit die Biographie des Neurotikers prägt. Sieht man das neurotische Leiden als mehr oder minder unbe- wußte »Leistung des Patienten«, dann ist es nicht mehr so rätselhaft, inwiefern es mit seiner Eitelkeit verknüpft ist. Die Symptome sind gewissermaßen >ein Ausweg aus der Verzweif- lung«. Als sich der Patient durch Erzieher und Umwelt be- drängt sah und keine Antwort auf die bedrohlichen Fragen seiner sozialen Umwelt wußte, >erfand< er seine Symptomatik, mittels derer er seine Familie und die weitere Umgebung mani- pulieren konnte. So wird die Neurose zum Hilfsmittel und Ausdruck eines >Sieges<, und nichts wird an diesem Faktum geändert durch die Tatsache, daß es sich immer um einen Pyrrhussieg handelt, bei dem der Sieger mehr verlor als ge- wann. Neurose ist für Adler eine »Sicherung«, ein Schutzwall, vom Patienten in der Kindheit errichtet gegen mehr oder minder eingebildete Gefahren des Selbstwertverlustes. Um ganz sicher zu gehen, hat - nach einem witzigen Wort von Adler - der Neurotiker meistens »etwas zuviel Symptome«: mit weniger könnte er auch gut auskommen. Wilhelm Stekel wies auf die »schauspielerischen Elemente« in der neurotischen Symptoma- tik hin. Fühlt man sich genau in das Gebaren der Angst- und Zwangskranken, der Depressiven, der Hypochonder usw. ein, dann ist man beeindruckt von der Suggestivität, mit der sie ihr Leiden an ihre Umwelt vermitteln können. Sie wandern kla- gend und anklagend durch die Welt und führen - oft schon verjährte - Prozesse gegen Eltern und Erzieher, denen »unbe- wußt« demonstriert werden soll, wie sie das Leben des Patienten verdorben haben. Man kann - in einer Kultur, die Mitleid als Tugend ansieht - auch durch Schwäche herrschen, durch Angst die Umgebung in Schach halten, durch Zwänge über andere Menschen trium- phieren und durch Trauer und Melancholie das Glück und die
- 66
- Freude der anderen entwerten oder gar zerstören. Das ist der offene und der verborgene Kampf, der vom Patienten gegen seine Umwelt geführt wird. Nietzsche hat in >Zur Genealogie der Moral< trefflich erläutert, wieviel unbewußte Grausamkeit in der Leidensdemonstration liegen kann. Er argumentierte hauptsächlich gegen das Christentum, aber überall, wo er >Christ< sagt, kann man sehr gut >Neurotiker< einsetzen. Der Psychotherapeut tut gut daran, die Symptome des Patien- ten als dessen »kostbaren Besitz< zu betrachten und jeglichen »frontalen Angriff gegen die Symptomatik< zu vermeiden. Man kann Eitelkeit nicht auf direktem Wege weganalysieren, aber man kann sehr wohl einen Menschen durch allgemeine Ermuti- gung, Bestärkung seiner Selbst- und Menschenkenntnis, Um- stimmung seiner Persönlichkeit usw. über das Verfangensein in sich selbst hinausheben, ohne mit seinem prekären Selbstwert- gefühl in Konflikt zu geraten. Schonung von Ich und Ichideal des Kranken ist eines der zentralen Gebote in der Seelenheil- kunde. Eine »Umwertung aller Werte< kann nur sehr langsam und fast immer nur indirekt stattfinden. Wer sich in Kampf und Geplänkel mit dem Analysanden einläßt, wird meist den kür- zeren ziehen. Der Patient ahnt beim ungeduldigen Therapeu- ten, der ihn »ändern will<, eine gewisse Eitelkeit, der er die eigene Sturheit und Selbstgefälligkeit entgegensetzt. So kommt es zum Ringen zweier eitler Personen um ichhafte Ziele, bei denen der Sachbezug (Heilung) außer acht gelassen wird. Fragt man einen annähernd gesunden Menschen, was er in seinem Leben bisher gelernt hat, dann wird er meistens Schul- abschlüsse, Berufskenntnisse, Liebeserfahrungen, sozialen Umgang, Annäherung an Kulturwerte vorweisen. Der Neuro- tiker beantwortet diese Fragestellung mit seiner »Leidensge- schichte<, die demnach Ersatz für Selbstverwirklichung und Selbstwerden der Person bedeutet. Aus vielfältiger Bedrängnis heraus hat er das »Reich der Phantasie< gewählt, in welchem er für seine realen Unzulänglichkeiten reichlich entschädigt wird. Es ist oft erstaunlich, welchem Narzißmus Patienten in ihrem Phantasieleben huldigen und wie selbst von der Welt abgekap- selte Psychotiker in aller Stille Allmachtsgedanken ausbrüten. Die Einbildungskraft ist ein zwiespältiges Geschenk der Natur an den Menschen: sie kann dazu dienen, die Realität zu ver- schönern und zu bereichern, oder aber sie wird zum Opiat und Fluchtmittel, welches uns der Wirklichkeit entfremdet.
- 68
- Daseinsanalyse der Eitelkeit
- Zieht man die Daseinsanalyse (M. Heidegger, Ludwig Bins- wangen Medard Boss u.a.) zu Rate, dann kann man unsere obigen Beschreibungen noch differenzierter darstellen. Eine daseinsanalytische Interpretation der Eitelkeit ist in der Lage, den inneren Zusammenhang aller bisher genannten Teilbefunde aufzuweisen. Wie Boss vor allem auch in seinem > Grundriß der Medizin und Psychologie< (2. Aufl., Bern 1975) sehr subtil darlegt, ist die menschliche Daseinsform in keiner Weise mit der tierischen oder pflanzlichen Existenz zu vergleichen. Dasein auf mensch- licher Ebene heißt Weltoffenheit, d.h. Offenheit gegenüber der Realität, die ihrer jeweiligen Bedeutung entsprechend bewertet wird. Der Heideggersche Begriff des In-der-Welt-Seins muß sorgfältig geklärt werden. Der Mensch existiert in der Welt nicht nur wie ein Stein an einem bestimmten Ort. Wiewohl er körperlich an diesem oder jenem Ort >anwesend< ist, umspannt sein Bewußtsein die gesamte für ihn wahrnehmbare Welt. Dies hört sich sehr abstrakt an, kann aber konkretisiert werden. Der Mensch hält sich »normalerweise« draußen bei den Mitmen- schen und Dingen auf. Aus der Fähigkeit oder Wesenseigen- tümlichkeit, alles Seiende im Hinblick auf seine Bedeutung zu begreifen, erwächst dem Menschen auch seine Pflicht, dieses (d.h. Dinge und Menschen) so zu behandeln, daß es zu seiner bestmöglichen Entfaltung gelangen kann. Bei Heidegger (>Sein und Zeit<, 1927) wird dies zum Beispiel unter dem Titel der »vorausspringenden Fürsorge« abgehandelt, nämlich jener Hal- tung, die dem jeweiligen Du die ihm offenstehenden Möglich- keiten aufzeigt, aber nicht der Versuchung erliegt, sie »für es« realisieren zu wollen. Jeder Mensch kann nur selbständig »er selbst« werden, und es ist Freiheitsberaubung, wenn man - auch liebevoll - für einen anderen »einspringt« und »seine Taten« zu vollbringen versucht. Beim eitlen Menschen fehlt dieser Respekt vor den Freiräumen des anderen mehr oder minder völlig. Er ist so ichbezogen, daß er kaum für andere vorausdenken kann. Freud nannte diese Ichhaftigkeit den sekundären Narzißmus: damit vertrat er die Meinung, daß der Eitle durch eine von Frustrationen geprägte Biographie auf sich selbst zurückgeworfen werde und nicht in der Lage sei, Menschen, Dinge und Werte in ihrer eigenen
- 69
- Existenz zu sehen. Der eitle Charakter akzeptiert seine Mit- menschen nicht, bestenfalls sind sie für ihn >Publikum<. Die Interessen der anderen berühren ihn nur soweit, als sie mit den seinigen übereinstimmen oder kollidieren. Ein Geisteskranker (P.D. Schreber) bemerkte in seinen Denkwürdigkeiten (die Freud einer Analyse unterzog), daß ihm in der Psychose die Mitmenschen als »flüchtig hingemachte Schatten< erschienen: die Parallele ist nicht zu weit hergeholt, wenn man die Eitelkeit mit diesem psychotischen Zustand vergleicht, indem die »Kom- paktheit der Menschen und Dinge rings um den Eitlen sich verflüchtigt, da er weitgehend in sich selbst verfangen ist. Geht dem Menschen der Bezug zur Umwelt verloren oder hat er ihn erst gar nicht richtig erlangt, dann verringert sich sein Freiheitsspielraum. Anstatt zu leben und zu wirken bleibt er gewissermaßen in seinem Körper stecken: er leibt mehr als er lebt. Die übertriebene Hinwendung zum eigenen Körper ist oft Symptom für eine Stagnation in der menschlichen Entwick- lung; normalerweise hat der Leib des Menschen eine unauffälli- ge Existenzform: nur bei Schmerz oder Krankheit tritt er in seiner >Materialität< in den Vordergrund. Nicht einmal in der sexuellen Vereinigung spielt das rein Körperliche eine primäre Rolle; zwei sich liebende Menschen sind psychisch so stark aufeinander konzentriert, daß die beiden Körper oft als »Instru- mentarium< mit einbezogen werden. Eitle Menschen liebäugeln mit angeblichen oder realen eigenen Körpervorzügen, die sie über ihre Mitmenschen hinausheben. Dies bedeutet ein Zurückbleiben gegenüber der normalen menschlichen Entwicklung, die eher nach konkretem Wirken und Handeln strebt. So zeigt sich das Infantile an der Eitelkeit, oder besser noch: das Geistlos-Primitive, denn gesunde Kinder sind selten Körperfetischisten. Dazu passen nun die weiteren >Existentiale<, die Heidegger und Boss beschrieben haben: das menschliche Dasein ist eine Struk- tur, die in vielerlei Wesensaspekte ausgegliedert werden kann. So gibt es etwa die Existentiale des Verstehens, der Befindlich- keit und der Rede, die im Rahmen der Heideggerschen Philoso- phie ihre spezifische Bedeutung besitzen. Für unsere Zwecke möge die Erläuterung genügen, daß der Mensch ursprünglich gestimmt in seiner Welt lebt, daß er im Verstehen alle Formen seines Könnens versammelt und daß die >Rede< das menschliche Sprechenkönnen beinhaltet. Vom Eitlen in seiner Selbst- und
- 70
- Leibverfangenheit werden wir erwarten, daß er nicht in der Stimmung der »heiteren Gelassenheit existiert, sondern unter irgendeiner Form des Verstimmtseins leidet. Seine »Lebenstüch- tigkeit haben wir schon weiter oben angezweifelt, und seine »Rede< ist kaum je das Miteinandersprechen- und Schweigen- können, sondern das >Gerede<, das boden- und haltlose Plap- pern über Weltbezüge, die nicht eigens erkannt und durchdrun- gen sind. Die Nietzsche-Zitate haben auch deutlich gemacht, daß der Eitle kein »Ich hat< oder kein »Ich ist<. Nach Fleidegger wäre er dem »Man-Selbst-Sein< verfallen. Die Urteile und Maßstäbe der anderen bestimmen ihn weitgehend. Das eigene Denken und Fühlen hat er meist gar nicht entdeckt, deshalb jagt er fremder Zustimmung hinterher, ohne daß diese jemals das eigene Selbst- bewußtsein ersetzen könnte. Eitelkeit macht »fremdbestimmte und die Heilung des eitlen Menschen kann nur darin liegen, daß er sich auf den schwierigen Weg der Selbstfindung begibt. Hierbei wird er unweigerlich mit der Angst vor dem Selbstsein konfrontiert. Nach Boss und Heidegger ängstigen sich die Menschen vor der Freiheit und der Ichentwicklung, weil beiderlei untrennbar mit dem menschlichen Gewissen und dem Verantwortungsbe- wußtsein verbunden sind. Meistens wählt nur der den Pfad des Selbstseinkönnens, der durch Zufall oder Schicksal zu ihm hingezwungen wird. Denn diese Selbsterfahrung ist auch mit dem Todesbewußtsein verknüpft. Solange man im Man-Selbst- Sein in der Selbstvergessenheit dahintreibt, kann man sich moralischer Verantwortlichkeit entziehen und die Gewißheit des eigenen Todes verdrängen. Anders wird es für jene, die sich in eine verantwortungsbewußte Existenz vorwagen: sie sehen dem Tod als »äußerster Möglichkeit des Daseins< ins Auge und hören den Gewissensruf, der ihnen »im Modus des Schweigens< das »Werde, der du bist< nahelegt. Eitle Menschen empfinden es als narzißtische Kränkung, daß auch sie sterben müssen. Daher ist ihr Zeiterleben grundlegend gestört. Sie verbinden nicht die drei Dimensionen von Vergan- genheit, Gegenwart und Zukunft zum »gelebten Augenblicks sondern wursteln meistens von Augenblick zu Augenblick, leben in einer eher »punktuellen Existenz<. So erscheinen sie dem Betrachter oft als >geschichtslos<. Ihre sprunghafte Lebens- weise verschlägt sie einmal hier- und einmal dorthin, aber die
- 7i
- innere Kontinuität ihres Daseins geht ihnen verloren. Auch dies vermittelt ein Bild von Hohlheit und Leere. Vergessen des Vergangenen und Außerachtlassen des Zukünftigen entwertet den Augenblick, so daß Leben sich dem Vegetieren mehr annähert als einer menschenwürdigen Existenzweise. Es ist ein Existieren in der Oberflächlichkeit, fern aller Tiefe und Ernst- haftigkeit. Wahrscheinlich beruht auf diesen Zusammenhängen der Wunsch nach verlängerter oder gar >ewiger< Jugend, der heut- zutage die kosmetische Chirurgie zu einem blühenden Geschäft gemacht hat, in dem mehr verdient wird als in irgendeinem anderen Zweig der modernen Heilkunde. Die Menschen wol- len nicht alt erscheinen und sind krampfhaft bemüht, alle Zeichen des Alterns durch ärztliche Eingriffe zu vertuschen. Mütter wollen wie Schwestern ihrer Töchter aussehen und lassen ihre Haut an allen möglichen Körperpartien liften, nicht zu reden von Transplantationen aller Art, die mitunter sogar die Gesundheit gefährden. Man tut so, als ob Schön- oder Hübschsein das höchste Gut des Lebens sei und als ob man alle Selbstachtung verlöre, wenn man nicht bewundernde Blicke auf sich ziehen kann. Vielleicht hat diese Mentalität Oscar Wilde das Motiv zu sei- nem Roman >Dorian Gray< eingegeben; da der Dichter ein Narziß höchsten Grades war, lag es für ihn nahe, den Verfall der äußeren Schönheit als schwere Beeinträchtigung zu empfin- den. Daher die Fiktion des Bildes, welches von Dorian im Jünglingsalter gemalt wird und durch eigentümliche Zauber- wirkung im Laufe der Jahre altert, indes Dorian selbst jung und schön bleibt. Alle Laster, denen er sich hingibt, und alle Untaten, die er begeht, zeichnen keine Spuren in sein Gesicht; nur das Gemälde, das er in einem verborgenen Winkel seines Hauses aufbewahrt, wird häßlich und abstoßend, indes Dorian selbst weiterhin alle Leute durch seinen Liebreiz einnehmen kann. Aber die seltsame Dualität funktioniert nur bis zu einem gewissen Grad. Als Dorian seinen Dolch in das Porträt stößt, trifft er sich selbst und verblutet.
- 72
- Eitelkeit und Psychotherapie
- In der Psychotherapie tut man gut daran, den eitlen Menschen behutsam umzuerziehen und ihm langsam die eigentlich tragen- den Werte des Lebens und der Kultur nahezubringen. Eine Klippe ergibt sich in der therapeutischen Situation unter ande- rem schon daraus, daß narzißtische Typen nicht gerne einen Fortschritt oder eine Entwicklung vollziehen, die sie einem anderen Menschen zu verdanken haben. Am liebsten würden sie alles Gute und Sinnvolle in ihrem Leben auf sich selbst zurückführen. Darum hat Alfred Adler den Seelenärzten gera- ten, die fortschreitende Gesundung des Patienten nicht als ihr eigenes Werk hinzustellen: dies mobilisiere mit Sicherheit Wi- derstand des Kranken, der eventuell das Selbstbewußtsein des Arztes mit Verschlimmerung seines Zustands beantwortet. Besser wäre es, dem Analysanden zu sagen, daß der >wahre Therapeut« auf seinem Stuhl sitze, indes der Psychologe nur die Funktion eines Katalysators übernehme, der bestimmte Verän- derungen ermöglicht, ohne direkt daran beteiligt zu sein. Einfach wäre die Heilung, wenn der Eitle lediglich eine Untu- gend »verlernen« müßte; aber dieser Punkt ist nur einer von einer ganzen Reihe weiterer. Der Lernprozeß umfaßt die ge- samte Persönlichkeit. Viele verborgene Minderwertigkeitsge- fühle müssen deutlich gemacht und korrigiert werden. Das In- teresse für Mit- und Nebenmenschen, ausgehend von der erwa- chenden Sympathie für den Seelenarzt, soll gefestigt und entfal- tet werden. Sodann geht es darum, viele sozial nützliche Ver- haltensweisen zu trainieren, die im Leben des Narzißten ver- kümmerten, weil er den emotionalen Zugang zu anderen nicht fand. So ist die Heilung von Eitelkeit ein umfängliches Unterneh- men. Rationale Korrekturen allein erweisen sich fast immer als machtlos. Kritik und deutende Hinweise lassen den Eitlen oft genug kalt, oder sie erwecken seinen energischen Widerspruch. Vielfach vermutet er, daß die Eitelkeit der anderen an seinem »angeblichen« Narzißmus Anstoß nimmt: wären die anderen nicht so borniert, dann würden sie seine Größe, Schönheit, Intelligenz und Stärke leichter anerkennen! Der Psychotherapeut muß diese Patienten - wie alle anderen auch - »umstimmen«, ihre Welt- und Werterfahrung durch den von ihm selbst gelebten reineren und humaneren Weltentwurf
- 73
- berichtigen, sie zum Handeln stimulieren und ihnen durch die >Kunst der Rede< jenen »menschlichen Raum< vor Augen füh- ren, in den hinein sie sich wahrhaft entfalten können. In der psychotherapeutischen Situation sollen Begegnungen stattfin- den, in denen der liebeshungrige Patient oft erstmals in seinem Leben die Bedeutung von Verstehen und Verstandenwerden erfährt. Er soll angenommen werden mit seinen Schwächen und Unzulänglichkeiten, die er auch deshalb so ängstlich verdrängt, weil diese in seiner Kindheit nicht akzeptiert wurden. In der Arbeit mit dem Therapeuten kann der Patient auf alles schau- spielerische Getue verzichten, das aus Angst vor dem Du geboren wird und diese Angst auch weiter kultiviert. Die Gelassenheit des Seelenarztes »induziert« ähnliche Haltungen im Kranken, der seinen »inneren Krampf< losläßt und für Welt und Selbstsein »ein Gespür bekommt. In anderen Worten: Die Beziehungsarmut der eitlen Patienten stellt ihr größtes Handikap dar. Um die Selbstachtung vor ihrem schwachen oder verletzten Ich zu bewahren, haben sie relativ bedeutende Teile der Wirklichkeit »ausgeklammert. Sie scheuen vor der Realität zurück, weil sie dann wiederum die Last des Kampfes um ihre Integrität, die dramatische Spannung ihres Selbstwertstrebens ertragen müssen. Sie wollen nicht all- zuviel mit der Welt zu tun haben, da sie über eingeschliffene illusionäre Wege zur Selbsterhöhung verfügen. Für derartige Patienten ist es nicht leicht zu verstehen, daß Welt und Ich eine Einheit sind und daß die Person in ihrem Bezugs- system lebt, gewissermaßen wie ein Herz in einem Organis- mus. Auch dies wirkt wie eine Mittelpunktbeschreibung, ist aber dem Mittelpunktstreben des Eitlen genau entgegengesetzt. Ein lebenswichtiges Organ in einem Lebewesen vollzieht fast automatisch alle Dienste, die von ihm gefordert werden, damit es selbst und sein Organismus gedeihen können. Nicht so die Eitelkeit: sie will sich auf Kosten des Ganzen in den Vorder- grund spielen. Wer diese Enge des Blickfeldes überwunden hat, funktioniert in allen sozialen und kulturellen Situationen nach Kriterien des Allgemeininteresses. Natürlich ist dieses in vielen Lebenslagen sehr umstritten: der Mensch irrt, solange er strebt. Gleichwohl wird derjenige die beste Lösung finden, der früh- zeitig lernt, seine eigene Situation mit der Lage seiner Mitmen- schen und der Menschheit überhaupt zu verbinden.
- 74
- Familientherapie und Kulturanalyse
- Naturgemäß liegt in den obigen phänomenologischen und psy- chotherapeutischen Darlegungen auch implizit ein pädagogi- sches Programm, wie man nämlich Kinder zu selbstbewußten, eben nicht eitlen Menschen erzieht. Wir wollen nicht ausführ- lich bei diesem Aspekt verweilen; aber einige Motive sollten nicht unerwähnt bleiben. Kinder werden nicht eitel, wenn ihre Eltern nicht eitel sind. Die elterliche Persönlichkeit prägt mehr als das Programm der Eltern. Horst-Eberhard Richter (>Patient Familie) führt den »hysterischen Charakter« auf einen Familientypus zurück, der mit dem Schlagwort »Familie als Schaubühne« gekennzeichnet wird. Wachsen Kinder in Familien heran, in denen machtbe- wußte Mitglieder die Beziehungspersonen in »Theaterpubli- kum« umfunktionieren, vor dem Tag für Tag »eine Schau abge- zogen wird«, dann wird man ihnen vergeblich Schlichtheit, Echtheit und Mitmenschsein predigen. Das Familienbeispiel wird ihnen in Fleisch und Blut übergehen, und später im Leben werden sie mittels theatralischer Gebärden die innere Leere übertönen, die ihnen in den ersten Lebensjahren anerzogen wurde. Wichtig ist auch die Entwicklung aller im Kind angelegten Begabungen und die Vermittlung eines Leistungsbewußtseins. Lebenstüchtige Kinder sind für Selbstgefälligkeit weniger anfäl- lig als Faulpelze, Versager und Opfer von Minderwertigkeits- komplexen. Ermutigung in jeder Form bestärkt das Kind darin, sich im Schnittpunkt sozialer Beziehungen und Aufgaben zu sehen. Verwöhnte und entmutigte Kinder jedoch wollen immer im Mittelpunkt stehen, Lorbeeren ohne entsprechenden Ener- gieaufwand einheimsen und als Star durch die Gegend stolzie- ren, der allein schon durch seine bloße Existenz - ohne Bei- tragsleistung - im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Heitere und glückliche Kinder sind ebenfalls vor Eitelkeit geschützt. Der Schutzwall der Eitelkeit um einen Charakter ist gewissermaßen die Abwehr von Trauer und Angstgefühlen, die die Persönlichkeit zu übermannen drohen. Das Imponiergeha- be des Eitlen kompensiert seine Selbstzweifel, in denen Kon- taktscheu und Furchtsamkeit zusammenfließen. Je schöpferischer und differenzierter das Werterleben eines Menschen ist, um so eher kann er sich selbst in seinem Wert
- 75
- richtig einstufen, ohne in die beiden pathologischen Möglich- keiten der Hybris und der Selbstverachtung zu verfallen. Eitle Menschen haben in der Regel ein Defizit in ihrer Empfänglich- keit für Werte. Da sie alles um sich herum als mehr oder weniger »minderwertig« ansehen, bleibt ihnen zur Wertschät- zung nur das eigene Ich übrig, eventuell noch der »dazugehöri- ge« Lebenspartner, das Haus, das Auto, das Kind und allenfalls noch der Hund. Die Grenze zwischen Ich und Welt wird sehr scharf gezogen. »Wir hier« und »die dort«: dazwischen liegen Abgründe, die nicht zu überbrücken sind. Darum bestehen enge Beziehungen zwischen Eitelkeit und Vorurteil, letzteres in Gestalt von Nationalismus, Konfessionalismus, Rassismus und politischen Alleinseligkeitslehren. Die entfremdende und veräußerlichende Kultur, die das »Ha- ben« über das »Sein« stellt, trägt darüber hinaus dazu bei, uns alle mit mit jenem Narzißmus zu impfen, der Kommunikation und Kooperation beängstigend behindert. Die sogenannten kollektiven Vorurteile machen das Phänomen der stellvertretenden Eitelkeit besonders deutlich, das ein ein- gehendes Studium verdient. Da viele Menschen dunkel ahnen, daß sie nicht so viele positive Eigenschaften haben, um darauf stolz zu sein, verlagern sie ihre Überheblichkeit auf soziale Gruppen oder Konfigurationen, denen sie sich zugehörig füh- len. So kann dann etwa der Gläubige sich als bescheiden und demutsvoll einstufen, aber er behauptet, sein Gott sei der einzige und »wahre Gott«. Ahnlich verhalten sich Sympathisan- ten politischer Gruppierungen und anderer Clans und Klüngel: auch das kleinste Parteimitglied sonnt sich in der Bewunde- rung, die etwa einem »Führer« oder einem Parteiprogramm gezollt wird. So kann Eitelkeit »delegiert« werden: das reicht sogar hinunter bis zum Fußballverein, den man unterstützt, und zum Arzt, von dem man sich behandeln läßt. Auch die Patienten in der Psychotherapie, die einiges über den »Streit der Schulen« wissen, rühmen ihren Analytiker und die von ihm vertretene Lehrmeinung, um damit kundzutun, daß sie eben »auf dem richtigen Dampfer sitzen«. Eine Anekdote erzählt, daß amerikanische Filmschauspielerinnen, die miteinander in Kon- flikt geraten, schon seit langem nicht mehr sagen: »»Ich werde dich in die Pfanne hauen!« Die übliche Redewendung lautet derzeit: »Mein Psychotherapeut wird deinen Psychotherapeu- ten in die Pfanne hauen!«
- 76
- So strebt jeder Mensch danach, in den Augen der anderen als bedeutend zu erscheinen, und eitel sind all jene, die dies mit Hilfe von Bagatellen und Banalitäten erreichen wollen. Zu einem eigentümlichen >Stellvertretungsprozeß< kommt es auch >binnenseelisch<, und zwar im Verhältnis des Ichs zu seinem lebideal. So heftet sich die menschliche Eitelkeit nicht nur an äußere Beziehungskreise und -personen, sondern auch an das Uber-Ich, dessen Entstehung Freud sowohl auf die Triebstruktur des Individuums als auch auf die Introjektion geliebter Vorbilder in Kindheit und Jugend zurückgeführt hat. Jeder Mensch gestaltet sein Leben so, als wolle er mit allen Mitteln die Zustimmung seines Ichideals erreichen. Auch in diesem Sinne ist das Ideal-Ich der Erbe von Eltern und Erzie- hern, denen das Kleinkind in der Regel gefallen will. Entschei- dend ist, daß das Individuum oft genug zum Ichideal ein Verhältnis aufbaut, welches man als »verlagerte Eitelkeit« be- zeichnen kann. Nun ist nicht mehr wichtig, wie groß und tüchtig das Ich ist oder wird; es ist zufrieden, wenn sein Uber- Ich mächtig und überlegen bleibt, egal, ob das Ich selbst scheitert oder eventuell sogar untergeht. In den Psychosen wird z.B. das Ich dem Ansturm seiner Bedrängnisse preisgegeben, aber das Ichideal thront weiter in oder über der Persönlichkeit, die Schiffbruch erlitten hat. Masochistische Menschen scheinen zu ihrem Idealich wie zu einem Gott aufzuschauen, und die Psychoanalyse behauptet, der Gott, den die Religion anbetet, würde aus dem Stoff der individuellen Ichideale geformt, re- spektive stelle deren Projektion in den Himmel oder in die >Uberwelt< dar. Bei überbescheidenen, hilflosen, kontaktscheuen und verhalte- nen Menschen sitzt die Eitelkeit oft in ihrem verborgenen Idealbild, das zum Hindernis für Wandlung und Entwicklung wird. Im Grunde geht es jedem (neurotischen) Menschen wie dem Jüngling Narziß in der griechischen Mythologie. Von ihm wird erzählt, er habe die Liebeswerbung der Nymphe Echo ver- schmäht, worauf diese ihn mit maßloser Selbstliebe strafte. Er verliebte sich in sein eigenes Spiegelbild, das er im Wasser erblickte - die Liebe zu seinem eigenen Bildnis wurde zu einer verzehrenden Sehnsucht, die erst ein Ende nahm, als ihn die Götter in eine Narzisse verwandelten. Überträgt man den Mythos in die Psychologie, dann besagt er
- 77
- im wesentlichen, daß die Liebe zu einem Du (und zur Welt) das wahre Heilmittel gegen den Narzißmus ist. Mißlingt diese Zuwendung zu den anderen, dann bleibt nur noch die krank- hafte Leidenschaft für das eigene Ich, die fruchtlos und unergie- big ist. Der eigentliche »Gegenstand« unserer Liebe sind die Mitmenschen, die Arbeit, die Schönheit, der Fortschritt. Der eitle Mensch hat nur einen Götzen zu verlieren, wenn er die Hypostasierung seines Ideal-Ichs aufgibt und sich dem Strom des inneren und äußeren Werdens anvertraut. Die in sein Idealbild investierten Energien fließen gewissermaßen in sein Ich zurück und kommen dessen Kraft und Kapazität zugute. Es vollzieht sich im individuellen Bereich jene Wendung, die ein Feuerbach oder ein Nietzsche bezüglich der Religion von den Menschen forderten: Die Liebe, die man an ein »jenseitiges« Wesen vergeudet, soll ins Diesseits zurückgelenkt werden. Nietzsche sagt: »Es ist nicht genug Liebe in der Welt, daß man einen Teil davon an ein eingebildetes Wesen verschwenden dürfte!« Ahnlich gilt für die Eitelkeit, daß sie Intelligenz und Gefühl vom realen Lebensprozeß abzieht und in Phantomen fixiert.
- Molière oder die Welt der Eitelkeit
- Einer der bedeutendsten Porträtisten menschlicher Eitelkeit war Molière (1622-1673), dessen Komödien viele menschli- che Schwächen und Untugenden gegeißelt werden, die auf den gemeinsamen Nenner »Eitelkeit« zurückgeführt werden kön- nen. Für Lustspieldichter aller Zeiten und Zonen ist der eitle Mensch ein unerschöpfliches Reservoir von Themen und Moti- ven; in der Kritik menschlicher Unechtheit und Überheblich- keit versieht das Lustspiel eine pädagogisch-ethische Funk- tion. Molières Werk ist vielseitig und mannigfaltig, und so können wir nur auf einige seiner Texte eingehen. Der Dichter war ein scharfer Beobachter seiner Zeitgenossen während der Ära Lud- wigs X I V . ; er zeigte die komische Seite des Menschen, indem er einzelne Charaktertypen schuf, die sich allesamt als Ausprägungen der menschlichen Natur erweisen. Auto- ren wie Molière gehören in die Geschichte der wissenschaft- lich-philosophischen Besinnung des Menschen auf sein
- 78
- wunderliches Wesen und auf seine Stellung im großen Rahmen der Natur und der Geschichte. Sieht man von einigen »Vorübungen« des Autors ab, so kann man >Tartuffe< (1664) als seine erste große »Komödie der Eitel- keit« bezeichnen. Orgon hat den Betrüger Tartuffe in sein Haus aufgenommen, weil ihn dessen angeblich frommer Lebenswan- del entzückt. Tartuffe mimt den über alle irdischen Interessen erhabenen Frommen, ist aber auf das Geld seines Gastgebers versessen, dessen Frau er verführen und dessen Tochter er zu seiner Gattin machen will. Orgon in seiner Faszination ist blind für die Verlogenheit seines heuchlerischen Gastes, bis ihn seine Frau Elmire zum Zeugen von Tartuffes Liebeswerbung macht; der versteckte Gatte muß mit anhören, wie der religiöse Heuchler sein eigenes Weib zu umgarnen versucht, indem er alle ihre moralischen Skrupel als unsinnigen Irrwahn beiseite schiebt. Als Elmire in der Verführungsszene nochmals an Or- gon erinnert, tut Tartuffe seinen Wohltäter mit folgenden Worten ab: »Wozu denn all die Mühe, die Sie an ihn verschwenden? Der Mensch ist - unter uns - wie Wachs in meinen Händen; Man muß ihm tüchtig schmeicheln, dann tanzt er, wie man pfeift, Und glaubt nicht einmal das, was er mit Händen greift.« In dieser kleinen Szene wird deutlich, daß Orgons Achillesferse nicht in seiner Leichtgläubigkeit, sondern in seiner Eitelkeit besteht. Heuchler, Betrüger und Hochstapler arbeiten haupt- sächlich mit dem übersteigerten Anerkennungsbedürfnis ihrer Opfer, das Grundlage von deren Naivität und Infantilismus ist. Frankreichs Klerus erwirkte beim König ein Verbot dieses Stückes, wiewohl es nicht die Religion selbst, sondern nur das frömmlerische Gehabe aufs Korn nahm. Aber vielleicht hatte der Pariser Erzbischof nicht so unrecht, als er sich von >Tartuffe< gekränkt fühlte; wer die verlogene Religiosität entlarvt, ist nahe daran, Religion selbst als eine Art von Eitelkeit zu denunzieren, da der Mensch sich in ihr nicht selten als »Pseudo-Heiliger« gebärdet. Im Jahre 1666 wurde Molieres >Misanthrop< uraufgeführt. Darin zeigt er einen Menschcntyp, der durch die Maßlosigkeit seiner moralischen Forderungen alle seine Mitmenschen abwertet und sich zu Feinden macht. Alceste tritt mit dem Anspruch auf, ein
- 79
- ehrlicher, geradliniger und aufrichtiger Mensch zu sein. Merk- würdigerweise verliebt er sich in Célimène, die eine überhebli- che Intrigantin und Lebedame ist. Mit ihr will er in die Einsam- keit gehen, um dort verachtungsvoll der schnöden Welt den Rücken zu kehren. Das ist nun gar nicht in Célimènes Sinn, da sie sich in der Welt der Galanterie, der Halb- und Viertelwahr- heit eigentlich recht wohl fühlt. Sie weist daher den Antrag Alcestes zurück und macht sich zuerst heimlich und dann offen über ihn lustig; sie hat seine Welt- und Menschenverachtung durchaus als Eitelkeit erkannt. Wer menschliche Untugenden nicht tolerieren will, kann nur noch außerhalb der Gesellschaft leben und >von außen her< die Überlegenheit seines Moralempfindens verkünden. Man macht sich aber lächerlich, wenn man sich zum Bußprediger für jene Laster aufschwingt, an denen unter den gegebenen gesellschaft- lichen Bedingungen alle Menschen irgendwie teilhaben. Auch der Misanthrop beschmutzt sein Hemd und seine Hände, wenn er von seinem angemaßten Podest heruntersteigt und sich wirk- lich >mit dem Leben einläßt«. Dann schmilzt nämlich sein ethisches Pathos auf einen kläglichen Rest zusammen, der durch moralisierendes Eifern zugedeckt werden soll. Wer in irgendeinem Bereich >das Absolute« will, ist mehr in sich selbst als in den moralischen Wert verliebt. Zum religiösen Heuchler und zum Menschenfeind gesellt sich der Geizkragen, den Molière in >Der Geizige< großartig karikiert hat. Harpagon ist der >Mann mit der Kassette«. Seine Truhe, mit Geld gefüllt, ist das Liebste, was er auf Erden hat. Seinen Sohn will er an eine häßliche, aber reiche Witwe verheiraten; seine Tochter soll einen Witwer ehelichen, dessen hauptsächli- cher Vorzug im Reichtum liegt. Für sich selbst hat Harpagon die junge Mariane ausersehen, in die auch sein Sohn verliebt ist: so ist für eine brillante Komödie genügend Konfliktstoff ge- geben. Wie soll der Sohn Cléanthe durchsetzen, daß er und nicht sein Vater Mariane bekommt? Zum Glück ist sein Diener La Flèche ein listiger Geselle, der den alten >Schatzliebhaber< dabei beob- achtet, wie er seine Kassette im Garten vergräbt. Natürlich wird nun die Kassette gestohlen, eine Tatsache, die Harpagon beinahe um den Verstand bringt. Wenn er - nachdem er den Diebstahl seines verborgenen Geldschatzes entdeckt hat - mit Wut und Verzweiflungsgeheul über die Bühne rast, mutet er
- So
- wie ein Psychotiker an, der jedwede Orientierung verloren hat. Er will sich selbst und alle seine Mitmenschen aufhängen lassen, da man ihn seines Daseinsmittelpunkts beraubt hat. Ein ähnlich stereotypes Verhalten legt er bei dem Versuch an den Tag, alle Einwände gegen die Ehe seiner Tochter mit einem unsympathi- schen Ehemann zu entkräften; er wiederholt stets die für ihn offenbar magische Formel: »Er will keine Mitgift!« Da alle seine Pläne fehlschlagen, und jeder den heiratet, den er auch heiraten will, schließt Harpagon die Komödie mit den Worten: »Und ich gehe zu meiner geliebten Kassette.« Denn sie wird ihm zurückgegeben, weil er die Liebenden gewähren läßt und sich ihren Absichten nicht mehr entgegenstellt. In Eckermanns >Gespräche mit Goethc< kommt Goethe oft ge- nug auf Molière zu sprechen und rühmt ihn als einen wahrhaft großen, reinen Menschen. Er sei immer wieder erstaunt, wenn er seine Stücke lese: Er (Molière) ist ein Mann f ü r sich, seine Stücke grenzen geradezu ans Tragische, sie sind apprehensiv, und niemand hat den Mut, es ihm nachzutun. Sein Geiziger, wo das Laster zwischen Vater und Sohn alle Pietät aufhebt, ist besonders groß und im hohen Sinn tragisch... Ich lese von Molière alle Jahre einige Stücke, so wie ich auch von Zeit zu Zeit die K u p f e r nach den großen italienischen Meistern betrachte. Denn w i r kleinen Menschen sind nicht fähig, die G r ö ß e solcher Dinge in uns zu bewahren, und wir müssen daher von Zeit zu Zeit immer dahin zurückkehren, um solche Eindrücke in uns anzufrischen. (12. Mai 1S25) 4
- In einer Gesellschaft, in der alle Prestige, Auszeichnung, Ruhm und Ehre nachjagen, kann man der Versuchung, mehr zu scheinen als zu sein, kaum entrinnen. Zur Zeit Molières galten der Adel, der Klerus und die Gelehrten als gesellschaftliche Oberschicht: Kein Wunder, daß die Bürger diese Stände imi- tierten, um sich im Abglanz von deren Bedeutung zu sonnen. >Der Bürger als Edelmann< karikiert einen reichen Spießer, der überglücklich ist, weil er mit einem Grafen Umgang pflegt und eine Gräfin anhimmeln darf. Natürlich fällt er den betrügeri- schen Manövern des Aristokraten zum Opfer und wird zum Narren gehalten. Von krasser Komik sind jene Szenen, in denen sich Herr Jourdain rasch etwas Bildung zulegen will, um damit bei seinen neuen >Freunden< brillieren zu können. Sprachlehrer, Musiklehrer, Tanzmeister und ein Philosoph müssen anrücken, um Jourdains Kenntnisse und Fertigkeiten
- 81
- zu erweitern. Zuletzt wächst sein Enthusiasmus ins Grenzenlo- se, als er erfährt, daß er schon vierzig Jahre lang >Prosa< gesprochen hat, ohne es zu wissen. Er muß dann aber doch dem Cléanthe seine Tochter zur Frau geben, wenn er >Paladin< eines vermeintlichen türkischen Prinzen werden will, ein Rang, der seiner Eitelkeit unendlich schmeichelt. Herrn Jourdains Gesinnungsgenossinnen sind >Die gelehrten Fraueru (1672), die ebenfalls nach Poesie und Bildung streben. Molière nimmt sich die affektierten und sentimentalen Damen der Salons vor und stellt ihren Bildungsfimmel als eitle, geistlo- se Pose dar. Unterdrückte Gefühle, gewaltsam zur Intellektua- lität abstrahiert, sind Kennzeichen der Blaustrümpfe, die an- geblich kulturelle Probleme in endlosen Phrasen diskutieren. Einem Pseudodichter spenden sie reichlich Lob, das wohl auch in verdrängter Sexualität motiviert ist. Der ganze Verein der Bildungsphilister plaudert über Philosophie. Was dabei heraus- kommt, sind schlichthirnige Floskeln, die allenfalls in einem Gespräch über Mode am Platze wären:
- Trissotin: M i r liegt die Systematik des Peripatetismus. Philaminthe: Den Sinn f ü r Abstraktion lieb' ich am Piatonismus. Armande: Das Weltbild Epikurs ist's, dem ich mich nahe fühle. Bélise: Ich neig' zu Epikurs Doktrin der Moleküle. D o c h mit dem leeren R a u m weiß ich nichts anzu- fangen, Ich fühle unbezähmbar nach der Substanz Verlangen. Trissotin: Ich lasse bei Descartes den Magnetismus gelten usw. 5 Endlich soll noch >Der eingebildete Kranke< (1673) erwähnt werden. In diesem Stück stellt Molière die damalige Medizin als Quacksalberei und berufliche Verlogenheit bloß. Der Patient Argan ist Hypochonder, findet aber schlaue Arzte, die ihn gegen gutes Geld mit Medikamenten und Klistieren zu heilen versprechen. Sein ganzes Leben wird nun der »medizinischen Wissenschaft untergeordnet, die nach Molières eigener Erfah- rung nur viel >Wortgetöse< macht, um die Unkenntnis ihrer Scharlatane zu bemänteln. Voltaire sagte hundert Jahre später über diesen Mißstand: »Oh diese Arzte, sie geben Substanzen, die sie nicht kennen, in Körper, die sie nicht verstehen!« Molières Argan möchte seine Tochter einem offenbar dummen jungen Arzt zur Frau geben. Dann nämlich hätte er einen Mediziner in der Familie, von dem er sich lebenslange Betreu-
- ung verspricht. Aber das Dienstmädchen Toinette hat beschlos- sen, daß die junge Frau den Mann ihrer Wahl heiraten soll. Sie ist es denn auch, die Argans Frau als egoistische Person ent- larvt, die nur darauf wartet, ihren Gatten möglichst bald zu beerben. Der Bruder des Patienten will den Hypochonder ebenfalls zur Vernunft bringen. Er sieht den einzigen Ausweg darin, Vertreter der medizinischen Fakultät zu bestechen, die Argan in einer Scheinprüfung selbst zum >Doktor der Medizin< promovieren lassen. Argan kann alle Fragen zur Befriedigung des Gremiums beantworten, so z.B. die berühmte Frage, war- um das Opium einschläfere: Quia est in eo Virtus dormitiva, C u j u s est natura Sensus assoupirc. (Weil in ihm eine K r a f t ist, deren N a t u r darin besteht, die Sinne einzuschläfern.) A u f andere Fragen des Kollegiums antwortet Argan ziemlich ste- reotyp: Clisterium donare, Postea seignare, Ensuitta purgare. (Ein Klistier geben, den D a r m reinigen usw.) 6
- Molière verspottete die Arzte und achtete selbst wenig auf seine Gesundheit. Auch ein Lungenleiden konnte ihn nicht daran hindern, weiter leidenschaftlich seine Theaterpläne in die Tat umzusetzen - als Stückeschreiber und Hauptakteur (darin Shakespeare und Nestroy ähnelnd). Im Jahre 1673 spielte er in Paris den > Eingebildeten Krankem und brach im dritten Akt zusammen. Bald darauf erlitt er einen Blutsturz: Molière starb am 17. Februar 1673. Der französische Literaturkritiker Sainte-Beuve hat dem genia- len Lustspieldichter in seinen Literarischen Porträts eine ein- dringliche Studie gewidmet. Er erzählt die Anekdote, daß Molière mitunter im Laden eines Händlers die Kasse bediente, um die Leute beim Einkauf beobachten zu können; oder man sah ihn stundenlang vor der Abfahrt auf der Postkutsche sitzen, um Leute zu beobachten, die sich auf eine Reise begeben. Ein Händler soll über ihn gesagt haben, er sei ein gefährlicher Mensch, da er >nie ohne Augen und Ohren ausgehe«. Dieses unfreiwillige Kompliment deutet an, daß der Dichter vermut-
- 83
- lieh >in das Leben verliebt war< und es in allen Einzelheiten hingebungsvoll studierte. Sein eigenes Leben mit allen seinen Schwierigkeiten war da keine Ausnahme. Molière stürzte sich in ein reges Liebesleben, und viele seiner erotischen Abenteuer klingen in seinen Stücken an. Seine eigene Gattin betrog ihn wie die Gatting des George Dandin (>Der Betrogene oder George Dandin<) es tat: Und wie Dandin sich vergeblich darum be- müht, seinen aristokratischen Schwiegereltern nachzuweisen, daß er ein Hahnrei sei (er konnte die Ausreden seiner Frau nicht entkräften), war auch Molière nicht in der Lage, seine wesentlich jüngere Lebensgefährtin ihrer Untreue zu überfüh- ren und sie zur Treue zu erziehen. Auch Molières Frau war Schauspielerin, und so kam es vor, daß beide, die einander in Treubrüchen überboten, auch auf der Bühne ein Ehepaar spiel- ten, das außerhalb der Ehe seine Genüsse sucht und findet. Molière war Sohn eines Tapeziermeisters bei Hofe und sollte auf Wunsch seines Vaters ebenfalls königlicher Tapezierer wer- den. Es drängte ihn jedoch zum Theater; er schloß sich einer wandernden Schauspieltruppe an. Seine Komödien sind Best- seller der Weltliteratur, nicht zuletzt, weil seine subtil gezeich- neten Charaktere menschlicher Eitelkeit erbarmungslos den Spiegel vorhalten.
- 84
- Josef Rattner
- Geiz
- Das Wort >Geiz< bedeutete im alten Sprachschatz so etwas wie »Habsucht und Gier<. Der Geizige ist wesensmäßig ein gieriger Mensch, einer, der von Begehren und Verlangen getrieben wird. Dementsprechend besagte das Wort >Geizhals< ursprüng- lich »gieriger Rachen< oder »Schlund eines Gierigem. In dieselbe Richtung weist auch >Geizkragen<, indem >Kragen< natürlich an >Hals< erinnert. Die Etymologie lehrt uns, daß Geiz mit einer Gier zu tun hat, die die orale Zone einbezieht oder auch von ihr ihren Ausgangspunkt nimmt. Wir werden daher die Analogie zu den Suchtkrankheiten im Auge behalten müssen: die Bezie- hung des Geizigen zum Geld und zu seinen Schätzen ähnelt eventuell derjenigen des Alkoholikers und des Drogenabhängi- gen zu ihren Rauschmitteln. Auch die »Weisheit des Volkes< hat sich ausgiebig mit dem Phänomen des Geizes auseinandergesetzt. So muß man nur den Sprichwörter-Reichtum der Völker und Nationen Revue pas- sieren lassen, um zu sehen, wie oft über die Hartherzigkeit und Asozialität geiziger Menschen geklagt wird. Aus einer beliebi- gen Sprichwörter-Sammlung entnehmen wir z.B. folgende Einsichten:
- Viel versprechen, wenig geben, läßt den Geizhals in Freuden leben. - Des Geizhalses einzige Wohltat ist sein früher T o d . - Ehrgeiz und Geldgeiz ist ein Brunnen allen Übels. - G e i z ist die größte Armut. - D e r G e i z und der Bettelsack sind bodenlos. - D e r Geizige ist ein R o ß , das Wein fährt und Wasser säuft. - D e r G e i z ist wie das Feuer; je mehr H o l z man dranlegt, desto mehr brennt es. - Geiziger Vater, ver- schwenderischer Sohn.
- Ein sehr anschauliches Bild des geizigen Menschen lieferte bereits Theophrast (yyz-zSy v.Chr.) in seinem Buch >Die Cha- raktere<, das wir als die erste Charakterologie des Abendlandes bewundern. Wie sein Lehrer Aristoteles war der griechische
- 85
- Philosoph und Naturforscher der Überzeugung, daß der Geiz ebensosehr ein Laster sei wie die Verschwendung; die dement- sprechende >Tugend< bestehe in der Sparsamkeit, welche >in der Mitte< zwischen den beiden genannten Lastern plaziert werden muß. Theophrast schreibt (zit. nach G. W. Allport: >Persön- lichkeit<, Meisenheim 1959, S. 59f.): D e r knauserige Mensch Knauserigkeit ist Sparsamkeit, die über das gewöhnliche Maß hinaus- geht. Ein knauseriger Mensch ist jemand, der vor Ende des Monats zu einem Schuldner geht, um sich nach seinem Darlehen zu erkundigen. Bei einem Mittagessen, wo die Unkosten geteilt werden, zählt er die A n z a h l der Tassen nach, die jeder trinkt, und bringt der Artemis ein kleineres T r a n k o p f e r dar als irgendein anderer. Wenn jemand zu seinen Gunsten einen guten Handel abgeschlossen hat und ihm die Rechnung zeigt, sagt er, es sei zu viel. Wenn sein Diener einen T o p f oder einen Teller zerbricht, zieht er den Wert von dessen K o s t ab. Wenn seine Frau ein Kupferstück fallen läßt, rückt er M ö b e l , Betten, Truhen ab und kriecht hinter die Gardinen. Wenn er etwas zu verkaufen hat, setzt er einen solchen Preis dafür fest, daß der K ä u f e r keinen Vorteil hat. Er verbietet jedermann, eine Feige in seinem Garten zu pflücken, über sein Land zu gehen, eine Olive oder eine Dattel wegzunehmen. Jeden Tag sieht er nach, ob die Grenzpfähle seines Besitztums nicht verrückt worden sind. Er wird einem Schuldner hart zusetzen und die Forderung eintreiben. Wenn er seine Bekannten einlädt, ist er sehr darauf bedacht, ihnen nur ganz kleine Stücke Fleisch anzubieten. Wenn er zum Markt geht, kommt er nach Hause, ohne etwas gekauft zu haben. Er verbietet seiner Frau, irgend etwas zu verleihen, weder Salz noch Lampendocht noch Z i m t noch Majoran, weder Mehl noch Girlanden noch Kuchen zum O p - fern. »All diese Kleinigkeiten«, sagt er, »summieren sich in einem Jahr.« Summa summarum sind die Kisten des knauserigen Mannes m u f f i g und die Schlüssel verrostet, seine Angehörigen tragen eine Tunika, die kaum bis an die Oberschenkel reicht; eine lächerlich kleine Olflasche versorgt sie bei der Salbung. Sie tragen das Haar kurz geschnitten und ziehen die Schuhe v o r Mittag nicht an; und wenn sie ihren Mantel zum Färber tragen, schärfen sie ihm ein, nur ja viel Kreide zu nehmen, damit er nicht so bald fleckig wird. 1
- Fast 2000 Jahre später knüpfte La Bruyere (1645-1696) an Theophrast an und beschrieb seinerseits die >Charaktere<, die er in seinem Jahrhundert in Frankreich und am Hofe Lud- wigs X I V . vorfand. Als großer Moralist faßte er hierbei auch den geizigen und habgierigen Menschentyp ins Auge, den er treffend zu charakterisieren wußte. Bitter bemerkt er, daß Reich-
- 86
- tum zumeist auf dem Boden der Unmoral und Gewissenlosig- keit wächst. Man muß Ruhe, Gesundheit und Ehre opfern, um Geld zusammenzuraffen. Der Besitz der einen wird durch die Armut der anderen >erzeugt<. Man kann sich am ehesten berei- chern, wenn man gefühllos gegen das Elend der Mitmenschen ist. Reichtum erwerben hängt oft mit Eitelkeit zusammen: wer viel Habe in seinen Truhen vor sich sieht, meint leicht, daß er ein kluger Kopf sei. Geiz ist ausgeprägter Egoismus, der auch vor den eigenen Familienangehörigen nicht haltmacht. Immerhin ist der Habgierige ein aktiver Mensch, und wenn er nicht unklug ist, kann er es mit der Zeit zu etwas bringen. La Bruyère sagt: Man kann es auf der Welt nur auf zweierlei A r t zu etwas bringen: durch eigenen Fleiß oder durch die Dummheit der anderen. A b e r die Reinheit der Seele leidet sehr unter dem Wettlauf nach Geld und G u t : Es gibt schmutzige Seelen voll K o t und Unrat, die für G e w i n n und Eigennutz so eingenommen sind wie schöne Seelen für Ruhm und T u g e n d ; sie sind nur der einen Wollust fähig, an sich zu raffen und nichts zu verlieren, auf jeden Heller versessen und begierig, aus- schließlich mit ihren Schuldnern beschäftigt, stets in Sorge um eine mögliche Geldentwertung, vergraben und gleichsam versunken in Kontrakte, Titel und Urkunden. Solche Leute sind nicht Verwandte, nicht Freunde, nicht Mitbürger, nicht Christen, vielleicht nicht einmal Menschen: sie haben Geld. 2
- Aber irgendwie übersieht der Geizige, daß er sein Geld nicht >ins Jenseits< mitnehmen kann: wahrscheinlich hat er das Ge- fühl, daß ihn sein großer Besitz >unsterblich< macht. La Bruyère weist darauf hin, daß eines Tages die Erben das Geld überneh- men und damit vielleicht den Geizhals >nach seinem Tod< dazu zwingen, an einem einzigen Tag mehr auszugeben als in seinem ganzen Leben überhaupt. Molières Komödie >Der Geizige< (1682) ist - neben Plautus - offenbar auch von Theophrast und La Bruyère beeinflußt. Sein Harpagon ist die klassische Figur des Geizkragen auf der Bühne. Alle verfolgt er mit seinem Mißtrauen, da er stets mutmaßt, daß man ihn um sein Geld bringen will. Seine Pferde bekommen nichts zu fressen, seine Diener haben keine anstän- digen Kleider, Sohn und Tochter können nicht standesgemäß leben. Und dieser Geizhals begibt sich auf Freiersfüße: Er will die viel jüngere Mariane ehelichen, die bereits mit seinem Sohn
- 87
- Cléanthe ein zartes Liebesverhältnis angebahnt hat. Seine Toch- ter soll einen alten Mann heiraten, der keine Mitgift verlangt. Auch sie ist bereits verliebt, aber ihre Einsprüche gegen die Wahl des Vaters stoßen auf taube Ohren, da Harpagon darauf versessen ist, die Mitgift zu sparen. Seine zehntausend Dukaten hat dieser Misanthrop in einer Kassette im Garten seines Hau- ses vergraben. Da diese vom Diener seines Sohnes gestohlen wird, verliert er beinahe den Verstand: denn die Kassette ist für ihn das Liebste auf der Welt. Er ist sogar bereit, die von ihm umworbene junge Frau an seinen Sohn abzutreten, wenn der Diener nur wieder das Geld herausgibt. Denn mit dieser Sum- me kann er Wuchergeschäfte treiben, die den Betrag in kurzer Zeit verdoppeln. Man muß sich Harpagon als alt, ausgedörrt, mit lieblosem Gesicht und eitel vorstellen. Die Schmeicheleien der Kupplerin gehen ihm wie Honig ein; aber als ihn Mariane zum erstenmal sieht, erschrickt sie über seine Gestalt und sein Aussehen, die gar nicht zu Liebe und Ehe verlocken können. Harpagon muß als a- und antisexuell gedacht werden. Er ist verwitwet und liebt weder seine Kinder noch seine Hausgenossen, sondern nur sein Geld, das ihm Sicherheit für die Zukunft zu bieten scheint. Aber Gefahren lauern überall, da auch das versteckte- ste Gut gefunden und von anderen weggenommen werden kann. Molière hat die Gestalt des Harpagon mit scharfen Strichen nach dem Leben gezeichnet. Man empfindet unwillkürlich: Dieser Geizkragen sperrt sicher, wenn er von zu Hause weg- geht, eine lebendige Fliege in die Zuckerdose, um überprüfen zu können, ob die Diener während seiner Abwesenheit Zucker genascht haben. Wenn er Gäste einlädt, gibt er sorgfältige Instruktionen, wie viele Speisen man ihnen bei Tische servieren darf: der Rest des Mahles soll an die Nahrungsmittel-Kaufleute zurückgehen. Extremer Geiz ist eine Art von Besessensein und Wahn: die >fixe Idee< solcher Menschen ist die Kassette, in der ihr Besitz vereinigt ist. Die katholische Kirche reiht seit jeher den Geiz in die Serie der >sieben Todsünden< ein. Weniger dramatisch verurteilten ihn die Philosophen von Plato bis Nikolai Hartmann, die das Menschenunwürdige am geizigen Verhalten hervorhoben. Das- selbe taten die französischen Moralisten von Montaigne über La Rochefoucauld bis zu Chamfort, Rivarol und Vauvenar-
- 88
- gues. Als Erben dieser »Kritiker des Menschenherzens< traten Schopenhauer und Nietzsche auf den Plan, die in ihren Apho- rismen dann und wann auch auf den Geiz zurückkommen. Schopenhauer nannte den Geiz eine »Untugend des Altersc Dies stehe damit im Zusammenhang, daß der alternde Mensch die Freuden der Liebe nicht mehr genießen könne und sich daher auf das Geldsammeln beschränke. Der Philosoph ahnte bereits die Korrelation zwischen emotionalem Unglück und der Geldgier; daher sagte er: Das Geld ist die menschliche Glückseligkeit in abstracto; daher, wer nicht mehr fähig ist, sie in concreto zu genießen, sein ganzes H e r z an dasselbe hängt. 3
- Für Nietzsche war Geiz ein Ausdruck des Machtwillens, der sich in allen Lebensäußerungen bekundet. Die Menschen stre- ben begierig nach Geld, weil ihnen dieses Macht über Mitmen- schen und Dinge verleiht. Es ist nicht gerade die subtilste Herrschaft, die man durch pekuniäre Sammelwut über andere ausüben kann; man darf daher annehmen, daß es ein eher primitives Menschentum ist, welches sich dergestalt um Einfluß oder Erhöhung des eigenen Ichs bemüht: der Eindruck ist schwer abzuwehren, daß extreme Formen des Geizverhaltens zur psychischen Pathologie gehören.
- >Charakter und Analerotik<
- In einer kurzen Abhandlung aus dem Jahre 1908 mit dem obengenannten Titel machte Freud erstmals den Versuch einer psychoanalytischen Charakterologie. Dabei wies er einen Zu- sammenhang zwischen Organverhalten (Triebschicksal) und Charakterstruktur auf. Er ging aus von der Beobachtung, daß es Menschen gibt, die die Trias der Eigenschaften Ordentlich- keit, Sparsamkeit und Eigensinn bekunden. Dazu gehören meistens auch Reinlichkeit, Gewissenhaftigkeit, Verläßlichkeit, Pflichterfüllung usw. Man hat es hier offenbar mit einer struk- turalen Ordnung zu tun, deren Teile einander wechselseitig bedingen. Wie kommt es zur Ausbildung dieses Charaktertyps? Freud meint, daß es sich hierbei um eine Reaktionsbildung auf eine spezifische Triebsituation in der Kindheit handelt. Es gebe
- 89
- Menschen, die infolge von Konstitution und Erziehung mit der Disziplinierung der Darmfunktion und den Reinlichkeitsge- wöhnungen Mühe haben; aus ihnen rekrutiert sich die Schar der >Analerotiker<, die bei günstiger Sublimierungssituation die geschilderten wertvollen Kultureigenschaften aufbauen. Freud sagt: Wir schließen aus diesen Anzeichen auf eine überdeutliche Betonung der A f t e r z o n e in der von ihnen (den Analerotikern - J . R . ) mitgebrach- ten Sexualkonstitution; da sich aber nach abgelaufener Kindheit bei diesen Personen nichts mehr von diesen Schwächen und Eigenheiten auffinden läßt, müssen wir annehmen, daß die Analzone ihre erogene Bedeutung im L a u f e der Entwicklung eingebüßt hat, und vermuten dann, daß die Konstanz jener Trias von Eigenschaften in ihrem Charakter mit der A u f z e h r u n g der Analerotik in Verbindung gebracht werden darf. 4
- Primär sei das Interesse des Kindes am Unsauberen und auch an den Exkrementen: wenn es Gelegenheit dazu habe, spiele es gerne mit seinem Kot, ohne sich durch Ekelgefühle gestört zu fühlen. Nach und nach werden dann die Abwehrtendenzen der Scham, des Ekels und der Moral ausgebildet; dies erfolgt aber nur in befriedigender Weise, wenn das Kind mit seinen Eltern durch Liebe und Verständigung verbunden ist. Wo Trotz und Eigensinn überhandnehmen, erstreckt sich dies auch auf die Stuhlabgabe, die meistens nicht nach den elterli- chen Wünschen erfolgt. Retention von Kot im Darm kann Lustgefühle erzeugen, wobei eine passive Art von Auflehnung zum Vorschein kommt, die später zu Masochismus führen kann. Verstopfung und Geiz laufen nach Freud oft parallel. Darum weiß schon die Sprache, die vom »schmutzigen Geiz< spricht. Auch wird der Geizhals als >Dreckfresser< bezeichnet, der >nicht einmal einen Furz herzugeben bereit ist<. Für Freud sind demnach die bleibenden Charakterzüge der Menschen Fortsetzungen infantiler Triebe oder aber auch Sub- limierungen derselben und Reaktionsbildungen auf sie. Richtig beobachtet ist jedenfalls, daß derjenige, der weder Gefühle noch Sachwerte an seine Mitmenschen weitergeben kann, oft auch Verdauungs- und Ausscheidungsschwierigkeiten hat. In der Abhandlung >Hemmung, Symptom und Angst< aus dem Jahre 1926 werden die Akzente etwas anders gesetzt. Freud stellte zu jenem Zeitpunkt die >Kastrationsangst< in den Mittel-
- 90
- punkt der seelischen Fehlentwicklungen. Kastrationsfurcht er- streckt sich aber nicht nur auf den möglichen Verlust des kostbaren Genitales, sondern auch auf Besitz jeglicher Art, ja sogar auf das Leben. Ubersetzt man die Freudschen Beschrei- bungen aus der Sexualterminologie in die Alltagssprache, dann geht die Sorge jedes Menschenkindes dahin, in keine Unterle- genheitsposition zu kommen. Dies entspricht allerdings auch den Gedanken Alfred Adlers, die von Freud und seinen Schü- lern leidenschaftlich bekämpft wurden. Man kann durchaus der Meinung sein, daß der individualpsychologische >Minderwer- tigkeitskomplex< im psychoanalytischen >Kastrationskomplex< einen Zwillingsbruder erhielt, der sich von ihm nur durch winzige Nuancen unterscheidet. In Adlers Psychologie stehen die psychopathologischen Phäno- mene im Spannungsfeld von Minderwertigkeitsgefühl und Gel- tungsstreben auf der einen und dem Gemeinschaftsgefühl auf der anderen Seite. Fühlt sich ein Mensch als Kind sehr unterle- gen, so bildet er einen charakterlichen Entwurf (>Lebensplan<, >Lebensstil<) aus, der steil nach oben zur Überlegenheit hin- führt. Zu einem solchen Zwecke werden dann Eigenschaften wie Ehrgeiz, Eitelkeit, Neid, Geiz, Haß und Aggression mobi- lisiert; unter Umständen aber auch Trauer, Angst, Isolierung, Masochismus usw. In allen derartigen Fällen aber erleidet die soziale Einordnung Schiffbruch. Der von Selbstverachtung und kompensatorischem Machtwillen gehetzte Mensch kann nicht ausreichend Sozialinteresse entfalten und wird daher in den Fragen der Arbeit, der Liebe und der Gemeinschaft überhaupt keinen tragfähigen Lebensmodus finden. Er wird nicht zum Mitmenschen, sondern zum Gegenmenschen, und da die con- ditio humana auf gegenseitige Hilfe und Solidarität eingerichtet ist, wird er nirgendwo Glück, Ruhe und innere Sicherheit zustande bringen. Sein >nervöser Charakter< verhindert seine Selbstfindung und seine Selbstverwirklichung. Unter dem Begriff der >Nervosität< beschreibt Adler in seinem Hauptwerk >Über den nervösen Charakter< (1912) alle seelischen Entwicklungsanomalien, die schließlich in die Neurose, die Psychose, die Kriminalität, die Perversionen und die Sucht- krankheiten einmünden können. Alle Menschen dieser Art stehen in einem verstärkten Kampf mit ihrer Umwelt, der oft genug ins >Unbewußte< verdrängt wird. Der geübte Menschen- kenner entdeckt an ihnen Züge des Alleshabenwollens, der
- 7i
- Rechthaberei, der Gefallsucht, des Größen- und Gottähnlich- keitswahns, was sich jedoch - gemäß den gegebenen Umstän- den - in die scheinbar gegensätzlichen Ideale der Armut, der Keuschheit, des Gehorsams, der übergroßen Nachgiebigkeit, der auffälligen Schlichtheit usw. verkehren kann. Der wahre Charakter eines Menschen liegt nicht offen zutage. Er muß mitunter hinter einer vorgespielten Maskerade erkannt und erraten werden. Nach Adler hilft hier Struktursehen und Struk- turerkenntnis in vielem weiter; Charaktere sind >Ganzheitsge- fiige<. Daher sagt Adler über den Geiz und die mit ihm ver- wandten Wesenseigenschaften: Mit N e i d eng verwandt, meist damit verbunden, ist der Geiz. Damit ist nicht nur jene A r t des Geizes gemeint, die sich darauf beschränkt, Geldstücke zu sammeln, sondern jene allgemeine F o r m , die sich im wesentlichen darin ausdrückt, daß es jemand nicht über sich bringt, dem anderen eine Freude zu machen, der also mit seiner Hingebung an die Gesamtheit oder an Einzelne geizt, eine Mauer um sich auftürmt, um nur selber seiner armseligen Schätze sicher zu sein. Man erkennt hier leicht den Zusammenhang mit dem Ehrgeiz und der Eitelkeit einerseits, sowie mit dem N e i d andererseits. Es ist nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, daß alle diese Charakterzüge bei einem M e n - schen gleichzeitig vorhanden sind, so daß jemand durchaus noch nicht als Gedankenleser erscheint, wenn er einmal eine dieser Eigenschaften festgestellt hat, um zu behaupten, daß auch die anderen vorhanden seien. 5
- Adler verweist auch auf die Sozialpsychologie dieser unliebsa- men Eigenschaft, die den Kulturfortschritt hemmt und die soziale Durchbildung des Menschen korrumpiert. Wir leben in einer Epoche, die ganz vom Wirtschaftsdenken diktiert ist. Alles dreht sich um Gelderwerb und Geldbesitz, da pekuniäre Überlegenheit fast wie moralische Überlegenheit gewertet wird. Aus diesem rein materiellen Lebensprinzip erwächst für jedermann der Anreiz, sich an der Jagd nach Geld und Gut zu beteiligen, ohne auf das Wohl der Mitmenschen und der Ge- samtheit Rücksicht zu nehmen. Der Geizhals ist demnach nicht ein einzelner Pervertierter, sondern ein Prototyp des Zeitalters, in dem persönliche Bereicherung auf Kosten der Gemeinschaft zum Prinzip erhoben wurde. Ändert sich nichts an der kollekti- ven Moral oder Ethik, wird auch das Individuum verlockt, sein Herz nur dem Mammon zu schenken und dabei die Entwick- lung zu Reife, Glück und Weisheit außer acht zu lassen.
- 92
- Phänomenologie des Geizes
- In seinem Buch >Geschehnis und Erlebnis< (1930, Reprint Berlin 1978) hat Erwin Straus dem Thema Geiz eine treffende Analyse gewidmet. Es sind nur wenige Druckseiten, die im Grunde als Kritik der Psychoanalyse verstanden werden sollen: dabei wird der phänomenologische Gesichtspunkt deutlich, den Straus auch in seinen übrigen anthropologischen und psychiatrischen Arbeiten in den Vordergrund rückt. Das Leben des Geizigen ist - nach Straus - auf den Erwerb von Geld ausgerichtet, das dann gehortet und nicht ausgegeben wird. Der Geizhals gönnt weder sich selbst noch den anderen etwas. Aber das Nichts-Hergeben-Wollen ist nicht das Wesent- liche: das betrifft eher den Engherzigen. Der Geizige sitzt gewissermaßen auf seiner Kassette. Die Summen, die er darin hat, sind für ihn Möglichkeiten und Potentialitäten. Daran weidet er sich, und dies ist für ihn eine Quelle des Machtge- fühls. Geld ist »objektivierte Möglichkeit (S. 32). Auch ist es von Dauer, sofern seine Wertbeständigkeit garantiert ist. Kauft man sich etwas dafür, dann schrumpfen die vielen Möglichkei- ten, die man zuvor hatte. Das ängstigt den Geizigen, der Wert- und Möglichkeitsverlust fürchtet. Er ist ein genußunfähiger Mensch und stellt den Wert der Sicherheit hoch über denjeni- gen der Lust. Dahinter erkennt Straus das Phänomen der »Werdenshem- mung«, das die »anthropologische Medizin< auch bei der Zwangskrankheit hervorhebt. Zwangsneurotiker haben Angst vor dem Werden und stemmen sich daher gegen Veränderun- gen und Wirklichkeitskonfrontationen an. Diese Haltung kann nicht sinnvollerweise auf die Kotretention in der »analen Phase< zurückgeführt werden; darin nämlich sehen wir nur ein Behal- tenwollen, nicht aber eine Abwehr gegen das Werden und Vergehen, die für den Zwangsdynamismus und den Geiz cha- rakteristisch ist. Der Geizige sperrt sich gegen seine geschichtliche Selbstver- wirklichung, da diese im Werden auch das Vergehen enthält und letzten Endes auf den Tod zusteuert. Er will unsterblich sein, und sein Besitz soll ihm diese Unsterblichkeit ver- schaffen. Merkwürdigerweise meint Straus, daß Harpagon nicht schlech- ter dran gewesen wäre, wenn er »eine leere Kassette gehabt
- 93
- hätte< (S. 32). Denn er nütze ja die Möglichkeiten sowieso nicht, die ihm sein Geld bietet. Aber immerhin weiden sich Geizhälse am Gedanken ihres (realen) Besitzes, der ihnen das Gefühl der Überlegenheit über die Mitmenschen und oft sogar über das Schicksal gibt. Das Schwelgen in potentiellen Selbst- verwirklichungen ist eine Form von pervertiertem Genuß; es ersetzt dem Geizigen die Genüsse, zu denen er aus psychischen Gründen nicht fähig ist. Glücksunfähigkeit und Geiz haben einen inneren Zusammenhang - wie Schopenhauer feststellt. Auf diese Thematik ging auch Ludwig Binswanger in seiner umfänglichen Besprechung des Buches von Straus ein (in: >Ausgewählte Vorträge und Aufsätze<, Bd. II, Bern 1955, S. 147-173). Seine Analyse des Geizes ist subtiler als die von Straus: sie führt uns noch näher an die Lebenswirklichkeit heran. Kotliebe (worauf die Psychoanalyse insistiert) und Geldliebe des Geizigen entspringen - nach Binswanger - einem gemeinsa- men Dritten, nämlich dem In-der-Welt-Sein (Heidegger) des geizig-gestimmten Daseins. Hierzu sagt Binswanger in seiner eigentümlichen daseinsanalytischen Sprache: D e r Geizige füllt Kisten und Kästen mit >Gold<. Das Füllen geht dem Nichthergebenwollen in jeder Hinsicht voraus, nicht nur zeitlich und sachlich, sondern auch hinsichtlich der emotionalen Fundierung. Im Füllen und Gefüllthaben liegt das G l ü c k und die Freude des Geizigen, ihm gehört die Leidenschaft; das Nichtherausgebenwollen und Fest- halten ist nichts Primäres, sondern die notwendige Folge d a v o n . . . Beim Geizigen sehen w i r also im Füllen- und Aufstapclnmiissen einen der G r u n d z ü g e seiner Befindlichkeit; er erstreckt sich ebenso auf den Leib als H ö h l e wie auf Kisten und Kästen, Strümpfe und Säcke. 6
- Der Geizige hockt auf seinem Geld wie eine Henne auf dem Ei. Heimlich verehrt er seinen Besitz, den er immer wieder zählt. Dabei >nihilisiert< und >verräumlicht< er Welt und Leben: die Welt gilt ihm überhaupt als Höhle, und auch sein Leib nimmt >Höhlenform< an. Überall gähnt ihm Leeres entgegen, selbst im Zeitgeschehen oder im Zeitfluß. Darum gibt es keine Zeitigung in der Existenz des Geizigen: der Monotonie des Geizes ent- spricht die Monomanie des Geizhalses. Beziehungslosigkeit gegenüber der Umwelt ist ebenfalls cha- rakteristisch für den Geiz. Das Geld ersetzt ihm die Mitmen- schen: er ist ein Einzelgänger, und auch wenn er Familie hat, ist er im Grunde allein. Hierzu wiederum Binswanger:
- 94
- So führt der Lebensweg des Geizigen über den steilen Weg der dämonischen Besessenheit von einer bestimmten >Idee< von Welt, zwar einer äußerst eingeengten, sinnverarmten, in steter Auseinanderset- zung mit dem D ä m o n , zum gemeinsamen Sturz mit ihm ins leere Nichts. 7
- Menschen sind ihm nur Werkzeuge. Er will sie für seine Zwecke gebrauchen und verbrauchen. Ihre Schwächen allein interessieren ihn; denn wenn er diese ausnützt, kann er sich an ihnen bereichern. Binswanger spricht von einer >molochhaften< Tendenz bei jedem Geizkragen. Der Geist der Quantität beherrscht das Leben geiziger Men- schen, denen alles zum Geschäft (zur Ware) wird. Kälte, Berechnung und innere Leere fügen sich zu einer Struktur. Die Psychoanalyse sah richtig, wenn sie das Wesen des Geizes auch mit dem >Bauch< in Verbindung brachte. Denn auch dieser kann als >Höhle< erlebt werden, in enger Sinnverwandtschaft mit dem Schlund, der verschlingen, und den Händen, die packen kön- nen. Balzac hat in Eugenic Grandet diesem Menschentypus ein unvergängliches Monument errichtet. Er wußte auch schon um den Machthunger des Geizigen, um seine Lieblosigkeit, um seine fehlende Selbstverwirklichung, um die >Geistlosigkeit< seiner Existenz.
- Psychosomatik des Geizes
- Eine Leidenschaft wie der Geiz muß stets auch physische Begleiterscheinungen aufweisen, da heftige Gemütsbewegun- gen notwendigerweise auch körperliche Reaktionen nach sich ziehen. So kennt man bei Zorn und Wut den erhöhten Blut- druck, den beschleunigten Puls, die raschere Atmung und auch die Veränderungen des Darmtonus und der Darmperistaltik; im Zustand der Trauer sinken Blutdruck und Pulsschlag ab, und das Verdauungssystem wird träge und untätig. Es hat wohl keinen Sinn, hierbei von Ursache und Wirkung zu sprechen: man wüßte nicht, was man als primär ansetzen soll, die entglei- ste Körperfunktion oder die psychische Anomalie. Gewiß han- delt es sich um einen einheitlichen Prozeß, bei dem man körperliche und seelische Aspekte unterscheiden kann. Schon Freuds Darlegungen lassen darauf schließen, daß der Geizige unter Umständen an Verdauungsstörungen, ja häufig
- 95
- an richtiger Verstopfung leidet. Dies ist jedoch kein zwingen- der Befund, da eventuell auch ein »organisches Entgegenkom- m e n bestehen muß, sofern eine neurotische Fehlhaltung soma- tisch deutlich zum Ausdruck kommen soll. So kann allenfalls der Geiz auch am Kreislaufsystem »ausgedrückt werden. Da der Geizhals seine emotionalen Lebensäußerungen zurückhält, bremst er die Arbeit des gesamten sympathischen Nervensy- stems, wodurch etwa der Blutdruck unter der Norm bleibt und der Puls abfällt. Das vegetative Leben schaltet gleichsam auf Sparflamme. Das Eßverhalten solcher Menschen mag wechseln zwischen Heißhunger (Gier) und Appetitlosigkeit. Denn die Vorausset- zung der Freude am Essen ist doch grundsätzlich eine »orale Beziehung zur Welt<, d.h. Aufnahmefreudigkeit in allen Zonen des Lebens und Erlebens. Dies ist beim Geizhals fundamental gestört, weshalb er irgendwie stets mit der Welt hadert und mit ihr im Streit liegt. Das permanente Sich-Argern kann zu Ma- genverstimmungen (Dyspepsie) und Gallenkrankheiten führen. Auch Geschwüre am Magen und am Zwölffingerdarm kommen vor. Uberhaupt hat der Verdauungsapparat eine »Affinität* zum Ergreifen, Verarbeiten und Bewältigen der Umwelt; bei wem sich hier eine existentielle Anomalie zeigt, der wird nicht selten auch Verdauungskomplikationen haben. Der Enddarm als Organ der Speicherung der Exkremente und ihrer Ausstoßung ist eventuell als Ausdrucksorgan für Gebe- hemmungen bevorzugt. Er muß es aber nicht sein, da »Gebern bei vielen Organen als zentrales Vitalmotiv mitspielt. Man denke z.B. an das freudig geöffnete Auge, das unwillkürlich Sympathie gibt und nimmt - oder die warme, blutdurchströmte Haut, die uns das Gefühl der Nähe des anderen vermittelt. Oder die weichen, schwingenden Bewegungen, die die Mög- lichkeit einer Umarmung oder doch einer anmutigen Annähe- rung ankündigen. Oder die zugewandte Körperhaltung, die Mimik und Gestik, die Kontakt einleiten und aufrechterhalten. Genaugenommen ist der ganze menschliche Leib ein »Kontakt- organ<, womit Beziehung zur Umwelt aufgenommen oder verhindert wird. Die Thematik des Sozialen durchdringt den Leib bis in alle seine Zellen und Organe hinein. Der Geizige ist oft steif in seinen Bewegungen; Blässe und Kälte der Haut zeigen seine Ferne zu den Gefühlen, Auge, Mimik und Mund bekunden eventuell die kämpferische Hai-
- 96
- tung, die ganz auf Defensive oder Angriff gestimmt ist. Am deutlichsten aber wird sich die Asozialität am Sexuellen manife- stieren, da hier die kooperativste Lebensäußerung gleichsam von der Natur her vorgesehen ist. Man kann sich den Geizhals kaum als >guten Liebhaber< vorstellen; eher schon als >Sexual- kunden<, sofern sein Hang nach Unabhängigkeit und Autono- mie nicht den Sexualbereich total verkümmern läßt. Hingabe wird von ihm als Hergabe empfunden: und warum sollte er sich in generöse Gefühls>ausgaben< stürzen, die ihm doch nur - in seiner Sicht - flüchtige und vergängliche Genüsse verschaffen? Er liebt das Beständige und Unvergängliche, nämlich das Geld und Gut, das ihn gegen die Angst vor dem Schwinden seiner Lebenssnhstanz sichern soll. Eros fehlt dem Geiz, und gemäß der späten Trieblehre Freuds muß demnach Thanatos die Oberhand gewinnen. Geizige Menschen stellen >toten Besitz< über »lebendige Beziehungen«. Die Papierscheine oder Goldstücke sind ein kümmerlicher Ersatz für menschliche Interaktion und für Glück in Liebe, Arbeit und Selbstverwirklichung. Um des krankhaften und krampfhaften Gefühls der Allmacht willen wendet sich der Geizkragen von der Du- und Wir-Welt ab und isoliert sich in seiner einsamen, gefühlskargen >Welt des Reichtums«, wo er kein emotionales Echo bekommt; man muß sich jeden Geizigen als unglücklichen Menschen vorstellen.
- Psychoanalyse des Geldes
- Wer sich mit der Psychologie des Geizes befaßt, wird gut daran tun, auch die »Psychoanalyse des Geldes« in Betracht zu ziehen. Diesem Thema hat Ernest Bornemann ( Psychoanalyse des Gel- des - Eine kritische Untersuchung psychoanalytischer Geldtheo- rien<, Frankfurt 1973) e i n e n Sammelband gewidmet, in dem er die wichtigsten psychoanalytischen Arbeiten auf diesem For- schungsgebiet vereinigt. Die meisten Arbeiten der orthodoxen Psychoanalyse wiederho- len bis zum Überdruß die Freudsche These, daß im Unbewuß- ten des Menschen eine Gleichung von der Form Kot = Gold = Geld besteht. Als Beleg hierfür kann angeführt werden, daß in den Märchen und Mythen, in der Folklore und im Sprachschatz des Volkes tausende Anspielungen dieser Art bekannt sind. Die
- 97
- Gebrüder Grimm erzählen die Geschichte vom Goldesel, der auf Wunsch Dukaten defäzierte. In der christlichen Uberliefe- rung verlockt der Teufel schwache Menschenseelen mit Geld- gaben, aber das Teufelsgeld verwandelt sich jählings in Kot. Der Volksmund nennt Geizhälse schmutzig und filzig, gele- gentlich auch >Dreckfresser<. Die Analogie von Dreck und Geld ist nicht aus der Luft gegriffen; es fragt sich nur, ob es sinnvoll ist, die Parallele von Kot und Geld so zu ziehen, wie es manche psychoanalytische Schriften tun. Der gemeinsame Nenner von Geld und Exkrementen liegt vielleicht ganz anderswo. Beiderlei hat mit der Selbsterhaltung und Sicherheit des Menschen zu schaffen, ist Gegenstand ängst- licher Besorgnis des Menschen in unserer Kultur. Sein Gesund- heitszustand scheint ihm von der Beschaffenheit seines Stuhl- gangs abzuhängen; seine soziale Stellung aber hängt weitge- hend vom Stand seines Bankkontos ab. Manche Hypochonder beurteilen ihre Defäkation mit derselben Umsicht, die die Hohepriester der Antike bei der Eingeweideschau geopferter Tiere praktizierten. Für den Besitzgierigen jedoch ist sein tägli- ches Horoskop im Bankauszug zu finden, an den sich eventuell ebensoviel abergläubische Uberzeugungen heften wie im Alter- tum an Vogelflug und Tieropfer. In der Streitfrage, ob Geld (symbolisch) Dreck sei, möchten wir uns lieber auf die Seite des römischen Kaisers Vespasian als auf diejenige Freuds schlagen. Der nämlich führte in Rom eine Urinsteuer ein und wurde deshalb von seinem Sohn Titus kritisiert. Vespasian nahm eine der Münzen, die er durch diese Steuer eingenommen hatte, in die Fland und hielt sie Titus mit dem bedeutsamen Ausspruch unter die Nase: >Es stinkt nicht!< Geld ist eben eigentlich nichts weiter als universales Tauschmit- tel. Man kann dagegen in der entwickelten Gesellschaft fast alles eintauschen, also ist es »geronnene Machte. Geldmangel wird vom Betroffenen nicht nur als potentieller Verursacher von Hunger, Unbehaustheit usw. gesehen, sondern auch als Merkmal gefährlicher Ohnmacht. Wer Geld hat, hat Freiheits- spielraum. Das weiß auch Mephisto in Goethes >Faust<:
- Wenn ich sechs Hengste zahlen kann, Sind ihre K r ä f t e nicht die meine? Ich renne zu und bin ein rechter Mann, A l s hätte ich vierundzwanzig Beine. 4
- 98
- Schon Kinder machen die Erfahrung, daß Geld die Quelle von Einfluß, Beliebtheit und Lebensgenuß zu sein pflegt. Viele von ihnen sehen es als Liebesbeweis an, daß ihnen die Eltern ohne Einschränkung Geld zuteilen. Es kommt häufig vor, daß Kin- der Geld stehlen und damit Süßigkeiten und Spielsachen kau- fen, die sie an Gleichaltrige verteilen, um auf diese Weise »Freundschaften zu gewinnen«. Amerikanische Autoren be- haupten, daß eines der großen Traumata der Kindheit nicht darin besteht, daß die Eltern keineswegs allwissend und all- mächtig sind; in den U S A und anderswo wird das Frühtrauma oft in der Form erfahren, daß die Kaufkraft der Eltern begrenzt ist. Man kann sich ausmalen, welchen Schock es für verwöhnte Kinder bedeutet, denen zunächst alle geäußerten Wünsche erfüllt werden, wenn sie eines Tages an die entsprechenden Grenzen stoßen, die dann mitunter Gefühle der Wut und des Hasses gegen die »machtlosen Eltern« provozieren. Daß Geld »Macht« bedeutet, begreifen in erster Linie jene, die von einem tiefsitzenden »Bedürftigkeitserlebnis« in ihrer Kind- heit geprägt sind. Darunter fallen nicht nur Kinder armer Leute, sondern auch Menschen aus biologischen, sozialen, geschwisterlichen und anderen familiären Mangelsituationen. Aus dem Mangel entsteht die Machtmotivation, für die unsere Kultur verschiedene Auswege parat hat: Schönheit, Wissen, Geldbesitz, Einfluß, Sexualität u. a. m.; Dostojewski beschreibt in >Der Jüngling< einen gedemütigten jungen Mann, der aus den Bedrängnissen seiner Jugend heraus die »rettende geheime Idee« entwickelt: er will »Rothschild« werden. Um dieses Ziel zu erreichen, verhält er sich sparsam und tückisch, ist aber nicht konsequent genug, um den Kampf mit der widerstrebenden Welt aufzunehmen. Darin ähnelt er dem Helden in Der Spieler, einem anderen Dostojewskischen Roman, der ebenfalls um Geldmangel kreist; der Spieler hofft auf das »geneigte Fatum«, das ihn - wie die meisten - enttäuscht und zur Verzweiflung treibt. Bis in die Psychosen hinein wird deutlich, wie sehr im Rahmen unserer Kultur Geld mit Einfluß, Sicherheit und Geltung zu- sammenhängt. Manisch-depressive Patienten geben sich in der manischen Phase zügelloser Verschwendungssucht hin, was gewiß mit ihrem sonstigen Größenwahn zusammenhängt; in der depressiven Phase wird dann wieder alles zurückgehalten, nicht nur das Geld, sondern auch die Gefühle (oft genug treten
- 99
- dann Verdauungsstörungen auf)! In den Krankengeschichten schizophrener Patienten kann man mitunter lesen, daß sie Zettelchen mit Zahlen beschmieren und an die Umstehenden als >Geld< verteilen. Das sieht oft wie >hebephren< aus, ist aber offenkundig eine Art von Liebeswerbung der Kranken, die sich die Umwelt emotional erobern wollen. Psychoanalytiker behaupten, Geld habe eine >phallische Bedeu- tung« und entspräche potentiell einer Machtdemonstration. Kaufen z.B. ist eine Befriedigung der Selbstachtung, da das Verkaufspersonal in der Regel geschult ist, den Kunden als >König< zu behandeln. Noch königlicher fühlt sich der >Klepto- mane<, der, ohne zu bezahlen, ins volle Warenreservoir greift und >sich bedient< - Kleptomanie ist häufig eine Abwehrreak- tion gegen Kleinheitsgefühle und Depression, bei Frauen zeit- lich mit der Menstruationsdepression verknüpft, die dann den diebischen Griff ins Warenlager auslöst. Die Erfahrungen der Psychoanalyse bestätigen in einem gewis- sen Umfang die Lehre von Karl Marx, daß das Geld der >Gott< oder >Götze< der bürgerlichen Gesellschaft sei. Der Kult, der mit materiellem Besitz getrieben wird, mutet wie eine Karika- tur >sakralen Verhaltens« an. Die Habenorientierung - wie Erich Fromm sich ausdrückt - verdrängt weitgehend jegliche Seinsorientierung; Menschen, die als >Personen< Würde haben, werden wie Sachen nach ihrem Nutzwert eingeschätzt, wobei der Geldmensch der Moderne auch sich selbst einer derart entwürdigenden Beurteilung unterwirft. Darin liegt eine tiefgreifende Desorientierung des neuzeitlichen Menschentums, zu deren Verständnis Psychoanalyse, Ideolo- giekritik und Philosophie herangezogen werden müssen. Auch die Religionspsychologie muß zu Rate gezogen werden, da der >Fetisch Geld<, vor dem wir alle im Staube kriechen, einen Teil der Gefühle und Devotionen geerbt zu haben scheint, die frühere Epochen ihren hinter- und überweltlichen Göttern zuzuwenden pflegten. Norman O. Brown, der in seinem tief- schürfenden Buch >Die Zukunft im Zeichen des Eros< (Pfullingen 1962) diesen Zusammenhängen mit großem Weitblick auf der Spur ist, schreibt u.a.: Wenn es je eine Psychoanalyse des Geldes geben soll, so muß sie von der H y p o t h e s e ausgehen, daß der Geldkomplex im wesentlichen die Struktur der Religion hat - oder, wenn man will, der Verneinung der Religion, also des Dämonischen. Die psychoanalytische Geldtheorie
- 100
- muß von der Voraussetzung ausgehen, daß Geld - nach Shakespeare - der »sichtbare Gott< oder nach Luther >der Gott dieser Welt< sei.9 Brown knüpft an Freuds Altersphilosophie von Eros und Tha- natos an, um sich die psychische Kollektivpathologie des Men- schen von heute zu verdeutlichen. Die Geldliebe der bürgerli- chen Gesellschaft ist für ihn ein Ausdruck des >Todestriebes<, jedenfalls eine exquisit >antierotische< Lebenseinstellung. Anali- tät, Sparsamkeit, Geiz, Hamstermentalität, Raffgier usw. sind Widersacher des Eros, Haltungen der Lieblosigkeit und der Blindheit für eigentliche Werte. Die Abwendung vom Eroti- schen wird auch deutlich in Puritanismus und Askese kapitali- stischer Epochen. Dies gilt allerdings nur für jene Zeiten, in denen der Kapitalismus entstand und sich über alle Kontinente ausbreitete; heute führt er dazu, daß wir unser Ideal im totalen Konsum sehen, inklusive sexueller Freizügigkeit ohne Eros! Der zügellose Bereicherungswille der letzten vier oder fünf Jahrhunderte europäischer Geschichte mutet wie eine Massen- neurose oder ein Massenwahn an. Seit dem ausgehenden Mit- telalter ist das Geld der >nervus rerum<, das A und O des individuellen und kollektiven Lebens. Noch hat man zuwenig über diesen Machtfaktor geschichtlicher Entwicklungen nach- gedacht; es kam zum Durchbruch einer neuen >Weltreligion<, die die überlieferten Religionen als Schutzmäntelchen nicht verschmäht. Der Tiefenpsychologe muß sich jenseits aller »Analtriebhypo- thesen< daran erinnern, daß Geld eine »gesellschaftliche Institu- tion und darum von der Biologie her kaum sinnvoll zu begrei- fen ist. Die Tatsache, daß Geiz in unserer Kultur häufig vor- kommt, verweist auf ideologische und institutionelle Mängel, die durch Trieberziehung allein gewiß nicht beseitigt werden können.
- Psychotherapie und Geiz
- Nach Aussage von Ernst Bloch (>Das Prinzip Hoffnung<, Bd. I, Frankfurt 1959) soll in den zwanziger Jahren in der Vorhalle des Psychoanalytischen Ambulatoriums in Wien eine Tafel mit dem Spruch angebracht gewesen sein: »Ökonomische Proble- me können in die psychotherapeutische Behandlung nicht ein- bezogen werden!« Das war vielleicht als Schutz gegen die
- 101
- leidenschaftlichen Kommunismus-Kapitalismus-Debatten je- ner Epoche gedacht; vielleicht war es aber auch ein Bekenntnis zur bürgerlichen Weltanschauung« der frühen Psychoanalyse, die sich nur auf Patienten beschränkte, die erotische und Bezie- hungsprobleme aufwiesen; Armut und wirtschaftliche Be- drängnis galten nicht als behandlungsfähig, mutmaßlich auch nicht als behandlungswürdig. Heute dürfte sich diese Einstellung einigermaßen gewandelt haben. Man ist sich auch in Psychoanalytikerkreisen längst im klaren darüber, daß die Einstellung des Analysanden zum Geld und zu Wirtschaftsfragen psychologisch mindestens so ergiebig ist wie seine Träume, seine Erotik, seine Kindheitserlebnisse und seine Fehlleistungen. Es gibt derzeit Therapeuten, die es sogar für unabdingbar halten, dem Patienten irgendwann auch die >Gretchenfrage< zu stellen: »Nun sag, wie hast du's mit dem Geld?« Viele charakterliche Anomalien und Ursachen für Neu- rosen entspringen dem >Geldkomplex<, und oft kann eine Neu- rose erst dann wahrhaft geheilt werden, wenn sich die Einstel- lung des Analysanden zu Geldfragen verbessert. Das >psycho- ökonomische Problem« gehört in jede Analyse. Denn der Analytiker wird davon in irgendeiner Weise mitbe- troffen. In Zeiten der sogenannten >positiven Übertragung« haben die meisten Patienten keine Mühe, ihr Honorar zu zahlen; sie zahlen pünktlich und ohne Vorbehalte. Schlägt aber das Pendel um und breitet sich die >negative Übertragung« aus, dann wird der Patient merklich knauserig und kämpft um jeden Honorarpfennig, den der nun nicht mehr geliebte Analytiker berechnet. An der Zahlungsweise eines Patienten kann so nicht selten der Stand seiner >Übertragungsbeziehungen< abgelesen werden. Sofern der Therapeut die entsprechenden Sturmzei- chen« registriert, wird er sich nicht an den pekuniären Ausein- andersetzungen festbeißen, sondern auch die Beziehungsfrage überhaupt aufrollen. Es wird sich dann meistens erweisen, daß sich der schlecht zahlende Analysand gekränkt oder beleidigt fühlt und den Eindruck hat, nicht richtig geliebt zu werden. Als Antwort darauf hält er sein Geld zurück, was wiederum lehrt, wie sehr Geld und Liebe im durchschnittlichen Patientengemüt einander >stellvertreten< können. Viele Geizhälse gehen gar nicht in die Therapie, weil sie es nicht ertragen können, die ja doch recht hohen Honorare zu bezah- len. Statt dessen ertragen sie lieber die Neurose, an die sie sich
- I02
- leichter gewöhnen können als an große Geldausgaben. In ande- ren Fällen wieder begibt sich der Geizkragen in psychologische Behandlung, feilscht aber um das Honorar, achtet darauf, ob seine Sitzungen auch bis zur letzten Minute eingehalten wer- den. Noch traumatisierender als die Geldhändel ist für den Therapeuten, daß der geizige Patient ihm sehr wenig »emotio- nales Echo< zu geben bereit ist. Der Geiz beschränkt sich ja nicht auf Geld, sondern schließt das Hergeben von Worten, Gedanken, Gefühlen und freundlichen Stimmungen ein. Schon mancher Analytiker hat darüber geseufzt, daß er sich nach Behandlungsstunden mit solchen emotional geizigen Menschen so »ausgequetscht und »ausgelaugt fühlt, als hätte er ein Dut- zend anderer Analysanden anhören müssen. Da sich der Geizige kaum etwas gönnt, steht auch die Heilung im Widerspruch zu seinem Charakter und seiner Weltanschau- ung. Daher ist es von Vorteil, wenn man in der Therapie den Patienten dazu ermuntert, das (maßvolle) Geldausgeben zu lernen, um sich selbst und anderen Freude zu bereiten. Geiz ist eine >retentive< Lebenseinstellung: alles wird an sich gehalten. Der Gesundungsprozeß in der Psychotherapie besteht aber darin, das >Expansive< in allen seinen Erscheinungsformen zu bestärken und zu kräftigen. Das stößt in der Regel auf enorme Widerstände beim Analysanden, der Heiterkeit als Oberfläch- lichkeit, Geldausgeben als Verschwendung, Gefühle als Ge- fühlsduselei, soziale Interaktionen als Zeitvergeudung mißver- steht. Der Pessimismus und die Misanthropie des Geizhalses werden zum schwierigsten Widerstandsthema der Psychothera- pie, die oft Schritt für Schritt die Lebensabwehr solcher Cha- raktere vermindern und eliminieren muß. Psychotherapeuten müssen viel Eros in sich tragen, um die Lebensverneiner zur Bejahung, die Angstlichen zum Mut und die Geizigen zur Freigebigkeit zu erziehen. Die geänderte Einstellung zum Geld ist dann oft ein subtiles Indiz für die gewandelte Lebenseinstellung.
- 103
- Balzacs Roman >Eugenie Grandet<
- Die Anekdote erzählt, daß der amerikanische Multimillionär John Rockefeller armen Kindern eine kleine Bibel und einen blankgeputzten Cent zu schenken pflegte. Es wird nicht be- richtet, welche Vorstellung er damit verband; aber man geht wohl nicht fehl, wenn man vermutet, daß er damit die Tugen- den Sparsamkeit und Frömmigkeit fördern wollte. Dieser Zusammenhang ist nicht zufällig - er hat seine sozialge- schichtlichen und sozial-psychologischen Ursprünge. Nach der These von Max Weber entsprang der >Geist des Kapitalismus« dem Glaubenswandel während der Reformation. Indem die Reformatoren gewissermaßen >Selbsterlösung durch Arbeit und wirtschaftlichen Erfolg« predigten, lehrten sie eine neue Form der Askese, die nichts mehr mit dem Flagellantentum der frühen Christenheit und des Mittelalters zu tun hatte. Nun wurde nicht mehr der Leib gepeinigt und ihm die Nahrung verweigert. Aber seine Energie sollte voll in die Arbeitswelt einmünden und dem Ethos der Wirtschaft und der Industrie entsprechen. Die Menschen des 16., 17., 18. und 19. Jahrhun- derts verstanden dies als Anreiz zur Produktion und zur öko- nomisch-technischen Entwicklung. Sie wurden sparsame Handwerker, Kaufleute und Industrielle, die ihren Ehrgeiz darein setzten, mehr zu produzieren als zu verbrauchen, mehr zu gewinnen als auszugeben. Die >Akkumulation des Kapitals«, von Marx als eines der Grundgesetze des Kapitalismus defi- niert, konnte nur von einem Menschentyp vollzogen werden, der zur >innerweltlichen Askese« bereit war. In seinem vielbändigen Lebenswerk >Die menschliche Komödie< wird Balzac zum Porträtisten der bürgerlichen Gesellschaft, der unnachsichtig ihre Mängel und Unzulänglichkeiten bloßlegt. Vor allem in >Eugenie Grandet< hat er unser Wissen um den Geldtrieb oder die Geldgier des Bürgertums sehr bereichert. Balzac hat viele Geizkragen in seiner Romanserie abkonterfeit. Das ist vielleicht kein Zufall. Wer es unternimmt, die bürgerli- che Gesellschaft zu malen, wird oft auf den Typus des Geld- menschen stoßen. Daher darf der Geizige in einem Gesamtbild des bourgeoisen Zeitalters nicht fehlen. Balzac selbst sagt über diese Problematik: »Daraus erwächst vielleicht die fabelhafte Neugier, welche die Geizigen erregen... Jeder hängt durch einen Faden mit diesen Gestalten zusammen, welche alle
- 104
- menschlichen Gefühle berühren, indem sie sie alle zusammen- fassen. Wo ist der Mensch ohne Wünsche, und welcher soziale Wunsch läßt sich ohne Geld verwirklichen?« Wir folgen zunächst der Darstellung des Dichters, um zu erkennen, wieviel er von der Psychodynamik des Geizes begrif- fen hat. Balzacs Roman führt uns nach Saumur, einem kleinen französischen Städtchen. In Saumur liegt das Haus des Bött- chers Grandet, der mit seiner Frau und seiner Tochter Eugenie (die zu Beginn des Romans 23 Jahre alt wird) in behaglichen Umständen lebt. Grandet hat sich nach der Revolution von 1789 und im Kaiserreich tüchtig zu bereichern gewußt. Durch eine Anzahl geschickter Spekulationen ist er zu einem schwer- reichen Mann geworden. Er besitzt Weinberge, landwirtschaft- liche Betriebe, ein Schloß und sehr viel Geld. Aber davon merkt man seinem Lebensstil nichts an. Er, der sich aus kleinen Verhältnissen emporgearbeitet hat, lebt immer noch wie ein einfacher, armer Handwerker. In seinem dunklen, kargen Hau- se wird jede Ausgabe gescheut, denn der reiche und geizige Grandet kennt nur einen einzigen Wunsch: noch reicher zu werden. Diese Sucht verändert, wie Balzac weiß, Grandets physiogno- mischen Aspekt und seine Mimik: »Der Blick eines Menschen, der gewohnt ist, ungeheure Zinsen aus seinem Kapital zu ziehen, muß notwendigerweise wie der des Lüstlings, des Spielers oder des Höflings gewisse kaum definierbare Eigen- schaften annehmen: er wird gierig, lauernd, geheimnisvoll wie die Bewegungen dieser Menschen, die von ihren Gesinnungs- verwandten sehr wohl durchschaut werden.« Grandets Geiz führt auch dazu, daß er sogar sparsam mit Worten wird. Die Kampfstellung gegen die Umwelt wird durch ein den Zuhörer ermüdendes Stottern unterstrichen: auch beim Sprechen gibt der Geizkragen nur wenig oder gar nichts her. Da er immer alle Trümpfe in der Hand behalten will, kann er sich nie festlegen; seine Lieblingsredensarten sind: »Ich weiß nicht, ich kann nicht, ich will nicht, wir werden noch sehen.« Hören wir Balzacs Schilderung der Physiognomie dieses hartgesottenen, machtgierigen Menschentypus: »Die Augen hatten jenen star- ren, verschlingenden Blick, den das Volk den Basilisken zu- schreibt ... Das ganze Gesicht sprach von gefährlicher Schlau- heit, von Redlichkeit ohne Herzenswärme, von der Selbstsucht eines Menschen, der gewohnt war, jedes herzliche Gefühl
- 105
- auszuschalten, sich nur am Golde zu freuen und an dem einzigen Wesen, das etwas für ihn bedeutete, seiner Tochter Eugénie, der einzigen Erbin. Haltung, Manieren und Gang - alles bekundete diesen Glauben an sich selbst, der häufig Men- schen eignet, denen wenig fehlgeschlagen ist. Trotz seines unauffälligen, ruhigen Wesens hatte Herr Grandet einen ei- sernen Charakter.« Alles, was Grandet unternimmt, ist auf den Gesichtspunkt der Bereicherung hin orientiert. Die Ernährung im Hause, die Heizung im Winter, die Heiratspläne für die Tochter: alles ist in das Gelddenken einbezogen. Auch zum Geburtstag erhält Eugénie von Kindheit an immer dasselbe, nämlich ein seltenes Goldstück. Sie muß diese ständig wachsende Goldstück- Sammlung jeweils vorzeigen, wobei der Vater Stück für Stück wohlgefällig in die Hände nimmt. Auch Frau Grandet emp- fängt gelegentlich von ihrem Gatten ein >Nadelgeld< für ihre Näharbeiten; davon kann sie jedoch nur einen Teil für ihre Zwecke verwenden, den Rest >borgt< sich Grandet bald wieder, da er sich ständig knapp an Geld fühlt. Die Erzählung beginnt damit, daß die 23jährige Eugénie von zwei Bewerbern umschwärmt wird, die zur Geldaristokratie der Provinz gehören und die es vermutlich ebensosehr nach Grandets Vermögen wie nach der schüchternen und herben Eugénie verlangt. Die Chancen der beiden Provinzmagnaten schwinden jedoch dahin, als Eugénies Cousin aus Paris zu Besuch kommt. Dieser Sohn von Grandets Bruder, einem Pariser Finanzmann, wird nach Saumur geschickt, weil sein Vater Bankrott erklären muß - nach Saumur kommt dann auch die Nachricht, daß sich der Bankrotteur erschossen hat. Der junge Charles stößt zumindest bei den Frauen des Hauses Grandet auf Mitleid. Er ist nun völlig verarmt und soll nach dem letzten Ratschlag seines Vaters nach Indien fahren, um sich dort ein eigenes Vermögen zu erwerben. Grandet betrachtet den Zusammenbruch der Geschäfte seines Bruders als kühler Rechner; er findet sogar einen Ausweg, durch geschicktes Manipulieren den Ruf des Familiennamens zu retten, ohne einen Franken dafür zahlen zu müssen. In Eugénies dürftiges Leben fällt durch die Anwesenheit von Charles zum ersten Mal der Lichtstrahl der Liebe. Sie bewun- dert den großstädtisch gekleideten Cousin, der ihr an Lebens- kunst grenzenlos überlegen ist. Es entspinnt sich eine zarte
- 106
- Liebschaft zwischen den beiden jungen Leuten, die der Vater widerwillig duldet, da er ohnehin weiß, daß Charles in wenigen Tagen verreisen wird. Da der junge Mann gar keine Geldmittel mehr hat und auch von seinem reichen Onkel nichts erwarten darf, übergibt Eugénie heimlich dem Abreisenden alle ihre sorgsam gesparten Goldstücke. Sie empfängt hierfür ein zierli- ches, goldbeschlagenes Kästchen, gleichsam als Erinnerung und Pfand für einen kaum ausgesprochenen Liebesschwur- Charles soll eines Tages zurückkehren, und sie wird auf ihn warten. Nun setzt der Alltag in Saumur wieder ein. Eugénies Geburts- tag naht, und sie wird wieder ein Goldstück vom Vater empfan- gen. Bei dieser Gelegenheit will er sich wiederum den kleinen Schatz seiner Tochter zeigen lassen und erfährt das Ungeheuer- liche: Eugénie hat ihr Gold weggegeben. Die Mutter, die das zunächst zu hören bekommt, wird vor Schreck geradezu krank. Sie kennt ihren Gatten genau und weiß, was ihm Geld und Besitz bedeuten. Nun kann mit allen möglichen Tricks die Stunde der Goldstückschau wohl hinausgeschoben, aber nicht gänzlich eliminiert werden. Der alte Grandet wird bleich vor Wut und Ärger - er verurteilt seine Tochter dazu, bei Wasser und Brot auf Monate hinaus in ihrem Zimmer zu verbleiben. Frau Grandet, die kümmerlich jahrzehntelang neben ihrem gefühlskargen Mann dahingelebt hat, wird ob dieser Härte regelrecht schwerkrank und siecht dahin - einige Monate später stirbt sie. Grandet ist wohl erschüttert, aber sein Charakter ändert sich nicht. An dieser Stelle äußert Balzac eine feinsinnige psychologische Bemerkung, die es verdient, zitiert zu werden: »Er (Grandet) war nun im sechsundsiebzigsten Lebensjahr. Besonders seit zwei Jahren war es mit seinem Geiz viel schlim- mer geworden - es pflegt mit allen beharrlichen Leidenschaften so zu sein, daß sie ständig wachsen. Man kann bei Geizhälsen, bei maßlos Ehrgeizigen und bei allen andern Menschen, die ihr Leben unter eine einzige Idee stellen, immer wieder beobach- ten, daß sie ihr Herz an irgendein Sinnbild ihrer Leidenschaft hängen: Grandets Manie war der Anblick und Besitz des Goldes. Im selben Maße wie sein Geiz war auch seine Herrsch- sucht gewachsen.« Eugénie erbt von ihrem Vater ein Millionenvermögen, aber ihre Erziehung hindert sie daran, ihren Besitz zu genießen. In einer unglücklichen Ehe fallen ihr nochmals ein paar Millionen zu, so daß sie achthunderttausend Franken Rente zur Verfügung hat.
- 107
- Trotz dieses Reichtums lebt sie so karg, wie sie es immer gewohnt war. Heizen läßt sie nur an jenen Tagen, an denen auch ihr Vater erlaubt hatte, Feuer zu machen; und sie läßt die Heizung ausgehen - wie Balzac sagt - genau nach demselben »Programm, das in ihren jungen Jahren maßgebend war. Ange- zogen war sie wie ihre Mutter. Das Haus in Saumur, jenes Haus ohne Sonne, ohne Wärme, das dauernd im Schatten lag, immer düster und schwermütig aussah, war das Abbild ihres Lebens. - Sie häufte ihre Einkünfte sorgfältig zusammen und wäre manchem reichlich sparsam erschienen, wenn sie nicht aller bösen Nachrede durch gewaltige Spenden vorgebeugt hätte... Dieses edle Herz, das nur der wärmsten, innigsten Gefühle fähig war, wurde also geknickt durch Berechnungen und Geschäftsinteressen eigennütziger Menschen. Das Geld hatte seinen fahlen Glanz auf dieses fromme Dasein geworfen und in das Herz einer Frau, die nur Liebe kannte, die nichts als Liebe war, Mißtrauen gegen alle menschlichen Gefühle gesät.« So ist eigentlich Balzacs >Eugénie GrandeU sowie eine Studie über den Charaktertyp des Geizigen wie über das Geld und seine korrumpierende Funktion in der bürgerlichen Gesell- schaft. Differenzierte psychologische Beobachtungen wechseln sich in diesem Text mit romanhaft vorgetragenen Gesellschafts- analysen ab, die heute noch ihre Aktualität besitzen. Wie tiefgründig ist etwa jene Bemerkung über den alten Grandet: »Er ging zu keinem Menschen, wollte weder Besuch empfan- gen, noch Gastereien veranstalten, er machte niemals Lärm und schien mit allem zu sparen, selbst mit der Bewegung.« Man hat bei diesen wenigen Worten die ganze Phänomenologie des Geizes vor Augen. Aber der individuelle Geizhals kann nur verstanden werden vor dem Hintergrund einer Gesellschaftsordnung, die alle mensch- lichen Werte - Liebe, Großherzigkeit, Solidarität, schöpferi- sche Kraft - an den schnöden Mammon verrät. Wiewohl Balzac politisch reaktionär war (wie oft verherrlicht er in seinen Wer- ken Napoleon!), leistete er mit seiner »Comédie humaine« einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der bourgeoisen Welt, womit implizit auch Wege eröffnet werden, diese teilwei- se inhumane Gesellschaftsstruktur zu überwinden. Wir vereh- ren in Balzac einen der größten Romanschriftsteller der Neu- zeit. Als Menschenschilderer ist er stellenweise unübertroffen.
- 108
- Dostojewski, ihm in der erzählerischen Kraft ebenbürtig und in der psychologischen Charakterdurchdringung noch überlegen, hat >Eugénie GrandeU ins Russische übersetzt. 1838 schrieb er an seinen Bruder, er habe fast den ganzen Balzac gelesen. Dabei fallen die bewundernden Worte: »Balzac ist groß. Seine Cha- raktere sind Schöpfungen eines weltumfassenden Geistes! Nicht der Zeitgeist, sondern ganze Jahrtausende haben in ihrem Ringen in der Seele des Menschen eine solche Entwicklung und Lösung gezeitigt!«
- 109
- Irmgard Fuchs
- Neid
- Sieht man sich in der Literatur nach ausführlichen Abhandlun- gen über den Neid um, so stellt man fest, daß er aus zweierlei Gründen verschwiegen wird: einmal ist er, ganz im Gegensatz zu Eitelkeit oder Geiz, einer der bestverborgenen Charakterzü- ge, zum anderen scheint eine gewisse Scheu zu bestehen, sich intensiver mit ihm zu befassen. Nietzsche hat bereits in seinem Buch >Menschliches, AllzHmenschliches< den Neid, zusammen mit der Eifersucht, als >Schamteil< der menschlichen Seele be- zeichnet. Dennoch zahlt diese Eigenschaft, das zeigt die psy- chotherapeutische Praxis immer wieder, zu den am weitesten ver- breiteten >Lastern<. Alle Autoren, abgesehen von dem Soziologien Schoeck (>Der Neid und die Gesellschaft), der im Neid eine »anthropologische Grundkategorie< sieht, die soziales Zu- sammenleben erst ermöglicht, reihen den Neid unter die Un- tugenden ein. Der Frage, warum die Diskussion darüber vor allem auch in der Tiefenpsychologie, die als erste den neuroti- schen Menschen systematisch erforschte, nicht vertieft wurde, kann hier nicht nachgegangen werden. Faktisch hat sie es jedoch bis heute versäumt, die Erkenntnisse angrenzender Dis- ziplinen wie der philosophischen Anthropologie und der hu- manistischen Ethik zu assimilieren. So darf es nicht verwun- dern, daß die tiefenpsychologischen Darstellungen über Ursa- chen, Sinn und Abbau von Neid lückenhaft bleiben und manchmal schmalspurig anmuten. Einen guten Einstieg in das Thema ermöglichen die französi- schen Moralisten La Rochefoucauld (1630-1680), La Bruyere (1645-1696), der niederländische Philosoph Baruch de Spinoza (1632-1677) und schließlich der kritische deutsche Denker Friedrich Nietzsche (1844-1900). Es ist ein wahrer Genuß, ihre scharfsinnigen Beobachtungen und differenzierten Beschrei- bungen menschlicher Tugenden und Laster nachzuvollziehen. Selbst wenn diese Abhandlungen nicht immer vollständige
- 110
- Theorien beinhalten, sind sie außerordentlich lehrreich. Zum bereits eingangs erwähnten Stillschweigen über neidische Tendenzen sagt La Rochefoucauld, der Mensch prahle oft mit seinen verbrecherischen Leidenschaften, der Neid aber sei scheu und verschämt; ihn zu zeigen, wage niemand. Nietzsche schreibt über Neid mit und ohne Mundstück: - Der gewöhnliche Neid pflegt zu gackern, sobald das beneidete H u h n ein Ei gelegt hat: er erleichtert sich dabei und wird milder. Es gibt aber auch einen noch tieferen N e i d : der wird in solchem Falle totenstill, und wünschend, daß jetzt jeder M u n d versiegelt würde, immer wütender darüber, daß dies gerade nicht geschieht. D e r schweigende N e i d wächst im Schweigen. 1
- Wird der Neid auch versteckt und verschwiegen, so gibt es doch Möglichkeiten, ihm auf die Spur zu kommen. Einen Hinweis auf ein äußeres Erkennungsmerkmal gibt der allgemei- ne Sprachgebrauch, wenn er davon spricht, ein Mensch würde gelb oder blaß vor Neid. Er zeigt damit, daß der Neid den ganzen Menschen erfaßt und ihn bereits an der Gesichtsfarbe >verrät<. Aber ein Merkmal reicht nicht aus; es müssen zahlreiche Mo- saiksteinchen zusammengetragen werden, um ein umfassen- deres Bild zu vermitteln. Nietzsche empfiehlt, bei der Beurtei- lung des Charakters eines Menschen einen Blick auf sein Umfeld, seine zwischenmenschlichen Beziehungen zu werfen. Der Mangel an Freunden, so führt er aus, lasse auf Neid oder Anmaßung schließen. Mancher verdanke seine Freunde nur dem Umstand, daß er keinen Anlaß zum Neid habe. In >Die fröhliche Wissenschaft entfaltet er feinsinnig die Struktur des Neidholds vor unseren Augen: man dürfe diesem keine Kinder wünschen, da er selbst auf sie neidisch sein würde, und zwar allein aus dem Grunde, nicht mehr Kind sein zu dürfen. Auch hat der Autor erkannt, daß der Neidische nur im Abstand zu seinen Mitmenschen neidisch bleiben kann. Er schreibt in >Morgenröte<: »Sich irren wollen. - Neidische Menschen mit feiner Witterung suchen ihren Rivalen nicht genauer kennenzu- lernen, um sich ihm überlegen fühlen zu können« (S. 210). La Bruyère nennt als weiteres Charakteristikum des Neidischen dessen Unfähigkeit, an der Freude anderer teilzunehmen. Wie bereits angeklungen, tritt der Neid niemals isoliert in Erscheinung, sondern stets in Begleitung anderer aggressiver
- in
- Affekte, von denen Haß, Eifersucht, Rachsucht, Habgier, Selbstsucht, Schadenfreude und Mißgunst die am häufigsten erwähnten sind. Adler bezeichnet diese Charakterzüge als die trennenden, und Fromm hat dafür den Begriff lebensfeindliches Syndrom gewählt. Die Herkunft des Wortes Neid ist unklar. Bekannte, bedeu- tungsverwandte Ausdrücke weisen in Richtung auf feindselige Gesinnung, Kampf, Streit, Haß usw. Ursprünglich war mit Neid wohl Eifer, Wetteifer oder Anstrengung gemeint, mögli- cherweise im Sinne von >niederkriegen, befehden, schmähen<. (Kluge, >Etymologisches Wörterbuch<) Die Verbindung von Neid und Haß stellt auch Spinoza in seiner >Ethik< vor. Für ihn ist Neid eine »Leidenschaft des Gemiitss durch die das Handlungsvermögen des Körpers ver- ringert wird. Neid oder Mißgunst bedeuten nichts anderes als Haß, »insofern (sie) betrachtet (werden) als den Menschen so disponierend, daß er sich über das Unglück eines anderen freut und sich über dessen Glück betrübt«. La Rochefoucauld bringt dem Neid weniger Verständnis entgegen als dem Haß und der Eifersucht. Er meint, Eifersucht sei in gewissem Sinne zu rechtfertigen, da sie ja versuche, das Unsere oder was wir für das Unsere halten zu verteidigen. Neid aber sei Wut über den Besitz anderer. Für La Bruyère gibt es keine Eifersucht ohne Neid, wohl aber Neid ohne Eifersucht und zwar als Leiden- schaft, die das Unerreichbare in unserer Seele erregt wie z.B. großes Vermögen, eine erstrebenswerte Stellung u.a.m. Den Neid, oft Hintergrund von Gier und Selbstsucht, hat Nietzsche in seinem >Zarathustra< als krankhafte Lebenshaltung beklagt:
- Eine andere Selbstsucht gibt es, eine allzu arme, eine hungernde, die immer stehlen will, jene Selbstsucht der Kranken, die kranke Selbst- sucht. Mit den A u g e n des Diebes blickt sie auf alles Glänzende; mit der Gier des Flungers mißt sie den, der reich zu essen hat: und immer schleicht sie um den Tisch des Schenkenden. Krankheit redet aus solcher Begierde und unsichtbare Entartung: vom siechen Leibe redet die diebische G i e r dieser Selbstsucht. 2
- Die psychologische Forschung bestätigt auch die Feststellung La Rochefoucaulds, daß der Neid das Glück des Beneideten meist überdauert, d.h., daß der Neidische die Begünstigung des Mitmenschen fast immer überschätzt.
- 112
- Sicherlich sind jedem Menschen Neidregungen bekannt, nie- mand ist in einer Konkurrenzgesellschaft frei davon; entschei- dend jedoch ist, was er daraus macht: und der Neidische tut nichts, um seine Situation zu verändern oder zu verbessern, so daß Passivität als weiteres Wesensmerkmal festgestellt werden kann. Der neidische Mensch sitzt still in seiner Ecke, grollt und stempelt sich auf diese Weise selbst zum Objekt. Obwohl er dabei nach und nach verkümmert, schafft er den Schritt aus seiner Ohnmachtsposition nicht allein. Sein geringes Selbst- wertgefühl und seine mangelnde Ichstärke lassen ihn ans Leben einen Maßstab anlegen, der ihm ständig beweist, daß er nichts, der andere aber alles hat.
- Tiefenpsychologie des Neides
- Wie die verschiedenen tiefenpsychologischen Schulen zum Phänomen Neid Stellung beziehen, soll im Folgenden unter- sucht werden. Freud, der Begründer der Psychoanalyse, legt die Entstehung des Neids, den er vorwiegend der Frau zuordnet ( Penisneid ), in die dritte Phase der kindlichen Entwicklung, in die >phallische< oder >ödipale<, die den Zeitraum zwischen dem 5. und 6. Lebensjahr umfaßt. Bis dahin gibt es seiner Auffassung nach für Jungen und Mädchen nur ein Geschlecht, und zwar das männli- che. In dieser Phase wird sich das Mädchen plötzlich der Tatsache bewußt, daß es >zu kurz< gekommen ist, weil es keinen Penis vorzuweisen hat, den es beim Jungen angeblich so sehr bewundert. Auch der Junge nimmt diesen fundamentalen Mangel beim Mädchen wahr und erschrickt, da er annimmt, das Mädchen sei kastriert worden und ihm drohe das gleiche Schicksal. Aus Angst davor entwickle er >eine anhaltende Ge- ringschätzung der Frau< (Chasseguet-Smirgel). Selbst im Ver- langen des Mädchens, lieber ein Junge sein zu wollen, glaubt Freud den Wunsch nach einem Penis wiederzuerkennen. So- wohl Adler als auch Horney, Fromm u.a. bezweifeln jedoch, daß es sich dabei um eine angestrebte Veränderung der Anato- mie handelt, sondern vermuten, daß das Mädchen viel eher neidisch sei auf die Bevorzugung des männlichen Geschlechts in einer patriarchalischen Kultur. Sogar aus den Reihen der Psychoanalytiker sind Stimmen laut geworden, die an der
- 113
- traumatischen Wirkung, die vom Anblick des männlichen >Kleinods< ausgehen soll, Zweifel anmelden. In der narzißtischen Wunde, die der Penismangel hinterläßt, wurzele das grundsätzliche weibliche Minderwertigkeitsgefühl, das Folge der Verachtung für das eigene unvollständige Ge- schlecht sei. Der Groll des Mädchens richte sich nun gegen die Mutter, die beschuldigt wird, es so mangelhaft ausgestattet zu haben, und geht dann in Geringschätzung über, da ja auch sie zu den >Kastrierten< gehört. Wenn der Wunsch des Mädchens nach einem Penis zugunsten des Wunsches nach einem Kind aufgegeben werden kann, verläuft seine Entwicklung normal, denn es beginnt, seiner Geschlechtsrolle gerecht zu werden. Zuerst möchte es dem Vater ein Kind schenken; da diese Aufgabe aber bereits der Mutter zugefallen ist, entstehen gegen sie massive Eifersuchts- und Rivalitätsgefühle. Schließlich sieht das Mädchen jedoch die Aussichtslosigkeit seines Verlangens ein und schickt sich in sein Los. Freud sieht den Höhepunkt des Frauseins in der Geburt eines Sohnes, womit er eines der Vorurteile seiner Zeit unreflektiert übernimmt. Obwohl er zugesteht, daß Eifersucht nicht nur bei der Frau zu beobachten sei, hält er sie bei ihr für fundamentaler als beim Mann, da sie der Penisneid ständig mit frischer Energie versorge. So hat der große Tiefenpsychologe, der zwar ein- räumte, in bezug auf die Psyche der Frau im dunkeln zu tappen, sie mit seiner Stellungnahme zu einem verunglückten, kastrierten >Mann< gemacht und ihre Anatomie zu ihrem Schicksal erklärt. Neid, Eifersucht, Infantilismus, Dominanz- streben, mangelndes Gerechtigkeitsgefühl und ein Uberwiegen gefühlsmäßiger Entscheidungen vor verstandesmäßigen sowie Passivität seien charakteristisch für die Psyche der Frau. Selbst ihr Wunsch nach Unabhängigkeit und Gleichberechtigung scheint, durch die patriarchalische Brille betrachtet, nur Aus- druck des ursprünglichen Penisneids zu sein. Hat Freud als außergewöhnlich scharfer Beobachter bezüglich weiblicher Verhaltensweisen durchaus Richtiges festgestellt, so ist es ihm jedoch nicht gelungen, die Gründe dafür in den damals herr- schenden gesellschaftlichen Gegebenheiten zu erkennen. Auf Grund dieses Irrtums verabsolutierte er die oft neurotischen Frauen seiner Zeit, um die »weibliche Natur< zu enträtseln. Analog fehlschließend nahm er den Neid des älteren Kindes auf die nachfolgenden Geschwister als >naturgegeben< an; eigentlich
- 114
- möchte das Ältere das Nachgeborene verletzen und verstoßen; allein die Angst vor Bestrafung und die Einsicht, daß auch dieses Kind von den Eltern geliebt wird, hält es von seinem Vorhaben ab und zwingt es, sich mit ihm zu identifizieren. So entsteht Gemeinschafts- oder Zusammengehörigkeitsgefühl erst als Reaktionsbildung auf Neid. Arno Plack (>Die Gesell- schaft und das Böse<) stellt in diesem Zusammenhang die Frage, ob die angeblich unvermeidliche Rivalität zwischen Geschwi- stern nicht eine andere Ursache haben könne, nämlich die so große
- Freude der Eltern am jeweils niedlicheren Kinde. Das Kind, das unversehens wegen dem so niedlichen neuen sich zurückgesetzt fühlt, muß zwangsläufig das Neugeborene hassen. Eltern, die in jedem ihrer Kinder den ganzen Menschen liebten, der es eigentlich werden soll, würden quasi >instinktiv< den Fehler der Zurücksetzung des älteren Kindes vermeiden. 3
- Melanie Klein, eine umstrittene Vertreterin der britischen Psy- choanalyse, geht noch einen Schritt über Freud hinaus und erklärt Neid, Gier und Haß als konstitutionell gegeben. Haben die angeborenen kannibalischen Triebe im Menschen die Ober- hand über die ebenfalls angeborenen libidinösen, so ist die Charakterentwicklung von vornherein in ungünstige Bahnen gelenkt. Den Penis des Vaters fordere das Mädchen nicht als Korrektur an ihrer Anatomie, sondern als Objekt oraler und genitaler Befriedigung. Für Chasseguet-Smirgel, die der Klein- schen Schule nahesteht, ist der Penisneid Ausdruck des Neids auf die omnipotente Mutter, von der man sich nur unabhängig machen und gegen die man sich nur behaupten kann, wenn man etwas besitzt, was ihr fehlt. Nach Kleins Theorie von der Entwicklung des Menschen und der Entstehung von Neid zeigt ein Kind bereits im Säuglingsalter unmenschliche Züge, und man ist reichlich verwundert darüber, daß sie dennoch an Veränderungen in der Therapie glaubt und solche auch vorzu- weisen hatte. Mit der Annahme angeborener aggressiver Triebe als bestim- mend für die Charakterentwicklung steht sie auf dem Boden einer autoritären Ethik, wonach der Mensch von Geburt an determiniert und seiner >bösen Natur< ausgeliefert ist. An diesen abstrusen Spekulationen ist auch Kritik von psychoana- lytischer Seite geübt worden, u.a. von Glover, der Klein
- 5
- »biologischen Mystizismus< vorwirft. Geistige Verwandtschaft besteht dagegen zwischen ihr und dem Soziologen Schoeck, für den der Neid zur »biologischen Grundausstattung< des Men- schen gehört. In Anlehnung an die Tierverhaltensforschung postuliert er angeborene Aggressionskräfte, die den Neid spei- sen. Bezeichnet der überwiegende Teil der Autoren Neid als Krankheit, die die zwischenmenschlichen Beziehungen stört oder gar unmöglich macht und daher den Menschen in seiner gesamten Existenz beeinträchtigt, so geht Schoeck davon aus, daß das Individuum erst über die Neidfähigkeit zum »eigentli- chen Menschern werde. Adler und Horney halten andere Ursachen für maßgebender. Beide bezweifeln eine angeborene aggressive Triebstruktur und die Konkordanz biologischer und charakterlicher Entwicklung. Horney kritisiert die von Freud auf Grund des Penismangels vertretene »Minderwertigkeit der Frau< und hinterfragt die Be- deutung des Ödipuskonflikts für die Ausprägung neidischer Strebungen. Ihrer Erfahrung nach ist nicht der Penisneid für den Charakter der Frau bestimmend, sondern eine Erziehung, die vom Wertsystem einer patriarchalischen Kultur geprägt ist. Dieser Auffassung schließt sich auch Simone de Beauvoir (>Das andere Geschlecht) an, wenn sie den Phallus nur als Symbol männlicher Vorrechte deutet, die zwangsläufig den Neid des Mädchens erregen müssen. Die Basis für den Neid ist bei Horney die Grundangst, gegen die sich das Kind zu schützen versucht, indem es sie mit dem Streben nach Macht kompen- siert. Habgier, Haß, Herrschsucht, Demütigung, Dominanz, Konkurrenz und Feindseligkeit sind Ausdrucksweisen dieses Strebens. Ahnlich wie Plack sieht Horney die westliche Welt bestimmt von der Jagd nach Erfolg, Prestige, Besitz und Be- wunderung. Sie weist darauf hin, daß der Mensch sich dadurch immer weiter von seinen Mitmenschen entfernt und sich ihnen entfremdet. Da er sich ein Miteinander nicht zutraut, wählt er den Weg, sich über sie zu erheben. Der Konkurrenzkampf, getragen vom Neid auf die anderen, beherrscht jedoch nicht nur die beruflichen, sondern auch die privaten Beziehungen. Sadismus, für Klein naturgegeben, stellt für Horney lediglich ein Symptom dar, das zur neidischen Gefühlshaltung gehört. Ihrer Meinung nach entwickelt nur ein Mensch, der von der Sinnlosigkeit des eigenen Lebens überzeugt ist, sadistische Ten- denzen. Er haßt alles Positive mit dem Neid dessen, der das
- ii 6
- Ziel seiner Wünsche nicht erreichen kann. »Es ist der bittere, mißgünstige Neid eines Menschen, der das Gefühl hat, daß das Leben ihn ausgeschlossen hat.« Da er von den anderen abrückt, kennt er sie nicht und überschätzt deren Glück. Er kann es ihnen nicht gönnen, weil er selbst unfähig ist, glücklich zu sein. So bleibt ihm nur der Ausweg, andere zu demütigen und zu beherrschen. Eine Möglichkeit jedoch hat er, seinen Neid zumindest kurzfristig zu mildern: er kann das Beneidete abwer- ten. Horney wählt als Beispiel den Fuchs aus der Fabel >Der Fuchs und die Weintrauben< von Jean de la Fontaine (1621-1695), der die Trauben als sauer bezeichnet, weil sie zu hoch hängen und er sie nicht erreichen kann. Dennoch, meint die Autorin, bleiben sie weiterhin für ihn erstrebenswert. Mit Nietzsche ist sie der Ansicht, daß der Neidische seine Mitmen- schen überwiegend nicht einer bestimmten Sache wegen benei- det, sondern daß es sich dabei um >Lebensneid< handelt, der tiefer geht und grundsätzlicher ist. Der Neidische fühlt sich vom Leben abgeschnitten, seine Lebensfreude ist aber nur gedrosselt, nicht erloschen. Der Penisneid als solcher spielt für Alfred Adler, den Begrün- der der Individualpsychologie, eine ähnlich untergeordnete Rolle wie für Horney. Das neidisch-rivalisierende Streben des Kindes sei nicht von sexuellem Verlangen bestimmt, sondern drücke symbolisch Besitzergreifen bereits neurotisierter Kinder den Eltern gegenüber aus. Adler warf Freud vor, die Persön- lichkeit, die hinter dem Sexuellen stehe, nicht berücksichtigt zu haben. Zu Beginn der Theorie vom Penisneid galt er als >männ- licher Proteste d.h. als Protest des Mädchens gegen eine Kul- tur, die Tüchtigkeit, Einfluß, Autorität, Aktivität und Macht nur dem Mann zugesteht, während Kinder und Frauen als minderwertig gelten. Der Gegensatz >männlich/weiblich< ent- spricht dem Schema >oben/unten<. Später engt Adler diesen Begriff jedoch ein und verwendet ihn nur noch, um die Haltung von Frauen zu beschreiben, die ihr Frausein nicht akzeptieren. Er ersetzt ihn durch das >Uberlegenheits- und Machtstreben*, war allerdings der Überzeugung, daß diese Haltungen sowohl für den Mann als auch für die Frau gelten. Kann ein Kind in der Kindheit nicht genügend Gemeinschaftsgefühl erwerben und seine natürlichen Minderwertigkeitsgefühle nicht als Ansporn für Wachstum verwerten, kommt es zu einer Fehlentwicklung. Das Minderwertigkeitsgefühl steigert sich zum Minderwertig-
- 7
- keitskomplex, der nach Kompensation verlangt. Werden kind- liche Neid- und Rivalitätsgefühle von den Erziehern nicht verstanden, sondern bestraft oder ignoriert, so verfestigen sie sich und arten zu einem unstillbaren Verlangen, alles haben zu wollen, aus. Da der Blick dabei zu sehr auf die vorgebliche eigene Mangelsituation gerichtet ist, können positive Eigen- schaften nicht ausreichend entwickelt und betätigt werden. Aggressive Charakterzüge überwuchern mehr und mehr das Gemeinschaftsgefühl, in deren Folge das Kind nicht Solidarität mit anderen, sondern Triumph über sie anstrebt. Adler zählt vor allem Neid, Eifersucht, Trotz, Haß, Ehrgeiz, Egoismus und Herrschsucht, aber auch Selbstverleugnung in Form auf- opfernder Güte, zu den Haltungen, die wir anfangs als >tren- nende< bezeichnet haben. Durch sie wird die Beziehung des Menschen zur Umwelt gestört, denn »ein zeitlebens von Neid erfüllter Mensch... (ist) für eine Zusammenarbeit unfrucht- bar«. Er wird immer nur einen Wunsch haben, nämlich, den anderen etwas wegzunehmen, sie zu schädigen und ihnen für all das, was er selbst nicht erreicht hat, die Schuld zuzuschieben. Der Zwang, sich ständig mit seinen Mitmenschen zu verglei- chen, trägt dazu bei, den Neidischen in seinem Gemütszustand zu belassen; da seine Vergleiche hinken und er seinen Mängeln die Stärken anderer gegenüberstellt, ist die ungünstige Bilanz von vornherein programmiert. Es sind also weder die Anatomie noch die Triebnatur des Menschen, die Adler für die Entstehung neidischer Züge ver- antwortlich macht, sondern die Erziehung, insbesondere aber die Erzieherpersönlichkeit, auf die das Kind jeweils individuell antwortet. In diesem Punkt ist er mit Nietzsche einig, der den Einfluß der Erziehung auf den Charakter folgendermaßen be- schreibt:
- M a n muß lieben lernen, gütig sein lernen, und dies von J u g e n d auf; wenn Erziehung und Zufall uns keine Gelegenheit zur Ausübung dieser E m p f i n d u n g e n geben, so wird unsere Seele trocken und selbst zu einem Verständnis jener zarten Empfindungen liebevoller Men- schen ungeeignet. Ebenso muß der H a ß gelernt und genährt werden, wenn einer ein tüchtiger Hasser werden will, sonst wird auch der K e i m dazu allmählich absterben. 4
- Schultz-Hencke, einer der wichtigsten >Neo-Psychoanalyti- ker<, diagnostiziert den Neid als eine Haltung, die zwar von
- 118
- allen Menschen verworfen wird, aber dennoch allen eigen ist. Er unterscheidet zwischen einem positiven >glühenden< Neid, der zu Aktivität und Aufbau anspornt und einem negativen zerstörerischen >scheelen< Neid. Auch bestätigt er, daß der Neid verborgen ist, und meint, daß er sogar dem Neidischen selbst um so mehr verborgen bleibt, je stärker er ausgeprägt ist. Wenn der Therapeut aber Nebengedanken, Träume und Phan- tasien des Neidischen untersucht, erhält er ein plastisches Bild dieses kaptativen Charakterzugs, d.h. desjenigen, der auf >Al- les-haben-Wollen* ausgerichtet ist. Die Entstehung von Neid führt Schultz-Hencke zum Großteil auf eine Erziehung zurück, die durch eine Kombination von Verwöhnung und Härte gekennzeichnet ist. Einerseits lähmen Eltern die Expansion ihres Kindes durch Überbesorgtheit, nehmen ihm jede Pflicht und jede Verantwortung ab, anderer- seits schüchtern sie es durch Warnungen, Ge- und Verbote, Strafen und Strafandrohungen ein. Vor allem die Bedrohung durch Liebesverlust in Form von Schlägen, abschätziger Kritik und Nichtbeachtung, machen dem Heranwachsenden deutlich, daß bestimmte Expansionsschritte nicht erwünscht sind. Der aus solch unsachgemäßer Erziehung hervorgehende inaktive Mensch entwickelt schließlich überhöhte Erwartungen. Wer kaptativen Riesenerwartungen unterliegt, verlangt mehr oder minder bewußt, daß die Mitmenschen seine Erwartungen erfül- len. Das bedeutet nichts anderes, als daß er sie zum Zweck der eigenen Befriedigung mißbraucht. Diese Tendenz untersuchte auch Erich Fromm in >Psychoanalyse und Ethik< und reihte sie unter die nicht-produktive Orientierung ein, da sie mehr auf Nehmen als auf Geben eingestellt ist. Neid und Aggression stehen nach Schultz-Hencke in enger Beziehung zueinander. Er vergleicht sie mit zwei verbundenen Linien und beschreibt die Aggression als Druck, der nach außen will und die >seelische Oberfläche* ausbeult. Trotz ihrer Heftigkeit sei die Aggression dem Bewußtsein in dieser Deut- lichkeit nicht zugänglich, da Angst zu ihrer Abwehr erzeugt werde; es käme lediglich zu einem diffusen Gefühlseindruck. Der Inhalt kaptativer Züge bleibe der Vorstellung aber mehr oder weniger erhalten. Zerstörerischer Neid richtet sich, wie bereits erwähnt, nicht nur auf den Besitz von Sachen, sondern nach Schultz-Hencke vor allem auch >auf das feinere Erleben des Glücklichseins<,
- 119
- d.h. auf Gefühlsinhalte, die tatsächlich einen höheren Wert darstellen als Dinge. Der Autor wirft außerdem noch die Frage auf, warum Neid denn von allen als verwerflich angesehen und moralisch verur- teilt werde, und findet zwei wichtige Gründe: zum einen ist es eine bekannte Tatsache, daß kaptative Bestrebungen allgemein stärker verurteilt werden als z.B. retentive, wie sie in der Eifersucht zum Tragen kommen. »Wer hat, der darf eher behaltenwollen, als derjenige habenwollen darf, der noch nicht hat« (>Der gehemmte Mensch<, S. 159). Diese Überlegung fand sich schon bei La Rochefoucauld. Der Neidische wird äußer- lich zum Ruhestörer, während der Eifersüchtige (scheinbar) bemüht ist, Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Zum anderen will sich der Neidische den natürlichen Gegebenhei- ten, die zu Erfolg und Fortschritt führen, nicht unterordnen. Er tut so, als gäbe es Erfolg ohne Arbeit und ohne Anstrengung und erwartet, daß all seine Wunschträume Wirklichkeit wer- den. Damit stellt er eine Versuchung für andere dar, sich ähnlich zu verhalten. So ist die heftige Abwehr gegen den Neidischen und seine Ideologie zu erklären. Der Erkenntnis Schultz-Henckes, daß der Neidische eigene Lebensregeln aufstellen will, die mit der Realität nicht verein- bar sind, kann die Tiefenpsychologie allein nicht gerecht wer- den. Hier geht es nicht mehr um einzelne Charaktereigenschaf- ten, deren Ursachen herausgefunden werden sollen, sondern um die Frage nach der menschlichen Natur, dem Akzeptieren menschlicher Möglichkeiten und Grenzen, auf die später noch eingegangen werden soll. Der Neidische lehnt normal-menschliches Streben, das nur in kleinen Schritten erfolgreich sein kann, ab und fordert Über- menschliches für die eigene Person. Die Verbissenheit, die er dabei an den Tag legt, das Festhalten am Gefühl der eigenen Wertlosigkeit auf der einen, den Gottähnlichkeitswünschen auf der anderen Seite, verstärken seine Resignation und begraben damit seine Hoffnung auf Glück und Zufriedenheit. Seine Riesenerwartungen hindern ihn weitgehend daran, sinnvoll zu handeln. Aber das ist nicht alles: auf der anderen Seite geht er Fehlern, Irrtümern und Mißerfolgen aus dem Weg, mit denen jeder aktive Mensch konfrontiert wird. Aus diesem vermeintli- chen Versagen anderer leitet der Neidische für sich das Recht ab, über die Mitmenschen zu triumphieren, denn er macht
- 120
- schließlich keine Fehler! Dabei verzichtet er allerdings auch auf die wichtigen kleinen Erfolgserlebnisse, die das Ich, die Selbst- achtung des Lernenden, stärken. Der Neidische, sagt Adler, verteidige sein Nichthandeln immer mit Ausflüchten; Schultz-Hencke ist der Ansicht, daß er im Innern doch ahnt, daß sein Unwohlsein und sein Stagnieren mit ihm selbst zu tun haben. Er projiziert die eigene >Schuld< auf die anderen, um sie an ihnen bekämpfen zu können und um sich gleichzeitig ein Alibi dafür zu verschaffen, nicht näher mit ihnen in Kontakt treten zu müssen.
- Neid und menschliche Natur
- Betrachtet man die Ausführungen der verschiedenen tiefenpsy- chologischen Schulen, stößt man auf Begriffe wie: Charakter, Ich, Trieb, Persönlichkeit, Objekt, Neurose, Syndrom, Krank- heit usw. und kann sich, je nach eigenem Wissen, ein Bild davon machen, was darunter zu verstehen sei. Im Alltag jedoch haben wir es weder mit >Objekten< noch mit >Charakteren< oder >Triebbündeln< zu tun, sondern mit Personen. Die menschliche Person mit all ihren Befindlichkeiten, Eigenschaften, Entwick- lungsmöglichkeiten, Handlungen und Wertmaßstäben ist Ge- genstand der philosophischen Anthropologie und der humani- stischen Ethik. Diese Disziplinen integrieren die Teilergebnisse der Tiefenpsychologie zu einem Ganzen und heben die Sonder- stellung des Menschen als >Kulturwesen< innerhalb der Natur hervor. Weitreichende Erkenntnisse über die Person in ihrer Totalität, ihrem Wesen und ihrer Stellung in der Welt haben wir, neben den bereits erwähnten Autoren, auch Nicolai Hartmann und Philipp Lersch zu verdanken. Hartmann schreibt: Im Leben pflegen wir diese Einheit des geistigen Einzelwesens als >Person< zu bezeichnen. Wir unterscheiden sie damit schon im Alltag von der Sache, dem Organismus, ja dem Seelenleben und dem Be- wußtsein. Unter Personen verstehen wir die menschlichen Individuen, sofern sie als Handelnde, Redende, Sollende und Strebende, als Ver- treter ihrer Meinungen, Einsichten, Vorurteile, als Wesen mit Ansprü- chen und Rechten, Gesinnungen und Wertungen irgendwie Stellung nehmen. 5
- Person ist mehr als Ich, mehr als Subjekt, mehr als Individuum.
- 121
- Nach Josef Rattner (> Tiefenpsychologie und Ethik<) versteht man unter Ich meist das Zentrum des Bewußtseinsfeldes, den be- wußten Aspekt der Person; mit Subjekt ist die Person gemeint, die den Objekten gegenübersteht, und Individuum ist der einzelne, sowohl der Mensch als auch das Tier. Der Charakter verweist auf das Verhältnis des Menschen zu sich selbst und zu den Mitmenschen, er ist gewissermaßen die soziale Außenseite der Person. Als Persönlichkeit bezeichnet man einen Men- schen, der kraft seiner Beziehungsfähigkeit und Wertverwirkli- chung überdurchschnittlich stark entwickelt ist. Das Ich der Person ist nach Hartmann immer: »ich handle«, nicht: »ich denke«. Erst handelnd wird der Mensch zur Persön- lichkeit. Er findet bestimmte Umstände vor und gerät immer wieder in Situationen, die er nicht verändern kann: Krankheit, Verlust, Niederlagen, Tod usw. Dennoch ist er als einziges Lebewesen in der Lage, Stellung zu beziehen und Entscheidun- gen zu treffen; nach Sartre ist er dazu sogar >verdammt<. Dabei ist zu beachten, daß Unentschlossenheit und Entscheidungs- schwäche ebenfalls Stellungnahmen sind. Wenn der Neidische die Beziehung zu seinen Mitmenschen scheut oder lockert und nichts tut, um sie zu verbessern, so spricht diese Passivität eine deutliche Sprache: indem er sich gegen die Verbindung zu den anderen entscheidet, leugnet er gleichzeitig die Grundlage sei- ner Existenz als Person, denn Person ist der Mensch immer nur in seinem Bezug zur Welt. Er hat Teil an ihr und ist in gleicher Weise Teil von ihr. Person und Welt sind nach Hartmann untrennbar miteinander verbunden und ihr Verhältnis ist ein zweifaches: zum einen steht die Person als Ich (Subjekt) dem Nicht-Ich (Objekt) gegenüber, zum anderen als Ich dem Du, also einem anderen Ich. Erst durch die Existenz des Du wird der Mensch zum Ich und zur Person. Sullivan vertrat die Meinung, das Ich eines Menschen sei die Summe seiner zwi- schenmenschlichen Beziehungen. Der Gedanke, daß es der andere Mensch ist, der für den Menschen die größte Bedeutung hat, findet sich auch bei Spinoza: »... denn dem Menschen ist das am nützlichsten, was mit seiner Natur am meisten überein- stimmt, d.h. . . . der Mensch« (>Ethik<y S. 507). Seine Natur ist dem Menschen nicht gegeben wie dem Tier, sondern sie ist ihm aufgegeben. Er muß sich selbst gestalten durch seinen und in seinem Bezug zur Welt, und sein Dilemma besteht nicht, wie die autoritäre Ethik zu beweisen versucht, in
- 122
- seiner naturgemäßen Bösartigkeit, sondern in seiner Eigenver- antwortlichkeit. An diesem Punkt wird auch der Irrtum des Neidischen sicht- bar: die Weltferne, die Entfremdung von den Mitmenschen, die Leugnung der Selbstverantwortlichkeit und der Fähigkeit zur Eigengestaltung lassen ihn ständig um sein >Zu-kurz-gekom- men-Sein< und sein >Nicht-Haben< kreisen. Welt und Menschen interessieren ihn nur insofern, als er sie braucht, um sie be- kämpfen zu können. Die mangelhafte Lebensgestaltung des Neidischen zeigt, daß er in seiner Entwicklung zur Person steckengeblieben ist und den Weg zu den anderen nicht gefun- den hat. Bei Fromm ist Neurose das Ergebnis eines moralischen Kon- flikts und Ausdruck eines Kampfes, den der gesunde Teil der Persönlichkeit gegen schädigende Einflüsse aufnimmt. >Mora- lisch< heißt hier nichts anderes als >dem Menschen gemäß< oder >menschlich<. In diesem Sinne könnte man die Bitterkeit, die der Neid im Individuum hinterläßt, als Signal dafür werten, daß es sich gegen seine Natur vergeht. Wenn seelische Krank- heit und Laster zusammengehören, so müssen auch seelische Gesundheit und Tugend gleichzusetzen sein. Die Grundlage der Tugend, meint Spinoza, sei das Bestreben, das eigene Sein zu erhalten, zu handeln und sich auf die Welt zuzubewegen, um sich selbst zu finden. Da der Neidische sich gegen dieses Grundprinzip menschlicher Existenz auflehnt, verstößt er da- mit gegen sein Menschsein. Die meisten Autoren sind davon überzeugt, daß er den falschen Weg beschreitet, wobei Fromm als Kriterium für richtig oder falsch nur das Wohl des Men- schen als Maßstab akzeptiert. Die humanistische Ethik vertritt den Standpunkt, daß der Mensch von Natur aus die Fähigkeit besitzt, zwischen gut (richtig) und böse (falsch) zu unterschei- den. Läßt man ihm genügend Freiraum, wird er danach stre- ben, seine Persönlichkeit zu entfalten und sie in Verbindung mit der Umwelt zu formen. Sind die Bedingungen jedoch ungünstig, so besteht die Gefahr, daß er sich auf sich selbst zurückzieht und auf gesellschaftlich unwichtige Werte fixiert bleibt. Das häufige Auftreten von Neid, Eifersucht, Eitelkeit u. a. m. weist darauf hin, daß eine sinnvolle und menschenwür- dige Lebensgestaltung schwierig ist. Neben Weltbezug sind noch Ganzheit und Identität grundle- gend für das Person-Sein. Was bedeutet nun Ganzheit? Nach
- 123
- Hartmann handelt es sich dabei nicht um die Summe einzelner Akte, sondern um die einheitliche Stellungnahme des Individu- ums zur Welt und zur eigenen Existenz. Diese Stellungnahme entspringt aber nicht allein einer augenblicklichen Stimmung, sondern sie spiegelt das Bekenntnis des Menschen zu sich als Gewordenem, Seiendem und Werdendem wider. Alle Lebens- äußerungen bilden eine Struktur, in der körperliche, seelische und geistige Befindlichkeiten sinnvoll ineinandergreifen. Jede Einzelbestrebung ist Ausdruck der Einheitlichkeit der Person: . . . von jedem Detail läßt sich das Ganze erschließen, aber auch der partikuläre B e f u n d ist nur aus der Totalität heraus deutbar. A u c h die rein biologischen Reaktionen fallen nicht aus dem Rahmen der Person: auch sie sind sinnhaft und haben ihre Funktion innerhalb des Person- seins. 6
- Der Begriff der Struktur geht auf Felix Krüger (1874-1948) zurück, der sie definiert als ganzheitliches Gefüge von psychi- schen Dispositionen. Auch Lersch betont den Integrationszu- sammenhang der einzelnen Charakterzüge, durch den be- stimmte andere Bestrebungen ausgeschlossen werden. Wenn man sich an die den Neid begleitenden Tendenzen erinnert, kann man davon ausgehen, daß sie eine Struktur bilden, in der Güte, Engagement, Sympathie, Mut, Wohlwollen, Humor u.a. keinen Platz haben. Da der Werdensaspekt unzweifelhaft zur Ganzheit gehört, muß mit Hartmann beim Neidischen >Halbheit< konstatiert werden: er lebt nur begrenzt, weil er nur begrenzt handelt; er will ein Ziel, jedoch nicht den Weg dazu; er will haben, aber nicht erwerben; er lehnt die Verantwortung für sein Leben ab und versucht sie zu delegieren. Daß er mit dieser Orientierung im Leben nicht zum Ganzen werden kann, ist für Hartmann nur folgerichtig: Was sich im Leben forttreiben, hin- und herwerfen läßt, was wir als Person gelten lassen, weil es fortvegetiert oder den N a m e n weiterträgt, das ist nicht Person. Individuum, Subjekt, Bewußtsein mag es sein, der empirische Einzelmensch in seiner Halbheit. Person ist Ganzheit. Sie ist das geistige Wesen, das sich zu dem immer erst machen muß, was es in Wahrheit ist. 7
- Der Leugnung von Verantwortung liegt ein mangelhaft ausge- prägtes Ich und ein gestörtes Selbstbild zugrunde, zwei Krite-
- 124
- rien für einen mißlungenen Individuationsprozeß. Lersch führt aus, daß sich das Kind in dieser Phase der Ichwerdung als getrennt von den anderen erlebt, gleichzeitig jedoch mit ihnen verbunden und auf sie angewiesen bleibt. Die Ausbildung eines gesunden Egoismus, einer Sonderform des Selbsterhaltungstrie- bes, ist ein wesentliches Resultat dieses Prozesses. Das hervor- stechende >Für-sich-haben-Wollen< erreicht jedoch erst in der Erprobung der Realität ein sozial annehmbares Maß. Entschei- dend für das erfolgreiche Durchschreiten dieser Entwicklungs- phase ist die Art und Weise, in der die Erzieher dem Kind entgegentreten. In einer sado-masochistischen Kultur, in der Eigenständigkeit, Unabhängigkeit, Stabilität und Festigkeit nicht gefragt sind, kommen meist kämpferische und/oder ver- wöhnende Haltungen zum Tragen: in beiden wird das Kind fallengelassen. Versucht der Erzieher, ihm das >Für-sich-haben- Wollen< mit latenter oder offener Gewalt auszutreiben, wird es Trotz entwickeln und zum Neinsager aus Prinzip; bringt er ihm Gleichgültigkeit entgegen, wird es maßlos. Das Kind wird dann versuchen, sein unentwickeltes Ich ebenfalls mit Gewalt zu verteidigen, wobei der gesunde Egoismus zur Sucht des >Nicht-genug-haben-Könnens< pervertiert, die der Neidische nicht hat ablegen können. So beschreitet er also den gleichen Weg wie seine Vorbilder, einen Weg, der von einer quälenden Einstellung zu sich und zum Leben gekennzeichnet ist. N u r wenn genügend Freiraum dem Kind ermöglicht, fehler zu machen und daraus zu lernen, wird sein Ich sich stärken. Aber Freiraum kann wiederum nur der Erzieher gestatten, der ihn für sich selbst beansprucht, der in der Lage ist, eigene Ichgren- zen zu vertreten und die anderer zu respektieren. Flüchtet das Kind vor der Auseinandersetzung mit der Um- welt, so bleibt sein Ich schwach und anfällig gegen Einflüsse von außen. Da der Neidische diese Schwäche spürt, fühlt er sich seinen Mitmenschen unterlegen und kann sich nicht mit ihnen solidarisieren. Er will nicht tüchtig, klug, zuverlässig, beliebt usw. sein, sondern tüchtiger, klüger, zuverlässiger und beliebter als alle anderen. Da er dafür keine solide Grundlage besitzt, nimmt er Zuflucht zu Affekten und zerstörerischem Verhalten. Nach einem Modell von Lersch, das verdeutlicht, wie sich der Mensch vom abhängigen zum ichbewußten und autonomen, der Welt zugewandten Wesen entwickelt, muß er bestimmte
- 125
- Stadien durchlaufen und auch bewältigen. Im ersten Stadium geht es um die Antriebserlebnisse des lebendigen Daseins, zu dem der Tätigkeits- und Erlebnisdrang und die damit verbun- denen Empfindungen von Freude, Schmerz und Lust gehören. Es folgt das Stadium des individuellen Selbstseins mit dem Selbsterhaltungstrieb, dem Eigenwert- bzw. Selbstwertstreben und dem gesunden Egoismus; bei Störung führt letzterer zu Neid, Eifersucht u. a. m. Schließlich gipfelt die Entwicklung im Stadium des Antriebserlebnisses des Über-sich-hinaus-Seins, das sich im Miteinander und Füreinander, schaffender Teilha- be, Liebe und Liebesfähigkeit spiegelt. Haß, das Negativ zur Liebe, zeigt das Mißlingen der Persönlichkeitsentwicklung. Vergleicht man die natürlichen Tendenzen mit denen des Nei- dischen, so entdeckt man, daß er fundamental gestört ist: die Orientierung auf Aktivität und Erleben ist stark beeinträchtigt von dem zwanghaften Wunsch nach Bewahrung und absoluter Sicherheit. So vermeidet der neidische Mensch zwar Schmerz und Unlust, bringt sich jedoch um die Freude und Lust am aktiven Menschsein; er möchte wohl beides, scheut aber das Risiko des Mißerfolgs. Der realistisch eingestellte Mensch weiß, daß Selbsterkenntnis, Wachstum und Selbstverwirkli- chung nur im Ringen mit sich und der Welt zu erreichen sind. Erst auf diese Weise erfährt er, wer er wirklich ist, und kann seinem Leben einen Sinn geben. Allein diese Lebenshaltung ist dazu angetan, seine Kraft und seine Fähigkeiten zu steigern und ihm zu erlauben, das Machbare zu leisten und auf anderes zu verzichten, ohne dabei von Selbstzweifeln gequält zu werden. Hat ein Mensch seine Identität gefunden, besitzt er etwas, das ihm niemand streitig machen kann. Der sich selbst verwirkli- chende Mensch verfügt über eine Kraftquelle, die wächst, indem er davon abgibt. Die Gedanken des Neidischen dagegen kreisen ständig um sein lädiertes Ich. Er kann sich der Umwelt nicht freundschaftlich zuwenden, nichts geben, sondern nur nehmen. Er kann sich für kaum etwas begeistern, weil er nicht gelernt hat zu kooperieren. Mit sich identisch sein heißt aber auch, die eigenen Mängel und Schwächen anzunehmen, um sie nach und nach abbauen zu können. Jeder, der in diese Richtung geht, weiß, wieviel Ge- duld und Energie Fortschritt kostet, und wird deshalb den Unzulänglichkeiten seiner Mitmenschen verständnisvoll gegen- überstehen. Erfahrung und Wissen werden ihn nicht dazu
- 126
- veranlassen aufzutrumpfen, wie es der Neidische tut, sondern er wird es als Aufgabe ansehen, seine Mitmenschen solidarisch bei deren Ichentfaltung zu unterstützen. Die Orientierung an der relativ gesunden, ichstarken und pro- duktiven Persönlichkeit, wie sie uns die humanistische Ethik nahebringt, läßt viel eher die >menschliche Natur< erahnen als die Orientierung am psychisch Kranken. Sie erlaubt trotz des Wissens um die mannigfaltigen Probleme im zwischenmensch- lichen Bereich einen optimistischen Ausblick auf ein frucht- bareres Zusammenleben. Im Endeffekt hat der festgefahrene Blick der Psychoanalyse auf den Neurotiker dazu geführt, Menschen eher pessimistisch zu betrachten: für trennende Af- fekte wird die >böse< Triebnatur des Individuums verantwort- lich gemacht. Philosophische Anthropologie und humanisti- sche Ethik vertreten jedoch die Auffassung, daß der Mensch nur dann aggressiv reagiert, wenn er sich Veränderung aus eigener Kraft nicht zutraut, wenn er glaubt, keinerlei Einfluß auf sein Leben und seine Mitmenschen zu haben. Sartre be- schreibt in seinem >Entwurf einer Theorie der Emotionen< (1964) Affekte nicht als Trieb-, sondern als Bewußtseinsphänomene, die der Mensch einsetzt, um die Welt magisch zu verändern. Auf Magie setzt der Neidische, weil er seine Vorzüge und tatsächlich vorhandenen Fähigkeiten nicht zu schätzen weiß; daß er damit zu den tief Unglücklichen gehört, wird immer wieder hervorgehoben. Es scheint, als fürchte er positive Ver- änderung und >launisches< Glück und ziehe es vor, im bekann- ten, dafür >sicheren< Unglück zu verweilen.
- Neid und Psychotherapie
- Die humanistische Ethik beschäftigt sich seit Jahrhunderten mit der Frage, was denn eigentlich Glück sei und worin es bestehe. Eine der vielen möglichen Antworten könnte den Menschen zuversichtlich stimmen, da sie ihm versichert, daß Glück weder zufallsabhängig noch schicksalsbedingt ist, sondern allein in seiner Hand liege. Spinoza geht davon aus, daß das Glück des Menschen in der Fähigkeit bestehe, das eigene Sein zu erhalten und das Bezogensein auf die Welt anzunehmen. Ahnliches findet sich im Modell von Lersch, der als höchste Leistung des menschlichen Individuums das Streben über sich hinaus zu den
- 127
- anderen hin würdigt und als besten Weg dorthin den der Liebe aufzeigt. Da der Neidische jedoch zu den lieblos erzogenen Menschen gehört, ist ihm der >wohlwollende Blick< sowohl auf sich selbst als auch auf die anderen fremd. Liebe, Zuneigung, Toleranz, Freundlichkeit wertet er ab und kann deshalb nicht an sie glauben. Macht er sich aber eine Vorstellung davon, so hat sie den Charakter einer Illusion: er möchte geliebt, bevor- zugt und bewundert werden, allerdings ohne jegliche Gegenlei- stung, und zürnt der Welt, daß sie seinem Anspruch nicht nachkommt. Die einzige Bindung, die ihm dann noch bleibt, ist die des Hasses. Liebe und Liebesfähigkeit, die den Boden für menschliches Glück bereiten, stehen an der Pforte zum Menschsein. Nach Fromm {>Die Kunst des Liebens<) werden sie dem Menschen nicht geschenkt, er muß sie sich erobern. Da der Blick des Neidischen getrübt und seine Wahrnehmung auf Grund des Gefühls des >Zu-kurz-gekommen-Seins< ver- fälscht ist, kann er weder Interesse noch Aufmerksamkeit für die Welt aufbringen; beides jedoch sind Komponenten der Liebesfähigkeit und Grundbedingungen für menschliche Reife. Sein zwanghaftes Rotieren um sich selbst ist ein Ausdruck von Unfreiheit und Rigidität. Die Psychotherapie sollte daher zum Befreiungsprozeß werden und dem Neidischen einen besseren Zugang zu sich selbst und damit auch zu seinen Mitmenschen ermöglichen. Sie müßte einen kontinuierlichen Prozeß der Selbsterkenntnis und Men- schenkenntnis einleiten und ihn >zur Liebe verführen*, wie Nietzsche in seiner >Morgenröte< so treffend zu formulieren verstand:
- Zur Liebe verführen: - Wer sich selbst haßt, den haben w i r zu fürchten, denn wir werden die O p f e r seines Grolls und seiner Rache sein. Sehen w i r also zu, wie wir ihn zur Liebe zu sich selbst ver- führen. 8
- Eine Voraussetzung dafür jedoch ist, daß sich der Therapeut einem positiven und optimistischen Menschenbild verpflichtet sieht. Rattner betont, daß die Behandlung der Analysanden in der Therapie immer von der Einstellung abhängt, die der Analytiker zum Menschen hat. Hält er ihn für ein von Natur aus determiniertes, triebgelenktes Wesen, so wird sein Zutrau- en zu sich selbst und zu anderen entsprechend gering sein. Man
- 128
- kann vom Menschen schließlich nicht mehr erwarten, als ihm seine Natur gestattet. Glaubt der Therapeut aber auf Grund seiner Erfahrung an die soziale Orientierung des Individuums, an seine Fähigkeit zu Autonomie und Verantwortung, an seine Entwicklungschan- cen und an die Möglichkeit der Veränderung, so wird er diese Uberzeugung ausstrahlen, genauso wie ein kleinmütiger Thera- peut seinen Pessimismus und sein geringes Selbstvertrauen weitergibt - ob er will oder nicht. Es ist keineswegs ein Geheimnis, daß Einstellungen und Gefühlshaltungen anstek- kend sind wie manche Krankheiten. Die Aufgabe des Therapeuten besteht nun darin, die Not und Verzweiflung des Neidischen zu erkennen, aber gleichzeitig auch, dessen Möglichkeiten und Fähigkeiten zu überschauen. Meist hat er es mit einem gefühlsmäßig verschlossenen, oft kämpferischen Gegenüber zu tun, das darin geübt ist, andere kritisch zu betrachten und ihre schwachen Stellen blitzartig zu erfassen. Schnelle Erfolge sind in der Therapie nicht zu erwar- ten. Bringt der Analytiker dem Analysanden aber Achtung und Verständnis entgegen, so schafft er ein Klima, das es dem Neidischen erlaubt, einen Weg aus seinem Gefühlsdilemma zu finden. Er wird in der Psychotherapie zwar kein grundsätz- lich anderer, kann aber Ansätze zur Persönlichkeitsentfaltung finden und sich mit sich selbst anfreunden. Spürt der neidische Mensch, daß er so wie er ist angenommen wird, besteht die Chance, daß die Öffnung nach außen schrittweise gelingt. Wenn er lernt, sich mit seinen Mitmenschen auszutauschen und sich mit ihnen zu solidarisieren, so entkommt er nach und nach der peinigenden Isolation. Das Vorbild der anderen führt dazu, daß er nicht Sklave der eigenen Schwächen bleibt, sondern sie als Anregung für selbständiges Wachstum akzeptiert. Durch seine veränderte Haltung wird er sein Nicht-Haben aus den Augen verlieren; denn wenn man das eigene Leben anpackt und dafür die Verantwortung übernimmt, hat man keine Zeit mehr, andere mißgünstig zu beobachten und zu kontrollieren, ob sie gerade etwas besitzen, was man selbst entbehrt. Ein >Nebenprodukt< der aktiveren Lebenseinstellung ist Freu- dedie der Neidische kaum oder nur in Zerrform kennt. Durch zähes, kontinuierliches Bemühen kann aus Lebensneid so etwas wie Lebensfreude werden. Erfahrungen und Aktivitäten eröff- nen dem ehemals Neidischen Gefühlsdimensionen, die ihm
- 129
- fremd waren und vor denen er sich ängstigte. Kann er wirklich Freude empfinden, so werden Unlust, Schmerz und Trauer nicht länger seine Existenz bedrohen. Person-Sein heißt demnach auch, durch Niederlagen und Ab- lehnung hindurchzugehen, ohne an ihnen zu zerbrechen. Zara- thustras Hymne auf die Freude ist gleichzeitig eine Hymne auf Mitmenschlichkeit: Wahrlich, ich tat w o h l das und jenes an Leidenden: aber besser schien ich mir stets zu tun, wenn ich lernte, mich besser freuen. Seit es Menschen gibt, hat der Mensch sich zu wenig gefreut: Das allein meine B r ü d e r ist unsere Erbsünde! U n d lernen wir besser uns freuen, so verlernen w i r am besten anderen wehe zu tun und Wehes auszu- denken. 9
- Den Wert der Freude im zwischenmenschlichen Bereich betont der Philosoph auch, wenn er sagt, daß erst diejenigen unsere wahren Freunde sind, die sich mit uns freuen können; diejeni- gen, die mit uns leiden, sind lediglich >Leidensgenossen<.
- Die Uberwindung des Neides
- Haben die psychologischen und phänomenologischen Befunde ergeben, daß Neid nur auf dem Boden von Ichschwäche, Selbstverleugnung, Selbstverachtung und Lebensangst entste- hen und gedeihen kann, so gilt es für die Zukunft, Bedingungen zu schaffen, die Neidlosigkeit ermöglichen. Soziale Verände- rungen wie die Gleichstellung und Gleichberechtigung von Mann und Frau im beruflichen wie auch familiären Bereich müßten dabei an erster Stelle stehen, gemeinsam mit dem Bemühen, die Diskrepanz zwischen Reichtum und Armut, zwischen Wohlstand und Elend zu verringern und eine gerech- tere Verteilung lebenswichtiger Güter zu gewährleisten. In gleichem Maße geht es jedoch auch darum, daß jeder einzelne das Seine dazu beiträgt, indem er das eigene Leben verantwor- tungsvoller gestaltet und die Beziehung zu seinen Mitmenschen neu definiert. Mag es vielen auch heute noch unmöglich erscheinen, Einfluß auf das eigene Leben zu nehmen, weil Schicksalsgläubigkeit und der Irrglaube von der festgelegten und bösen menschlichen Natur noch weit verbreitet sind, so weist die verstehende
- 130
- Tiefenpsychologie in eine andere Richtung: sie durchbricht diese künstlich aufgebauten Hindernisse und klärt den Men- schen über seine Möglichkeiten auf. Sie ermutigt ihn, liebge- wordene Verdrängungen aufzugeben, sich zu seiner Ichschwä- che zu bekennen und die >faulen Kompromisse< in den zwi- schenmenschlichen Beziehungen zu durchschauen. Damit ent- zieht sie dem Sado-Masochismus, der nur vom verkrüppelten Ich lebt, den Nährboden. Derjenige, dem seine Mängel und Schwächen bewußt werden und der einen Weg sucht, sein Ich zu stärken, wird sich nicht mehr mit der Rolle des >Opfers< zufriedengeben. Während der Sadist seine Ichschwäche und seinen Selbsthaß in Form offener oder versteckter Gewalt (Zerstörungswut, Abwertung, Verletzungen, Überheblichkeit, Rechthaberei, Intoleranz, Verachtung, Konkurrenz, Triumph- gefühle usw.) kompensiert, ist die Kompensation des Masochi- sten nicht so leicht als pathologisch zu durchschauen. Dem geübten Beobachter entgeht jedoch nicht, daß auch er sein kleines, dürftiges Ich durch Überlegenheitsgefühle stärkt, aller- dings mit anderen Vorzeichen: er opfert sich auf, verzichtet auf die Gestaltung des eigenen Lebens, zeigt sich immer verständ- nisvoll, auch wenn er nicht versteht, und blickt mitleidsvoll auf andere herab, die noch schwächer zu sein scheinen als er selbst. Dieser Typus ist es, der am ehesten unter den >Leidensgenos- sen< zu finden ist. Beide Charaktere, der Sadist und der Maso- chist, haben gemein, daß sie von der Ichschwäche ihrer Mit- menschen abhängig sind, ohne deren Ohnmacht und Hilflosig- keit sie selbst ohnmächtig und hilflos wären. Würde der jeweili- ge Partner das Spiel nicht mehr mitspielen, würden sie auf sich selbst zurückfallen und müßten nach neuen Lebensinhalten Ausschau halten. Die Tugenden Mitleid, Opferbereitschaft und Verzicht auf Selbstverwirklichung stimmen nicht mit den Tugenden der humanistischen Ethik überein, wenn sie den Mitmenschen als Mittel zum Zweck benutzen. Spinoza verweist darauf, daß der Mensch niemals Mittel zum Zweck (z.B. zum Beweis der eigenen Überlegenheit) sein dürfe; sein Sinn liege in ihm selbst. Einem weiteren Aspekt von Ichstärke, der zu Achtung vor den anderen führt, mißt Plack in seinem Werk größere Bedeutung bei. Es handelt sich darum, Abstand zu sich und zu den Mitmenschen zu halten, um genauer beobachten, prüfen und
- reflektieren zu können. Klebt man, wie der Sado-Masochist, am anderen, so verliert man sowohl sich selbst als auch den anderen aus dem Blick. Wenn es gelingt, immer wieder befrei- ende Distanz herzustellen, so wird mehr Aufrichtigkeit und Klarheit entstehen. Das Individuum kann auf diese Weise lernen, >ohne Lüge< zu leben, d.h. möglichst ohne Verdrän- gung eigener vitaler Wünsche und Bedürfnisse. Erst dann wird der Mitmensch nicht mehr als Gegner oder gar Feind gesehen, sondern vielmehr als Verbündeter im gemeinsamen Kampf für ein lebenswerteres Leben. Wenn der Mensch sein Menschsein in diesem Sinne bejaht, so werden Toleranz, Wissen, Verständnis, Mut, Takt, Offenheit und realistische Selbst- und Fremdeinschätzung den Alltag bestimmen und Neid und Haß an Gewicht verlieren. Neidische Regungen würden in den Familien in dem Maße abnehmen, in dem Kinder nicht mehr als Lückenbüßer oder Krücken für das schwache Ich der Eltern fungierten und dazu benutzt würden, deren Lebensschwierigkeiten zu überdecken. N u r wenn Kinder aus Liebe zum Leben und zum Menschsein überhaupt in diese Welt gesetzt werden und nicht aus Flucht vor ihr, werden sich >Mitspieler< und nicht Neider aus ihnen entwickeln. Sie würden zu Menschen erzogen, die dank ihrer Vorbilder zu der Uberzeugung gelangen, daß es sich lohnt, für den Menschen einzutreten und sich für ihn zu engagieren.
- 132
- Wolfgang Köppe
- Eifersucht
- Eifersucht ist ein allgemein bekanntes, weitverbreitetes Verhal- ten, das in mannigfaltiger Differenzierung auftreten kann. Zwi- schen der leichten Eifersuchtsregung des seelisch Stabilen und dem mit schweren Persönlichkeitsstörungen einhergehenden Eifersuchtswahn liegt eine breite Spanne von Verhaltensmög- lichkeiten, von denen wohl jeder Mensch im Laufe seines Lebens einige in sein Verhaltensrepertoire aufnimmt. So gibt es zum Beispiel in Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter be- stimmte Situationen, die Eifersuchtsgefühle geradezu provozie- ren. Man denke nur an die in der Erziehungsliteratur oft beschriebene Tragödie der >Entthronung<. Ein Kind bekommt ein Geschwister, meint dadurch Liebe und Zuwendung einzu- büßen und gebärdet sich entsprechend kämpferisch. Von den Eltern ungenügend auf die Situation vorbereitet, traktiert es den Neuankömmling, und es ist durchaus nicht selten, daß handfeste Bedrohung und sogar Beseitigungswünsche zum Ausdruck kommen. Auswüchse frühkindlicher, vom vernunft- betonten Denken noch unberührter, zügelloser Phantasie? Kei- neswegs! Die hervorragendsten Zeugnisse menschlicher Kul- tur wie Mythen und Sagen oder Dramen und Romane der Weltliteratur sind ein Beispiel dafür, wie das Gift der Eifersucht nicht nur das kindliche Emotionalleben erkranken läßt. In tragisch-dramatischen Darstellungen werden die unheilvollen Verstrickungen derjenigen geschildert, die von der Allgewalt der Eifersucht erfaßt werden. An erster Stelle sei hier Shake- speares >Othello< erwähnt: darin bringt der Titelheld, angesta- chelt von dem Intriganten Jago, seine geliebte Desdemona im Eifersuchtswahn um. Nicht weniger dramatisch geht es in Hebbels Tragödie >Herodes und Mariamne< zu. Der ebenfalls vom Eifersuchtswahn befallene Herodes erteilt den Befehl, bei seinem Tode auch das Leben seiner Frau zu beenden, da ihm der Gedanke an ihre mögliche Wiedervermählung unerträglich
- 33
- ist. Auch Georg Büchner nahm sich dieses Themas an. Sein Theaterstück >Woyzeck< ist ebenfalls ein eindrückliches Beispiel dafür, welch qualvolle Gemütsregungen die Eifersucht hervor- ruft und zu welch blinden Affekthandlungen sie verleitet. Oft wird angenommen, daß Eifersucht nur in Liebesbeziehun- gen auftritt. Das ist nicht der Fall. Die Erfahrungen der psy- chotherapeutischen Praxis zeigen vielmehr, daß sie in allen zwischenmenschlichen Bereichen anzutreffen ist. Im Berufsall- tag ebenso wie in der Kindererziehung und in Freundschaften können sich eifersüchtige Regungen einnisten und, einem schlimmen Fieber gleich, ihre unheilvolle Wirkung ausüben. Wer die Ursache der Eifersucht kennt, ist darüber nicht ver- wundert. Offenbar ist sie zutiefst mit Mangelgefühlen an Liebe und Anerkennung verknüpft, und da jedermann meint, nicht genug Liebe zu bekommen, findet die Eifersucht reichliche Nahrung. Von den Anfängen unserer Kultur bis zum heutigen Tag zählt sie zu den häufigsten Negativ-Verhaltensweisen des Menschen. Die vorliegende Untersuchung ist nicht der einmaligen oder doch nur wenige Male im Leben eines Menschen auftretenden Eifersuchtsregung gewidmet. Im Mittelpunkt steht vielmehr die Eifersucht als konstantes Verhalten, als bleibende Kontur, als individuelle Prägung der Einstellung zu sich selbst und zu den Mitmenschen, kurz: als Charakterzug. Entsprechend wur- den auch die Beispiele ausgewählt, die den Eifersüchtigen par excellence zeigen. Nicht jeder >Gelegenheitseifersüchtige< wird sich darin wiedererkennen. Wie der tiefenpsychologischen Forschung zu entnehmen ist, sind Charakterzüge weitgehend >erfahrungsresistent<. Hat man erst einmal einen bestimmten Charaktermodus entwickelt, so ordnet man die Realität bis zu einem gewissen Grad so ein, wie sie zum Charakter paßt und nicht so, wie sie ist. Der Eifersüch- tige kann also vor sich selbst durchaus triftige Gründe für sein aggressives, attackierendes, den persönlichen Umgang mit ihm sehr erschwerendes Verhalten anführen. Außenstehende aller- dings werden sein Bemühen kaum verstehen. Will man von daher dem Eifersüchtigen zu einem angenehmeren Leben ver- helfen, so hat es keinen Sinn, sein Verhalten moralisierend zu bewerten. Man muß vielmehr begreifen, daß eine seelische Notlage seine destruktive Weltsicht bestimmt. Auch ist ihm mit der Aufforderung, per Vernunft seine Befürchtungen zu über-
- 134
- winden, wenig gedient. Da das Symptom >Eifersucht< fest im Gefühlsleben verwurzelt ist, kann es nicht per Ratschlag aus der Welt geschafft werden. Für den Betroffenen ist es bittere Realität, daß ein Dritter ihm die Liebe des Partners streitig macht, daß die ihm >zustehende< mütterliche Zuwendung auf andere verteilt wird oder daß andere Liebe, Zuwendung und Anerkennung spendende Quellen bedroht sind. Andern kann er sich von daher allein in der kontrollierten Situation der Psychotherapie, in der er die Chance erhält, seine Selbster- kenntnis zu steigern, um mit zunehmender menschlicher Reife auch die Realität richtig einschätzen zu können.
- Beispiele von Eifersucht
- Das Problem der Eifersucht kommt in der psychotherapeuti- schen Praxis sehr oft zur Sprache. Dabei kann man beobachten, daß der Eifersüchtige gegenüber seinem Partner ein hartes Verhalten an den Tag legt. Mit Vorwürfen, Verdächtigungen und anderen feindseligen Attacken verwandelt er die Liebesbe- ziehung in eine Kampfstätte mit der Absicht, den Freiheits- spielraum des Partners einzuengen. Die Freiheit, das Unbere- chenbare, das Unvorhersehbare ist für ihn ein großer Unruhe- herd. Ein freier Mensch kann sich in gewissen Grenzen in der Welt einrichten, wie er es für richtig hält. Er kann seinen Blick auf andere richten, kann seine Aufmerksamkeit in verschiedene Richtungen lenken, kann Beziehungen aufnehmen - das alles stört den Eifersüchtigen. Er will derjenige sein, der bestimmt, der dirigiert und den Gefühlshaushalt des Partners verwaltet. Wollte man eine von Eifersucht geprägte Partnerschaft panto- mimisch darstellen, so wäre man gut beraten, die Partner- schaftsszenerie in einen Gefängnishof zu verlegen, in welchem der Eifersüchtige den ohnehin arg dezimierten Bewegungsspiel- raum seines Partners noch dadurch einengt, daß er ihn am Sehen, Sprechen und Hören hindert. »Weil ich dich liebe« - so heißt es wohl in der Sprache des Eifersüchtigen - »mußt du dich an dem orientieren, was ich für richtig halte.« Diese Haltung, aus >Liebe< Forderungen abzuleiten, ist offenbar ein weitver- breitetes Übel. So hört man z.B. immer wieder, daß der Eifersüchtige über den Tagesablauf des Partners genauestens unterrichtet sein will.
- 35
- Wie eine Patientin berichtete, scheute ihr Ehemann auch nicht davor zurück, sich durch Telefonate zu versichern, daß sie zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich am angegebenen Ort war. Kam es zu Verspätungen - was infolge ihrer Vertretertä- tigkeit vorkam - so mußte sie ihre ganze Uberzeugungskraft aufwenden, um den erbosten Partner zu beruhigen. Der witter- te sofort ein Rendezvous, verdächtige Bekannte und Verwandte und verunsicherte die Frau so stark, daß sie brav über jede Stunde ihres ohnehin anstrengenden Tages Rechenschaft ab- legte. Eines Tages kam es aber doch zum Eklat. Auf dem Wege zu einem Kunden begegnete der Patientin ein ehemaliger Studien- kollege, mit dem sie während ihrer Ausbildungszeit ein recht freundschaftliches Verhältnis unterhalten hatte. Sie freuten sich über das unverhoffte Zusammentreffen und beschlossen so- gleich, eine kleine Kaffee- und Plauderpause einzulegen. Ein Café war schnell gefunden. Unterdessen hatte der Ehemann seine üblichen Nachforschungen betrieben. Als nach mehreren Anrufen seine Frau nicht zu erreichen war, konnte er seine Unruhe nicht mehr beherrschen. Unter einem Vorwand nahm er Urlaub und - er kannte den von seiner Frau zurückgelegten Weg genau - machte sich auf die Suche nach ihrem Auto. Es kam, wie es in solchen Situationen wohl immer kommt. Der Ehemann fand das Café, ließ sich zu einer ausgedehnten Szene hinreißen und traktierte seine Frau noch Wochen danach mit häßlichen Verdächtigungen und Ausfällen. Die Situation wurde so unerträglich, daß sie sich entschloß, einen Eheberater aufzu- suchen, und zwar allein - der Ehemann weigerte sich. In einem anderen Fall war die Ehefrau eines Patienten nicht von der Meinung abzubringen, daß sich ihr Mann zu wenig um sie kümmere. Sie fühlte sich zu wenig geachtet und geschätzt, und was ihr Mann auch immer tat, sie kritisierte ihn. Besonders argwöhnisch beobachtete sie seinen Umgang mit anderen Frau- en. Bei Familientreffen achtete sie sehr darauf, daß er nur mit Frauen sprach, die älter waren als sie. Da ihr Mann zur Genüge vorgewarnt war, ließ er sich auch willig auf das >Spiel< ein und begann mit der Zeit sogar, Gefallen daran zu finden. Dennoch konnte es bei derartigen Anlässen passieren, daß seine Frau ihn beiseite winkte und ihm verbot, auch nur noch einen Blick in die Richtung zu senden, in der der jüngere Teil der Gesellschaft Platz genommen hatte. Besonders von blonden Frauen oder
- 36
- sehr jungen Mädchen fühlte sie sich herausgefordert. Immer wieder glaubte sie, in ihnen ernsthafte Rivalinnen sehen zu müssen, die nur auf eine günstige Gelegenheit warteten, um ihr den Ehemann abspenstig zu machen. Auch dieser Fall führte schließlich zu einer Therapie. Eine entferntere Verwandte des Patienten, ein blondes, hübsches vierzehnjähriges Mädchen wurde konfirmiert. Während der Feier drehte sich natürlich alles um die Konfirmandin, die von den Gästen mit Gratulationen und Geschenken überhäuft wur- de. Auch der Patient schloß sich den Gratulanten an. Er übergab dem Mädchen ein Geldgeschenk, über das sie sich sehr freute. Sie umarmte und küßte ihren Onkel, der die Umarmung erwiderte. Plötzlich wurde ihm klar, wie >gefährlich< sein Ver- halten war. Er versuchte zu retten, was zu retten war, doch vergebens. Der Sturm der Entrüstung war nicht mehr aufzuhal- ten. Noch Wochen nach diesem Vorfall überschüttete ihn seine Frau mit Anschuldigungen: er mache nun nicht einmal mehr vor Minderjährigen halt, und sie könne unter diesen Umstän- den an derartigen Zusammenkünften nun nicht mehr teilneh- men. Nach einigen Therapiesitzungen, die der traktierte Ehe- mann anfänglich ohne Wissen seiner Frau aufgenommen hatte, erklärte sie sich bereit, ihrerseits die Problematik zu bearbeiten, so daß ihr partnerschaftliches Zusammenleben nach einiger Zeit freundlichere Züge annahm.
- Seelische Hintergründe der Eifersucht
- Die geschilderten Beispiele zeigen, daß der Eifersüchtige ein zutiefst unsicherer Mensch ist, der ein auffallend schwaches Selbstwertgefühl besitzt. Seine Kleinheits- und Minderwertig- keitsgefühle beruhen auf der Vorstellung persönlicher Wertlo- sigkeit. Deshalb kann er sich nur schwer oder gar nicht vorstel- len, daß man ihn liebt. Obwohl eifersüchtige Menschen äußer- lich oft sehr attraktiv sind, haben sie alles mögliche an sich auszusetzen. Die anderen sind immer schöner, klüger, intelli- genter und anziehender, und so suchen sie ständig nach einer Möglichkeit, ihre Ängste, Unsicherheiten und Überempfind- lichkeiten zu kompensieren. Hierzu scheinen ihnen Liebesbe- ziehungen besonders geeignet. Sie erwarten vom Partner abso- lute Sicherheit. Er soll sich nur für sie interessieren, soll ständig
- 137
- für sie da sein und ihnen seine Liebe beteuern. Da niemand diesem verstiegenen Verlangen auf die Dauer nachkommen kann, wundert es nicht, daß die Liebe des Eifersüchtigen so gut wie immer unglücklich verläuft. Das Resultat solcher Bezie- hungen ist dann Haß und Feindseligkeit, zu denen sich mit der Zeit ein gesteigertes Mißtrauen gesellt. Auffällig am Eifersüchtigen ist auch seine Unfähigkeit, zu sich selbst ein ausgewogenes Verhältnis zu finden. Nur in geringem Maße gelingt es ihm, sich selbst zu bejahen, anzuerkennen und eine ansprechende Selbsteinschätzung zu finden. Betrachtet man seine fiebrigen, ständig nach außen gerichteten Aktivitä- ten, so kann man geradezu von einer Flucht vor sich selbst sprechen. Wer aber sein Leben auf ein gesichertes Fundament stellen will, muß ruhig und geduldig den Kontakt zu seinem Innern suchen. Da der Eifersüchtige das nicht kann, darf man annehmen, daß er zum Selbsthaß neigt. Der sich hassende Mensch beschäftigt sich natürlich nicht gern mit sich selbst. Er lehnt den Kontakt mit sich ab, klammert sich dafür aber um so mehr an seine engsten Bezugspersonen, die ihm die Selbst- achtung, Bejahung und Anerkennung vermitteln sollen, die er selbst zu erreichen nicht imstande ist. Selbsthaß und Fremdhaß sind aber im Grunde identisch. So wie jeder, der sich selbst akzeptiert, auch fähig ist, andere zu akzeptieren, so lehnt der sich selbst Hassende auch alle anderen Menschen ab. In seinen Augen zeigt sich die Welt als Feindes- land, in dem Wärme, Geborgenheit, Unterstützung und Ermu- tigung nicht zu erlangen sind. Dementsprechend zieht er sich von ihr zurück und versucht, sein Sicherheits- und Liebesbe- dürfnis in der Partnerschaft zu stillen. Intime freundschaftliche Beziehungen im großen Kreis anderer Menschen, wie sie jeder zur Abstützung seines Selbstwertfühls braucht, traut er sich lediglich in der Phantasie zu. So ähnelt sein Verhalten dem des Paranoikers, dessen Angst vor der Intimität sich wie ein roter Faden durch sein Leben zieht. Kommt es zu intimeren Bezie- hungen, so treten sofort trennende Tendenzen auf. Mißtrauen, Unsicherheit, Negativismus und Angst sind die bevorzugten >Hilfsmittel<, mit denen der erforderliche Sicherheitsabstand hergestellt wird. Im Umgang mit dem Eifersüchtigen spürt man förmlich, daß er sich wie ein Deklassierter vorkommt. Angriffslustig und kämp- ferisch verfolgt er seine Ziele, und vehement setzt er sich in
- 138
- Situationen zur Wehr, in denen ein selbstsicherer Mensch gelassen reagiert. In diesem Zusammenhang fragt man sich, welchem Familientypus der Eifersüchtige angehört. Horst- Eberhard Richter vertritt in seinem Buch >Patient Familie< (1970) den Standpunkt, daß jede Neurose einem bestimmten Fami- lientypus entspricht. Der Neurotiker wird dabei lediglich als Exponent der Krankheit angesehen, an der die ganze Familie leidet. Die Erkrankung der paranoiden Familie zeigt sich vor- nehmlich daran, daß sie wie in einer Festung verschanzt lebt. In ihrem wahnhaften System kreist alles um die angebliche Bösar- tigkeit der Welt, und sie ist von ihrer eigenen Unfehlbarkeit überzeugt. Der gemeinsame Wahn bietet oft, wie Richter be- tont, die >letzte Chance einer gemeinsamen Solidarisierung<. Die >Festungsfamilie< hat daher nur wenig Gelegenheit, koope- rative, auf den Mitmenschen gerichtete, >liebende< Verhaltens- weisen zu entwickeln. Deshalb konnten eifersüchtige Men- schen in ihrer Kindheit nicht lieben lernen. Die frühkindlichen Bedingungen boten ihnen zu wenig Gelegenheit dazu. Lebt man selbst in einem kalten, liebeleeren Milieu, so wird man sich kaum die Fähigkeiten und Eigenschaften aneignen können, die andere Menschen erfreuen und sie in ihrer Entwicklung för- dern. Lieben bedeutet ja in erster Linie, sich auf andere Menschen einzustellen, sie in ihrer Individualität zu verstehen und eine produktive Aktivität in ihnen zu wecken. Diesem Maßstab kann der Eifersüchtige nicht entsprechen. Denkt man an das oben beschriebene harte, oft auch rücksichtslose Verhalten, so fragt man unwillkürlich nach der >weichen Seite< des Eifersüch- tigen, nach Hingabe und Anlehnung, nach Zärtlichkeit und Sexualität. Nicht ohne Grund wird in der tiefenpsychologi- schen Literatur die Meinung vertreten, daß die Fähigkeit zur Hingabe durch hartes, unflexibles und rigides Verhalten beein- trächtigt wird. Härte und Rigidität weisen ja darauf hin, daß Liebe nicht mehr als gemeinsame Aufgabe erlebt wird, als ein ständiges Bemühen, einem Menschen des anderen Geschlechts emotional näher zu kommen. Sie wird vielmehr zum Kampfge- biet erklärt, in dem es um Anerkennung, Geltung und Macht zu fechten gilt. Das führt naturgemäß zu zahllosen Mißstim- mungen, die die Bereitschaft zu Hingabe und Zärtlichkeit reduzieren. So liegt es fast nahe, vom >Defensivcharakter< der Eifersucht zu
- 139
- sprechen. Er steht in direktem Gegensatz zum Liebesverhalten des Menschen, das Offenheit, Kooperation und Werbung in sich vereint. Der Liebende bemüht sich fortwährend um den Partner, weil er ihn jeden Tag aufs neue für sich gewinnen will. So sieht es auch Erich Fromm, der sich in seinem Buch >Die Kunst des Liebens< (1979) dagegen wehrt, die Liebe als selbstver- ständlichen Bestandteil des Lebens aufzufassen. Sie ist vielmehr eine Kunst, die mit dem ganzen Einsatz der Person erlernt werden muß. Da sie zu den großen Aufgaben des Lebens gehört, kann sie derjenige am besten bewältigen, der sich selbst und den anderen bejahend gegenübertritt und produktiv in das zwischenmenschliche Geschehen eingreift. Anders der Eifersüchtige. Beobachtet man seine Attacken und Ausbrüche, so bekommt man den Eindruck, daß er ständig mit dem Rücken zur Wand stehend eine ihm entgleitende Liebe verteidigt. Die Mittel hierzu sind nicht kleinlich gewählt. Be- schimpfungen, Drohungen und Vorhaltungen sind an der Ta- gesordnung. Daß der Eifersüchtige weder werbend noch för- dernd, sondern immer nur kränkend und herabsetzend ist, braucht nicht weiter betont zu werden. Die negative Auswir- kung dieses Verhaltens auf das partnerschaftliche Leben liegt auf der Hand. Der Eifersüchtige kämpft um einen Besitz, der ihm nicht gehört und den er dennoch zu verlieren glaubt. Seine ganze Kraft setzt er dazu ein, Wahnvorstellungen nachzujagen, die ihm nicht nur die Gefahr des Verlustes, sondern noch mehr den Eindruck suggerieren, daß schon alles verloren sei. Da- durch entsteht die signifikante Atemlosigkeit des Eifersüchti- gen, die an den Wütenden erinnert. Wie bei ihm, so hat man auch beim Eifersüchtigen den Eindruck, daß er den Bogen weit überspannt und schnell an Kraft verliert. Das ist nicht verwun- derlich, denn das ständige >In-Schach-Halten< der Mitwelt er- fordert tatsächlich ein weitaus größeres Maß an seelischer Aus- dauer und Energie, als es das kooperative miteinander Leben, Lernen, Denken, Fühlen und Handeln verlangt.
- 140
- Eifersucht als Affekt
- Versucht man die wichtigsten Züge der Eifersucht zu analysie- ren, so stellt man als erstes fest, daß sie ein Affekt ist. Affekte sind heftige Gemütsbewegungen oder Erregungszustände, die Einsichtsfähigkeit und Kritikvermögen auf ein Minimum ein- schränken und eine vernünftige Selbststeuerung unmöglich ma- chen. Spinoza bezeichnete Affekte von daher als >kleine Gei- steskrankheiten<. Psychosen gleich engen sie das realistische Welterleben ein, schalten das klare Denken aus und wirken sich entsprechend negativ aus. Von den Leidenschaften unterschei- den sie sich durch ihre geringere seelische Tiefe sowie die wesentlich kürzere Dauer. Einen scharfsinnigen Beitrag zum Affektverständnis lieferte Jean-Paul Sartre in seinem 1939 erschienenen Essay »Entwurf einer Theorie der Emotionem, der das Ergebnis von Sartres Auseinandersetzung mit der naturwissenschaftlich-positivisti- schen Psychologie ist, gleichzeitig aber auch seine Auffassung von einer philosophisch orientierten Menschenkunde dar- legt. Affekte unterliegen nach Sartre nicht den üblichen physiologi- schen, d.h. kausal-genetischen Erklärungsmustern. Sie sind vielmehr ein intentionales Geschehen, das eine umfassende Bedeutung im Rahmen der gesamten Lebensführung eines Menschen besitzt. Sie werden dann >eingesetzt<, wenn in schwierigen Situationen die üblichen Verhaltensmuster versa- gen. So sind Affekte nicht kausal, sondern immer final zu begreifen. Sie sind nicht biologisch bedingt, sondern werden zum Zwecke der Selbstwertsicherung eingesetzt. Wo Vernunft, Verstand und kooperative Emotion versagen, soll der Affekt für Ausgleich sorgen. Gleich einer Zauberkraft soll er die Mitwelt so formen, wie sie unserer Vorstellung entspricht. In diesem Sinne ist auch der Eifersuchtsausbruch zu betrachten. Er soll die Mitwelt bewegen, uns weniger zu belasten, weniger Mühe und Fleiß abzufordern und uns dennoch zu akzep- tieren. Ein weiteres Merkmal des Affekts ist die von ihm hervorgerufe- ne >Werdenshemmung<. Normalerweise wendet man sich von Kindesbeinen an immer stärker der Umwelt zu, Ziele und Aktivitäten sind in ihr verankert. Man ahnt, daß persönliche Entwicklung mit der Assimilation der Arbeits-, Kultur- und
- 141
- Wertwelt gleichzusetzen ist. Um geistige und kulturelle Fähig- keiten zu entwickeln, muß man der Menschen- und der Ding- welt sehr nahe kommen. Das Verhältnis zu den Mitmenschen soll deshalb weder von übertriebenen Minderwertigkeitsgefüh- len noch von Überheblichkeit bzw. Egozentrik belastet sein. Ideal für das geistige und emotionale Wachstum ist vielmehr eine Gemütslage, in der man sich mit den anderen >auf einer Ebene stehend< erlebt. Erst dann wird man die Vorurteilslosig- keit, Denk- und Handlungsfähigkeit gewinnen, die einen als reife, erwachsene Persönlichkeit auszeichnet. Das alles läßt eine affektbestimmte Lebensführung aber nur bedingt zu. Wie jeder aus eigener Erfahrung weiß, besitzen Affekte keine verbindende, sondern eine zerstörende Wirkung. Sie schaffen Distanz, verhindern Zwischenmenschlichkeit und dämmen damit eine der wichtigsten Quellen geistigen und produktiven Daseins, das Gefühl des Eingebundenseins in die Menschengemeinschaft, ein. Mögliche Folgen davon sind sta- gnierende Kreativität und ein unterdrückter Reifungs- und Entwicklungsprozeß. Die Überwindung derartiger Krisen erfordert in erster Linie die Einsicht, daß man nur dann ein produktives Leben führen kann, wenn man den Sinn des Lebens in der sozialen Beitrags- leistung sieht. Das ist für den Eifersüchtigen schwer nachzu- vollziehen. Er ist ja in seinem Innern davon überzeugt, daß nicht er sich zu bemühen habe, sondern daß man sich um ihn kümmern muß. Die Aufforderung zu Fleiß, Anstrengung, zur Mitarbeit und zum Lernen gilt seines Erachtens nicht für ihn. Seines Wissens hat er seinen Beitrag schon allein dadurch geleistet, daß er anwesend ist. Mit dieser Haltung gerät er natürlich leicht in Gefahr, übersehen zu werden. Das ist auf die Dauer für niemanden erträglich, schon gar nicht für den Eifer- süchtigen. Um sich Gehör zu verschaffen, produziert er deswe- gen von Zeit zu Zeit seine Affekte, die seine mangelhafte soziale Bildung dann weithin sichtbar machen. Zum Verständnis der Eifersucht gehört auch die Beobachtung, daß sie niemals allein, sondern immer in Verbindung mit anderen Affekten auftritt. Oftmals kann man geradezu von einer >Versammlung< der ganzen Affektfamilie sprechen. So trifft man neben der Eifersucht zumeist auch Wut-, Haß-, Neid- oder übermäßige Ehrgeizgefühle an, von denen je nach Situation das Familienmitglied in den Kampf geschickt wird,
- 142
- das zur Erreichung des jeweiligen (Macht-)Ziels am geeignet- sten erscheint. Ohnmacht zu vermeiden und Macht zu erreichen ist das eigentliche Ziel des Eifersuchtsaffekts. Es hieße von daher in veraltete Vorstellungen zurückfallen, würde man bestimmte Gemütsdispositionen (Temperamente) oder Organbeschaffen- heiten (Nebennierenrinde, Adrenalinhaushalt usw.) als Affekt- grundlage ansehen. Er (der Affekt) wird vielmehr von der Ganzheit der Person lanciert. Für diese ist er ein Hilfsmittel, um Kleinheit, Unbeholfenheit und Angst in Macht und Stärke umzuwandeln.
- Sigmund Freud und Alfred Adler: Beiträge zum Eifersuchtsverständnis
- In dem Aufsatz >Über einige neurotische Mechanismen bei Eifersucht, Paranoia und Homosexualität (1922) faßt Freud seine Erkenntnisse in bezug auf die Eifersucht zusammen. Er weist darauf hin, daß die Fälle von Eifersucht, mit denen man es in Analysen zu tun bekommt, dreifach geschichtet sind. Es sind dies die Schichten der 1. konkurrierenden oder normalen, 2. der projizierten und 3. der wahnhaften Eifersucht. U b e r die normale Eifersucht ist analytisch wenig zu sagen. Es ist leicht zu sehen, daß sie sich wesentlich zusammensetzt aus der Trauer, dem Schmerz um das verloren geglaubte Liebesobjekt, und der narzißti- schen Kränkung, soweit sich diese vom anderen sondern läßt, ferner aus feindseligen Gefühlen gegen den bevorzugten Rivalen und aus einem mehr oder minder großen Beitrag von Selbstkritik, die das eigene Ich f ü r den Liebesverlust verantwortlich machen will. Diese Eifersucht ist, wenn wir sie auch normal heißen, keineswegs durchaus rationell, das heißt aus aktuellen Beziehungen entsprungen, den w i r k - lichen Verhältnissen proportional und restlos vom bewußten Ich beherrscht, denn sie wurzelt tief im Unbewußten, setzt früheste Regungen der kindlichen Affektivität fort und stammt aus dem O d i - pus- oder aus dem Geschwisterkomplex der ersten Sexualperiode. 1
- Die Eifersucht der zweiten Schicht, die projizierte, führt Freud beim Mann wie bei der Frau auf selbst praktizierte bzw. in der Phantasie vollzogene Untreue zurück, die dann verdrängt wur- de. Die alltägliche Erfahrung lehrt, daß die in Liebesbeziehun- gen geforderte Treue nur gegen ständige Versuchung aufrecht-
- 43
- erhalten werden kann. Sie ist - auch wenn sie verdrängt wird - so stark, daß unbewußt gern ein erleichternder Mechanismus in Anspruch genommen wird: die eigenen Antriebe zur Untreue werden auf den Partner projiziert. Die Projektion äußert sich in der Überlegung, daß der Partner auch nicht besser ist als man selbst. Um diese spezifische Form der >Gewissenserleichterung< zu demonstrieren, zitierte Freud eine Strophe im Lied der Desdemona: Ich nannt' i h n : Du Falscher. Was sagt er dazu? Schau ich n a c h den Mägdlein, nach den Büblein schielst du. 2
- Freud weist darauf hin, daß die durch Projektion entstandene Eifersucht zwar fast wahnhaften Charakter hat, daß sie aber der analytischen Arbeit, die die unbewußte, in der Phantasie be- gangene Untreue aufdeckt, nicht widersteht. Schwieriger zu- gänglich sei dagegen die Eifersucht der dritten Schicht, der eigentlich wahnhaften. A u c h diese geht aus verdrängten Untreuestrebungen hervor, aber die Objekte dieser Phantasien sind gleichgeschlechtlicher Art. Die wahn- hafte Eifersucht entspricht einer vergorenen Homosexualität und be- hauptet mit R e c h t ihren Platz unter den klassischen Formen der Paranoia. A l s Versuch zur A b w e h r einer homosexuellen Regung wäre sie (beim Manne) durch die Formel zu umschreiben: Ich liebe ihn ja nicht, sie liebt ihn. In einem Falle von Eifersuchtswahn w i r d man darauf vorbereitet sein, die Eifersucht aus allen drei Schichten zu finden, niemals die aus der dritten allein. 3
- Wie Freud bei der Beschreibung der konkurrierenden oder normalen Eifersucht anführt, setzt sie früheste Regungen der aus dem Ödipuskomplex resultierenden kindlichen Affektivität fort. Der Inhalt der ödipalen Situation sei kurz referiert. Die libidinöse Genitalbesetzung führt nach dieser Theorie beim Knaben zu dem Wunsch, Liebhaber seiner Mutter zu werden. Er hofft, sie in einer der Formen besitzen zu können, die ihn in seinen Phantasien vom Genitalleben beschäftigen. Der Vater, den er bei der Mutter ersetzen will, wird zum Rivalen und mit Eifersucht und »mörderischer Wut< besetzt. Er soll auf irgend- einem Wege beseitigt werden. Dieser Liebe-Haß-Konflikt wird nach der griechischen Sage vom Odipus, der unwissend seinen Vater tötet und seine Mutter heiratet, Ödipuskomplex genannt. Am Ende der phallischen Phase steht seine Auflösung an.
- 144
- Unter dem Schock der elterlichen Kastrationsdrohung zer- schellen Eifersucht, Wut und Haß, und durch Identifikation mit den Eltern und Introjektion ihrer Gebote gelingt es dem Knaben, seine Wunschvorstellungen zu verdrängen. Damit ist das Fundament für ein produktives Leben gelegt. Mißlingt die Verarbeitung der Odipussituation, so kommt es zu Fixierungen der Seelenenergie und Denken, Verhalten, Fühlen und Wollen können sich im weiteren Leben nur schwer entfalten. Deshalb reagiert der Betreffende in vielen Lebenssituationen mit Eifer- sucht und Rivalitätsgefühlen, wo andere mit Gelassenheit und Umsicht handeln können. Die altersentsprechende Entwicklung des Mädchens unter- scheidet sich nach der Ansicht Freuds wie folgt: Nachdem die früheren Phasen der Libidoentwicklung ohne Divergenz zum Knaben durchlaufen wurden, kommt es nun zu erheblichen Unterschieden. Sie sollen durch die Verschiedenheit von Penis und Vagina bedingt sein. Angesichts seines »kastrierten Zustan- des< meint das Mädchen, >zu kurz< gekommen zu sein. Es entwickelt deshalb ein Gefühl der Minderwertigkeit, das es zu kompensieren gilt. Es wünscht sich vom Vater ein Kind, belegt die Mutter mit den gleichen Gefühlen wie in der vorgenannten Situation der Knabe den Vater, und Eifersucht, Wut und Neid werden zu gängigen Gefühlsreaktionen. Da die Entwicklung von Kastrationsängsten, die die Umbil- dung der Odipuswünsche beim Knaben erzwingt, beim Mäd- chen nicht gegeben ist, bleibt ihm eine ideale Bearbeitung seiner Situation verwehrt. Die Erkenntnis des Schon-von-Geburt-an- kastriert-Seins führt zu einem immerwährenden Penisneid, der seinen charakterlichen Niederschlag in der Ausbildung von Eifersuchts- und Neidgefühlen erfährt. Diese sollen nach Freud ebenso zu den typischen Merkmalen der Frau zählen wie mangelndes Rechtsgefühl, Infantilität oder die Abneigung da- gegen, sich großen Forderungen zu stellen. So wird die weibli- che Eifersucht als anatomisches Schicksal dargestellt. Freuds theoretische Erwägungen fanden schon in der Frühzeit der tiefenpsychologischen Forschung ihre Kritiker. Einer der fundiertesten war sein langjähriger Mitstreiter Alfred Adler, der im Zuge der darauffolgenden Jahre eine völlig neuartige Seelenkunde entwarf. Nach seiner Aussage ist der Mensch weniger ein Wesen, das von übermächtigen Trieben geleitet wird, noch spielen Triebschicksale bei der Entstehung des
- 45
- Charakters eine entscheidende Rolle. Für ihn ist der Charakter vielmehr eine schöpferische Reaktion, eine eigengewählte Ant- wort auf die Gegebenheiten der frühkindlichen Situation, ent- standen in der Auseinandersetzung zwischen persönlichen Stre- bungen und der äußeren Realität. Mit Freud stimmt Adler darin überein, daß die Eifersucht unsere Aufmerksamkeit durch ihre außerordentliche Häufig- keit fesselt. Dabei ist nicht nur die Eifersucht in Liebesbezie- hungen gemeint, sondern auch jene, die in allen anderen Bezie- hungen anzutreffen ist. In seinem Werk >Menschenkenntnis< (1927) führt er z.B. an, daß sie fast regelmäßig bei Kindern zu finden ist, besonders wenn ein jüngeres Geschwister geboren wird, das die Aufmerksamkeit der Eltern auf sich zieht. Das ältere Kind kommt sich wie ein entthronter König vor, beson- ders dann, wenn es sich vorher sehr umsorgt gefühlt hat. So schildert er den Fall eines Mädchens, das im Alter von acht Jahren aus Eifersucht drei Morde begangen hat.
- Sie w a r ein etwas zurückgebliebenes Kind, dem man infolge seiner Zartheit jede Arbeit abnahm, so daß es sich in einer verhältnismäßig günstigen Situation befand. Das änderte sich plötzlich, als sie in ihrem sechsten Lebensjahr eine Schwester bekam. In ihr ging eine völlige Wandlung v o r sich, sie verfolgte die Schwester mit einem wütenden Haß. D i e Eltern, die sich keinen Rat wußten, griffen strenge ein und versuchten, dem K i n d seine Haftbarkeit f ü r jede Untat klarzumachen. Da ereignete es sich eines Tages, daß in dem Bach, der am Dorf vorbeifloß, ein kleines Mädchen tot aufgefunden wurde. N a c h kurzer Zeit wiederholte sich dieser Fall, und endlich ertappte man dieses Mädchen in dem Augenblick, da es wieder ein kleines Mädchen ins Wasser gestoßen hatte. Sie gestand auch ihre Mordtaten ein, kam zur Beobachtung in eine Irrenanstalt und wurde schließlich einem Erzie- hungsheim übergeben. 4
- Die Eifersucht war in diesem Fall von der eigenen Schwester abgelenkt und auf jüngere Mädchen übertragen worden. Be- merkenswert dabei ist, daß das Mädchen gegen Knaben keine feindseligen Gefühle empfand. Die Aggression überkam sie lediglich im Zusammensein mit den jüngeren Mädchen, in denen sie wohl ihre jüngere Schwester sah. Durch die Tötung wollte sie ihr Rachegefühl für die ihr zuteil gewordene Zurück- setzung befriedigen. Noch leichter können nach Adler Eifersuchtsregungen zwi- schen Geschwistern verschiedenen Geschlechts wach werden.
- 146
- Auch heute noch ist es in unserem Kulturkreis üblich, Knaben mit besonderer Sorgfalt und Liebe zu behandeln und ihnen obendrein noch eine Reihe von Vorteilen gegenüber Mädchen einzuräumen. Kein Wunder, daß diese leicht in Unmut geraten und eifersüchtige Gefühle entwickeln. Aus diesem Verhältnis kann sich auch eine Art gesteigertes Wettrennen zwischen den Geschwistern ergeben. Das Gefühl der Zurücksetzung kann im Mädchen unablässig wie ein Stachel wirken, der es ständig vorwärts treibt und zu Leistungen führt, welche die des Jungen weit übertreffen. Grundsätzlich macht Adler zur Eifersucht folgende Ausfüh- rungen: Man erkennt sie an den Zügen des Mißtrauens, des Lauerns, des Messens und der steten Furcht, daß man nicht verkürzt werde. Welche F o r m mehr hervortritt, ist Sache der bis dahin gediehenen Vorberei- tung f ü r das gesellschaftliche Leben. Es kann eine Eifersucht sein, die sich selbst verzehrt, oder eine, die in ein waghalsiges, energisches Verhalten ausmündet. Sie kann erscheinen in der Spielverderberin, die versucht, den Rivalen herabzusetzen, oder im Bestreben, jemanden zu fesseln, seine Freiheit einzuschränken, um sich zum Herrn über ihn zu machen. Es ist eine überaus beliebte Methode, die Eifersucht in den Beziehungen der Menschen so zu placieren, daß der andere dadurch gewisse Gesetze bekommt. Es ist eine eigne seelische Linie, auf der sich ein Mensch bewegt, wenn er einem anderen z . B . ein Gesetz der Liebe aufzwingen will, wenn er den andern abschließen will, wenn er ihm vorschreibt, wie er seine Blicke zu lenken, seine Handlungen, ja sein ganzes Denken einzurichten habe. Die Eifersucht kann auch dem Z w e c k dienstbar gemacht werden, den anderen herabzusetzen, ihm V o r w ü r f e zu machen u. dgl. Alles aber sind Mittel, um dem anderen seine Willensfreiheit zu nehmen, um ihn zu bannen und zu f e s s e l n . . . Somit ist die Eifersucht eine besondere F o r m des Strebens nach Macht. 5
- Therapie der Eifersucht
- Für die Therapie psychischer Störungen gilt allgemein das Leitmotiv »Erkenne dich selbst<. Das ist nicht erst seit Beginn der tiefenpsychologischen Ära der Fall. Schon von Anfang des europäischen philosophischen Denkens an ist man der Mei- nung, daß allein die Erkenntnis seiner selbst zu Reife, Mensch- lichkeit und Vernunft führt. Anhand der Fragen >wer bin ich?<,
- 147
- >wie bin ich geworden, der ich bin?< und >wie stehe ich zu den gegenwärtigen Lebensfragen ?< soll man seine Gefühle, Gedan- ken, Motive, Träume, Einstellungen, Phantasien u.a.m. einer eingehenden Reflexion unterziehen. Gelingt dies, so sieht man sich im Laufe der Zeit in der Lage, zum eigenen Wesen gehörende Verhaltensweisen zu stabilisieren, störende abzule- gen und neue, die Person bereichernde hinzuzufügen. Die Therapie gelangt zu einem sinngemäßen Abschluß, wenn der Patient in großen Zügen ein annähernd richtiges Bild von sich selbst erarbeitet hat und sich in das gemeinschaftliche Leben produktiv einfügen kann. Neben dieser allgemeinen >Behandlungsvorschrift< gibt es in jeder Therapie eine Reihe spezieller Maßnahmen zu berück- sichtigen, die sich in unserem Fall wie folgt darstellen. Wir haben schon erörtert, daß im Eifersüchtigen unterhalb der Angst des Partnerverlustes eine zweite Angst existiert. Er fühlt sich nicht nur durch den vermeintlichen Verlust von Liebe und Zuwendung bedroht. Im tiefsten Innern ist er vielmehr davon überzeugt, daß sich mit der geliebten Person auch die Welt von ihm abwendet; sein ganzer Weltbezug kommt ins Wanken. Auch der >Normale< ist nicht frei von solchen Gefühlen. In gemilderter Form wird auch er von dem steten Bedürfnis geleitet, sich sowohl den Partner als auch andere lebenswichtige Beziehungspersonen gewogen zu halten. Sie sind ja unverzicht- bar für unser psychisches Weltbefinden. Sobald sich aber ein liebender Mensch von uns abwendet, gerät unser Weltbild ins Wanken. Die Distanz zur Umgebung vergrößert sich, der Betroffene atmet gewissermaßen >Höhenluft<. Wichtiger Be- standteil der Therapie ist es von daher, dem Eifersüchtigen eine verläßliche Welt anzubieten. Gelingt es, die Distanz des Patien- ten aufzubrechen und wirkliche Nähe herzustellen, so wird der Therapeut zum Vermittler zwischen Patient und Welt. Er zeigt dem Patienten, daß die Welt nicht so flüchtig ist, wie er es stets empfindet, und gibt ihm das Gefühl, eine verläßliche Weltbe- ziehung zu haben. Fast noch wichtiger als die Stetigkeit einer zwischenmensch- lichen Beziehung ist der Aufbau einer >Stetigkeit im eigenen Innern<. Der Eifersüchtige muß zu sich selbst eine von Kon- stanz und Festigkeit gezeichnete Beziehung herstellen, er muß sich seine eigene Lebensgeschichte verfügbar machen. Ein Mensch, der seinen eigenen Werdegang überblickt, assimiliert
- 148
- und bejaht, d.h. darauf verzichtet, wesentliche Teile von ihm abzuspalten, fügt seine Lebensgeschichte zu einer Ganzheit zusammen. Das ist zumeist ein langwieriger, mehrere Jahre in Anspruch nehmender Prozeß. Die Aufarbeitung von Kindheit, Pubertät und Jugend ist oft mit Schmerz verbunden, und es dauert einige Zeit, bis auch die schwierigen Entwicklungsperio- den als dazugehörig empfunden werden. Gelingt dies aber, so bleibt das nicht ohne ontologische Wirkung auf die Welt. Je stetiger man sich in seinem eigenen Werden begreift, um so mehr Konstanz gewinnt auch die äußere Welt. Besonderes Augenmerk muß der Therapeut auch auf Pessimis- mus, Hoffnungslosigkeit und Selbsthaß des Eifersüchtigen richten. Durch Wort und Ausdruck vermittelt dieser, daß er sich eine Zukunft ohne den Partner nicht vorstellen kann. Alle Wege scheinen ihm im Falle einer Trennung verschlossen; die Lebensperspektive endet im Nichts. Das liegt vor allem daran, daß der Eifersüchtige den Schwerpunkt seines Lebens nicht in sich selbst hat, sondern ihn auf andere, vornehmlich den Part- ner verlagert. Entsprechend ist auch der Umgang mit ihm. Er wird vergöttert und verabsolutiert und muß, da er den Mittel- punkt des eigenen Selbst verkörpert, ständig präsent sein. Entsprechend ist aber auch der Umgang des Eifersüchtigen mit sich selbst. Da nur derjenige umsichtig und liebevoll mit sich in Beziehung stehen kann, der sich anerkennt und bejaht, d.h. seinen Schwerpunkt in sich selbst findet, verfällt der Eifersüch- tige in Selbstzweifel und Selbsthaß. Deshalb muß neben der Aufarbeitung von Hoffnungslosigkeit, Pessimismus und Selbstzweifeln der Aufbau von Selbstliebe erfolgen. Sie ist das Fundament der >Freiheit zum Selbstsein<, die jeder produktiven Lebenshaltung zugrunde liegt. Hat man sie sich erobert, so wird man arbeits- und liebesfähig, und das Dasein bekommt einen Sinn, der aus Beitragsleistungen für die Allgemeinheit, d.h. in einer Lebensführung auf der Nützlichkeitsseite des Lebens besteht (Adler). Ein weiteres in der Therapie zu bearbeitendes Problem ist die als >Bestimm- und Dirigiersucht< zutage tretende Uberexpan- sion des Eifersüchtigen. Es ist ja eines seiner Charakteristika, daß er den Partner und auch andere nahestehende Personen immerzu bestimmen und dirigieren möchte. Er weiß genau, wie sie ihr Leben einzurichten haben, welche Kontakte sinnvoll für sie sind und welchen Personen sie unbedingt aus dem Wege
- 149
- gehen sollten. Es ist so, als wenn er in das Innere der anderen eindringen wolle. Für sich selbst sieht er keine Schranken. Der frühkindliche Hintergrund dabei ist tatsächlich ein großer, freilich neurotisierender Expansionsspielraum, der dem Patien- ten frei zur Verfügung stand. Ihm wurden von der Umwelt zu wenig Grenzen gesetzt. Immer durfte er ungehemmt seine Interessen verfolgen, Situationen bestimmen und Verhalten manipulieren, und dieses Verhalten setzt er nun als Erwachse- ner fort. Daher muß ihm der Therapeut mit Konsequenz begegnen. Er muß zu spüren bekommen, daß es Ich-Grenzen gibt und daß andere sehr wohl darauf bedacht sind, daß sie eingehalten werden. Erst wenn im Bewußtsein des Eifersüchti- gen die Ich-Grenzen anderer präsent sind, wird er fähig, eigene Ich-Grenzen aufzubauen. Zur Behandlung der Uberexpansion gehört auch das Erlernen »feiner Umgangsformen*. Der Eifersüchtige benimmt sich ja äußerst unzivilisiert. Wenn er zum Beispiel von seinem Partner verlangt, daß der keine anderen Männer (Frauen) anschauen darf oder zu einer bestimmten Uhrzeit anwesend sein muß, wenn er Wutanfälle bekommt und sich in Vorwürfen ergeht, dann hat das mit einem zivilisierten Benehmen nichts zu tun. Tatsächlich besitzt der Eifersüchtige ein Erziehungsdefizit, das in der Therapie ausgeglichen werden soll. Da das wahrschein- lich nur über die Identifikation mit dem Therapeuten geschehen kann, sollte er dem Patienten ausgesprochen höflich begegnen. N u r so besteht Hoffnung, daß der Patient den Umgangsstil des Therapeuten übernimmt und auf das zwischenmenschliche Ge- schehen überträgt. In die Therapie Eifersüchtiger sollen nach Möglichkeit auch deren Partner einbezogen werden. Kommt man mit ihnen in Kontakt, so fällt auf, daß es zumeist sehr weiche, nachgiebige Menschen sind, die selbst keinen festen Standort im Leben beziehen können. Egal was sie - aus dem Blickwinkel des Eifersüchtigen gesehen - auch immer tun, ein Sicherheitsgefühl vermitteln sie nicht. Da aber die Chance für die Heilung der Eifersüchtigen dann am größten ist, wenn der Patient auf sichere, innerlich geschlossene Menschen trifft, sollte sich sein Partner ebenfalls in Therapie begeben. In dem Maße, wie er Stetigkeit, Sicherheit, Zielbewußtsein bekommt, wird auch der Eifersüchtige seine Haltung ändern. Bei diesen Überlegungen muß aber eine besondere Schwierig-
- 150
- keit bedacht werden. Der Eifersüchtige ist ja jemand, der seinen engsten Beziehungspersonen und zumal seinem Partner indivi- duelle Entfaltung kaum zugestehen kann. Da er am liebsten alles kontrollieren und überwachen möchte, fühlt er sich in einer statischen Welt am wohlsten. Bewegung, Entwicklung und Wachstum sind ihm nicht geheuer. Sie bringen Unüber- schaubares, Uberraschendes mit sich, was für den Eifersüchti- gen eine Gefahr darstellt. Da er sich selbst nicht entwickeln kann, soll auch der Partner stagnieren. Der Partner wird zum Gefangenen degradiert, den man beliebig dirigieren kann. Wenn aber der Therapeut den Eifersüchtigen zu einer selbstän- digen Entwicklung motivieren kann, die ihn auch belastbar macht für eine sich dynamisch verändernde Welt, so wird er auch den Partner als lebendiges und vielschichtiges Wesen akzeptieren. So lernt er, sich aus seinen Ängsten und Erstarrun- gen zu befreien und das Leben als Wachstumsprozeß zu verste- hen. Damit kommt es auch zu einem vorläufigen Abschluß seiner Therapie.
- Ein Beispiel aus der Literatur
- Nachdem die wesentlichen Charakterzüge des Eifersüchtigen, die Bedingungen, unter denen sein Verhalten entstand, sowie die für die Therapie notwendigen Maßnahmen dargestellt wur- den, soll nun, dem Beispiel der Pioniere der Tiefenpsychologie, Freud, Adler und Jung, folgend, der Wahrheitsgehalt unserer Ausführungen an einem Werk der Weltliteratur überprüft wer- den. Es ist bekannt, daß bis um die Jahrhundertwende Men- schenkenntnis und Charakterkunde eher Sache der Dichter und Philosophen war. In vielen Werken der Weltliteratur, es seien hier nur die der französischen Moralisten Montaigne und La Rochefoucauld, der >Autobiographen< Rousseau und C. Ph. Moritz, oder der Romanciers, Stückeschreiber und Dichter Molière, Flaubert, Balzac, Schiller, Goethe und Lessing er- wähnt, finden sich >blutvollere<, lebensnähere und tiefgründige- re Charakterbeschreibungen, als sie der psychologischen For- schung jener Jahre zu entnehmen sind. Der Künstler scheint besonders prädestiniert dafür zu sein, Wesenseigentümlichkei- ten der Menschen klar zu erkennen. Seine Einsichten über das Denken, Empfinden, Handeln und Intuieren sind von einem
- 151
- umfassenden >Lebenswissen< geprägt, welches dem ungebro- chenen Verhältnis zum eigenen Unbewußten entspringt. So kann jedem an intelligenter Charakterkunde Interessierten das Studium der Weltliteratur nur dringend empfohlen werden. Zwar ist das intuitive Wissen der Dichter wenig systematisiert, doch liegt oft ein großartiges Material der Menschenbeobach- tung und -beurteilung vor, was auch aus der folgenden Darstel- lung der Charaktertragödie >Othello oder der Mohr von Venedig< ersichtlich werden wird. William Shakespeares 1604 in London uraufgeführtes Werk zählt zu den erschütterndsten und erfolgreichsten Dramen überhaupt. Wohl kein aufmerksamer Betrachter wird sich der eindringlichen Wirkung des Stückes entziehen können, das alle Nuancen menschlicher Emotionen vom aufrichtigen Mitgefühl bis zum tiefsten Abscheu zu wecken imstande ist. Ohne Um- wege führt Shakespeare in die Handlung ein. Der Erzschurke Jago, Fähnrich des in venezianischen Diensten stehenden maurischen Feldherrn Othello, und ein junger Vene- zianer namens Rodrigo eilen nachts zum Hause des Senators Brabantino, um ihm Mitteilung zu machen, daß Othello mit seiner liebreizenden Tochter Desdemona heimlich die Ehe ge- schlossen hat. Jago handelt mit Bedacht. Von dem Mohren bei einer Beförderung übergangen, fühlt er sich gedemütigt und versucht, einen teuflischen Racheplan in die Tat umzusetzen. Er ist sich bewußt, daß Othello ob seiner vielen erfolgreichen Kriegszüge für die Republik Venedig großes Ansehen genießt. Seine Zugehörigkeit zu einer anderen Rasse bedeutet aber eine schwere, für ihn nicht abzuschüttelnde Bürde. Als Schwarzer ist Othello nur ein Mann zweiter Klasse, dem die vornehmen Bürger mit Verachtung begegnen. Das läßt sich auch an der Reaktion Brabantinos erkennen. Zwar achtet auch er den kriegs- erfahrenen Helden - als Gemahl seiner Tochter will er ihn aber auf keinen Fall akzeptieren. So klagt er ihn vor dem Dogen der Entführung an. Doch die herbeigeholte Desdemona bekennt sich zu ihrem Gemahl, nachdem Othello mit ergreifenden Worten die Geschichte ihrer Liebe geschildert hat. Der Vater willigt schließlich ein, nicht ohne jedoch seiner tiefen Abnei- gung gegen die Verbindung, die er als widernatürlich empfin- det, mit nachfolgenden Worten Ausdruck zu geben:
- 152
- Ein Mädchen, niemals keck so still und schlicht von Geist, daß jede Regung sie schamrot machte; und sie - der N a t u r , den Jahren, L a n d , dem R u f zum Trotz und allem - verliebt in das, w o v o r ihr A u g e graust! N u r ein verkrüppelt ungesundes Urteil glaubt, daß Gesundheit so abirren kann von allen Regeln der Natur. 6
- Bevor der Doge ein endgültiges Urteil fällen kann, kommt die Nachricht, daß Zypern von den Türken bedroht wird. Man beschließt sogleich, Othello mit einer Flotte dem Feind entge- genzuschicken; Desdemona, Jago und sein Leutnant Cassio begleiten ihn. Auf Zypern setzt Jago seinen teuflischen Plan ins Werk. Desdemonas Liebe bedeutet für Othello die Erlösung aus dem Chaos des sozial Diskriminierten, das er trotz aller Feldherrnerfolge niemals überwinden konnte. Bislang war er immer der Ausgestoßene, der Einsame, mit Unruhe erfüllte Heimatlose, dessen karger Kriegsalltag durch die Liebe der zarten und sanftmütigen Frau mit Wärme und Licht erfüllt wird. Seine Worte: »Liebt' Ihr mich nicht, so kehrt das Chaos wieder«, lassen uns die Bedeutung dieser Verbindung für sein Seelenheil ahnen. Dies erkennt aber auch Jago, dessen Schur- keninstinkt seiner Rachelust den richtigen Weg'weist. Er sieht Othellos Verwundbarkeit und beschließt, den Seelenbrand an der Stelle zu legen, an dem es keine Löschung geben kann. Durch einige flinke Bemerkungen legt er in Othellos Gemüt den Keim des Zweifels an der treuen, hingebungsvollen Liebe Desdemonas. Er fällt auf fruchtbaren Boden. Eifersucht, Ver- zweiflung und Wahn bestimmen von nun an das Geschehen, das mit der Unerbittlichkeit eines Uhrwerks vor den Augen der Zuschauer seinem tragischen Ende entgegenläuft. Daß Othello so leichtgläubig auf die haltlosen Verdächtigungen Jagos eingeht, ist kein Zufall. Er ist in dieser Richtung dispo- niert. Da er nur wenig mehr vom Lauf der Welt versteht, »als was zum Streit gehört und Werk der Schlacht«, hat er ein tiefes Mißtrauen auf alles Zwischenmenschliche entwickelt. Nur zu oft ist er hintergangen und ausgenutzt worden; die Intrigen der Welt, in der er sich bewegt und seinen Geschäften nachgeht, haben tiefe Spuren in ihm hinterlassen. Tiefe emotionale Beziehungen waren ihm bisher fremd. Daher entbrennt er nun mit ungeheurer Leidenschaft, als ihm von
- 53
- Desdemona hingebungsvolle Zuneigung entgegengebracht wird. Seine Zweifel an sich selbst und sein immerwährendes Mißtrauen gegenüber der Aufrichtigkeit anderer verliert er dadurch allerdings nicht. Othello ist ein von Grund auf para- noider Charakter. Sich ewig verfolgt und bedroht fühlend, kann er auch in den Stunden der Ruhe und des Glücks seine Ubersensibilität nicht ablegen. Sich verraten zu fühlen, ist ihm vertrauter als geliebt zu werden. Der schurkische Jago weiß das geschickt für seine Pläne zu nutzen. Er ist zunächst darauf bedacht, Leutnant Cassio, der ihm bei besagter Beförderung vorgezogen wurde, um die Gunst Othel- los zu bringen. Danach erschmeichelt er sich Cassios Vertrauen und rät ihm, Desdemona aufzusuchen, damit sie bei Othello für ihn um Gnade bitte. Gleichzeitig macht er Othello gegen- über Andeutungen über eine angebliche Liebschaft zwischen Cassio und Desdemona, ja, er verdächtigt Desdemona, Leut- nant Cassio ihre Gunst erwiesen zu haben. Als diese sich tatsächlich lebhaft für Cassio verwendet, bricht in Othello eine Welt zusammen. Sich eben noch als glücklicher Liebhaber fühlend, wähnt er sich nun in das gefürchtete Chaos zurückge- stoßen, dem er durch Desdemonas Liebe zu entkommen hoff- te. Aller Friede entgleitet seinem Herzen, so daß er ausruft:
- O nun auf immer fahr hin geruhiger Sinn, fahr hin mein Friede! Fahrt hin helmbuschige Scharen, stolzes Heer, das Ehrgeiz macht zur Tugend, o fahrt hin! F a h r hin du wiehernd R o ß , du Sturmfanfare, herzhebende T r o m m e l , ohrdurchbohrende Pfeife, fürstlich Panier und alle Eigenschaft, Pracht, P o m p und Beiwerk des berühmten Kriegs! U n d o, tödlich Geschütz, des rauhe Kehle nachgemacht des ewigen Zeus entsetzlich Tosen, fahrt hin, Othello hat sein W e r k getan. 7
- Der paranoide Charakter ist durchaus keine so seltene Erschei- nung, wie gemeinhin angenommen wird. Jahre-, oft jahrzehn- telang kann er unauffällig in einer Scheinanpassung leben, ohne daß seine Angst- und Verfolgungsproblematik sichtbar wird. Das ist erst dann der Fall, wenn es in einem entscheidenden Lebensbereich (Liebe, Beruf, freundschaftliche Beziehungen) zu einer ernsthaften Erschütterung kommt. Aber auch dann muß es noch nicht zum Wahnausbruch kommen. Dies ist nach
- 4
- den Erkenntnissen der tiefenpsychologischen Forschung dann der Fall, wenn eine exemplarische Beziehung zerbricht und der Betreffende mit seiner Einsamkeit konfrontiert wird. In dieser Situation befindet sich Othello, als er von Jago den Beweis für Desdemonas Untreue fordert und diesen scheinbar erhält. Jago läßt durch seine Frau Emilia Desdemona jenes Taschentuch entwenden, das Othello ihr als erstes Liebespfand geschenkt hat. Er spielt es Cassio zu, der es arglos an eine Kurtisane weitergibt. Als Othello, von Jagos Lügen aufgestachelt, von Desdemona das Tüchlein fordert und sie es nicht beibringen kann, ist es um ihn geschehen. Er verliert alle Fassung, versinkt im Eifersuchtswahn und ist von nun an nur noch eine Mario- nette, die sich dem bösen Einfluß Jagos willig überläßt. Alsbald ist er nur noch zu einem Gedanken fähig: nämlich Rache für die ihm vermeintlich angetane Schmach zu nehmen. Reagiert schon der >normale< Paranoiker auf leichte Zurückwei- sungen mit Uberempfindlichkeit, Eifersucht und dem Mißdeu- ten der Gefühle anderer, und ist er nur allzu schnell bereit, jede Geste als unfreundlich, feindlich oder als bewußte Demütigung zu werten, so hat der Wahn in Othello einen wahren Sturm rachsüchtiger Gefühle ausgelöst. Er faßt den Entschluß, Desde- mona zu töten. Unfähig, zwischen Freund und Feind zu unter- scheiden, nimmt sein Haß überwältigende Formen an. Der Realitätsverlust ist vollkommen. Desdemonas Schwüre und Beteuerungen besitzen in seinen Augen nicht die Spur von Wahrheitsgehalt. Emilia, ihre Kammerzofe, wird zur heuchle- rischen Kupplerin erklärt, Jago hält er für einen ihm von Herzen zugetanen Menschen und den wackeren Cassio, der ihm tatsächlich treu ergeben ist, hält er für seinen Nebenbuhler. Am Orte ihrer >frevlerischen Tat<, dem Ehebett, soll Desdemo- na ihr Vergehen büßen. Wie ein brutaler Krieger würgt und ersticht er sie, während Desdemona, Othello noch im Tode nahestehend, ihn vor Verfolgung und Strafe zu schützen ver- sucht. Als Emilia das infame Ränkespiel Jagos entlarvt, erkennt Othello seine schauerliche Verfehlung. Schmerz und Verzweif- lung übermannen ihn, und er nimmt sich selbst das Leben.
- . . . und so endet die Tragödie der Schurkerei und der Eifersucht mit dem T o d e aller, die in sie verstrickt waren. Für den Zuschauer wird während des Ablaufes der gewaltigen und gewaltsamen Ereignisse klar, wie sehr der Mensch in seinen Gedanken und Mutmaßungen von der Realität abirren kann, wie kostbar das menschliche Leben ist und
- 55
- wie kompliziert alle menschlichen Beziehungen sind, an deren Bestand unser G l ü c k und U n g l ü c k hängt. Besonders tiefgründiger Einblick jedoch wird gewonnen in die Seele jener Selbstverächter, die infolge eines Mangels an Selbstliebe an die Liebe anderer nicht glauben können: Othello ist die Tragödie der Eifersucht eines Menschen, der durch einen zufälligen Makel (Hautfarbe) außerhalb der >Normalwelt< gestellt ist. 8
- 156
- Katja Kaminski/Martin Bauknecht
- Wut und Zorn
- Wut und Zorn sind Emotionen, die im Bereich der Aggres- sionsäußerungen angesiedelt werden. Obwohl man sie häufig synonym verwendet, lassen sich doch ganz beträchtliche Un- terschiede zwischen ihnen feststellen. Schon der Sprachge- brauch macht die Bedeutungsunterschiede sichtbar. So heißt es im Volksmund: >blinde Wut<, >tierische Wut<, »rasende Wut<, >Tollwut<, »Zerstörungswut* oder >von Wut besessen*, während der Begriff Zorn mit den Zusätzen »heiliger* oder »gerechter* Zorn oder sogar in der Formulierung »der heilige Zorn Gottes* verwendet wird. Bei Wut handelt es sich um einen eher undiffe- renzierten Gefühlszustand, der mit enormer Einengung des menschlichen Welt- und Werthorizonts (»blind vor Wut*) ein- hergeht, wohingegen der Zorn eine bewußtere Gefühlsäuße- rung ist, die sich gegen die Verletzung eines höheren Wertes richtet und Ausdruck eines entwickelten Wertempfindens ist. Bereits Homer macht von dieser Unterscheidung Gebrauch, indem er den Zorn des Helden Achill, ein Ausdruck seiner menschlichen Größe und seines gesellschaftlichen Ranges, der blinden Wut des rasenden Ajax gegenüberstellt. Ajax begann zu toben, nachdem er bei der Verteilung der Kriegsbeute benach- teiligt worden war, und tötete die Schafherden, weil die Tiere für ihn die Griechen verkörperten, die ihn gekränkt hatten. Wenn man diese Spur weiterverfolgt, liegt die Schlußfolgerung nahe, daß die Wut eine pathologische Erscheinung ist, hingegen der Zorn eine Tugend oder Fähigkeit, die mit Willensstärke, Mut und Lebenskraft verwandt ist. Allerdings war die Bewertung des Zorns als Tugend durch die Jahrhunderte hindurch einem starken Wandel unterworfen. In der Antike verurteilten die Stoiker Seneca und Plutarch den Zorn eindeutig als Laster und stellten ihn der hochgeschätzten Vernunft als Gegenspieler gegenüber. Das Christentum pran- gerte den Zorn sogar als eine der sieben Todsünden an. Erst in
- 157
- der Renaissance erfuhr diese Eigenschaft gewisse Aufwertun- gen, sie wurde hauptsächlich Männern mit Charakterstärke, Profil und Lebendigkeit zugeschrieben. Der Wandel in der Bewertung, der sich in erster Linie um die Fragestellung T u - gend oder Untugend< zentrierte, hing eng mit den kulturellen Bedingungen und Wertsystemen der verschiedenen Epochen zusammen. Erst mit dem Aufkommen der Psychologie gewann die Frage der Bewertung von Wut und Zorn eine neue Dimen- sion. Die Tiefenpsychologie brachte Wut und Zorn in einen Zusammenhang mit der frühkindlichen Entwicklung und such- te die innerpsychischen Konflikte zu ergründen, die beiden Affekten zugrunde liegen. Es ging nunmehr vornehmlich um die Frage nach seelischer Gesundheit bzw. Pathologie.
- Phänomenologie von Wut und Zorn
- Zorn oder auch gelegentliche Wutanfälle kennen sicher sehr viele Menschen. Wut und Zorn sind keine willkürlichen, zufäl- ligen Phänomene, sondern sie sind immer Ausdruck einer sehr angespannten Situation, die nur auf dem Hintergrund der Lebensstimmung und der Charakterstruktur eines Menschen verständlich wird. So können bei genauerer Betrachtung Ele- mente herausgefunden werden, die mit Wut oder auch mit Zorn verschwistert sind. Im Rahmen dieser Betrachtung wer- den die Unterschiede zwischen Wut und Zorn sehr plastisch. Ahnlich wie ein Mensch, der zu Haß neigt, ist auch ein Wütender in ständiger Alarmbereitschaft. Ressentiment, Ver- stimmtheit und Feindseligkeit verdüstern sein Gemüt. Die Welt eines Wütenden wird besonders in ihrer Widerständigkeit er- lebt. Ein wütender Mensch stößt immer wieder unwillkürlich auf die >Tücke des Objekts<, was seinem untergründigen Ärger stets neue Nahrung gibt. Nach Medard Boss nimmt ein auf Wut gestimmter Mensch alle ihm begegnenden Dinge und Menschen als widerständige Schranken wahr, die sich seinem Selbstsein entgegenstellen. Deshalb geht, so Boss, ein wütender Mensch stets auf Zerstörung und Vernichtung der ihm als hinderliche Barrieren erscheinenden Dinge aus. Dabei fühlt sich der Wütende nicht selbst für die Lebenshindernisse und Schwierigkeiten verantwortlich. Sie stürmen vielmehr von au- ßen auf ihn ein und entziehen sich seinem Einfluß, so daß er oft
- 158
- das Gefühl hat, vom Leben ungerecht behandelt zu werden. Er lebt in einer Grundstimmung, die ihm ständig suggeriert, ohn- mächtig und überfordert zu sein. Der Weltbezug eines solchen Menschen ist extrem eng und schmal. Der Wütende hat wenig Freiheitsspielraum, was sich unter anderem darin zeigt, daß er wenig Humor besitzt, kaum Distanz zu sich einzunehmen vermag und nur schwer über sich und seine Schwäche lachen kann. Die Perspektive ist ähnlich ichbezogen wie die eines verzogenen Kindes. Ein Kind denkt, wenn es an einen Tisch stößt, daß der Tisch es »höchst persön- lich* gemeint hat, und ist empört über die Unverfrorenheit des Tisches, ihm überhaupt auch nur im Wege zu stehen. Ganz ähnlich ist das Verhältnis eines Wütenden zu Hindernissen in seinem Leben. Die kindliche Perspektive der Wut zeigt sich auch in der Beziehung des Wütenden zur Zeit. Die Wut ist ein reines Augenblicksphänomen, Zukunft und Vergangenheit bleiben ausgeschaltet. Anders ist das Verhältnis des Zornigen zur Welt. Ein Mensch, der zornig reagiert, kreist nicht nur um sich selbst, sondern hat länger anhaltendes Interesse an einer Sache, nimmt leiden- schaftlich, >mit Leib und Seele* an der Welt teil. Im Zorn drückt sich das Empfinden von heftiger Empörung darüber aus, daß eine Wertordnung verletzt worden ist. Für den Zornigen schei- nen sich plötzlich die Weltbezüge zu verengen, sie sind beein- trächtigt. Er will nun in kraftvollem Protest den zur Rechen- schaft ziehen, der sein Moralempfinden verletzt hat, und die verletzte Wertordnung wiederherstellen. Der Zorn ist nicht getragen von dem Gefühl totaler Ohnmacht, sondern es liegt auch Hoffnung und Zuversicht darin. Der Zornige glaubt durch seinen Protest Entscheidendes bewirken zu können, die Perspektive der Zukunft ist also deutlich mitbeteiligt. Im Unterschied zum Wütenden sieht der Zornige die Umwelt nicht vernebelt, sondern sein Bewußtsein ist hell und bleibt voll funktionsfähig, auch wenn es sich für Momente verengt. Ein Zorniger weiß genau, warum er zornig ist und gegen wen er seinen Zorn richtet. Damit erscheint der Zorn kontrollierbarer und kann sich eher artikulieren als die Wut; der Zornige hat einen weitaus größeren Freiheits- und Handlungsspielraum. Das gesamte Gebaren des Wütenden ist laut, unkontrolliert und wild. Die Bewegungen eines Wütenden werden zackig und unharmonisch, genau entgegengesetzt etwa zu den schmiegsa-
- 159
- men Bewegungen eines Menschen, der sich einer Situation hingibt. Ein Wütender gleicht jemandem, der sich dem Erstik- ken nahe fühlt und durch die ungeheure Aufblähung seines Leibes die Beengung zu sprengen versucht. Er wirkt wie ein Wahnsinniger oder Alkoholkranker, was Seneca sehr ein- drucksvoll beschrieben hat:
- Damit klar w i r d , daß die v o m Z o r n (das lateinische W o r t >ira< ent- spricht dem hier dargestellten Begriff der Wut) Besessenen nicht bei Verstand sind, brauchst du bloß ihr Außeres a n z u s e h e n . . . ; der ganze K ö r p e r ist in einem Zustand der Erregung, ein Bild wüster D r o h u n g , gar übel anzusehen, wenn der Mensch sich so gehen läßt und bersten will v o r Z o r n . . . 1
- Der Körper eines Wütenden ist verspannt, verkrampft und wie gepanzert. Er kann sich - auch körperlich - nicht >einpassen<. Die Welt und der starre, wütende Mensch bleiben voneinander getrennt und stoßen sich aneinander wund. Ein Wütender reagiert gewissermaßen wie ein Dampfkessel. Der fehlende >Druckausgleich< führt zu einer Stauung. Die angestaute Erre- gung drückt sich dann häufig in psychosomatischen Sympto- men wie z.B. Bluthochdruck aus. Anders ist sowohl die Körperhaltung als auch der mimische Ausdruck und das Leibgeschehen eines zornigen Menschen. Die Haltung bleibt hier würdevoller, kontrollierter, und die Körperreaktion ist eher unauffällig. Obwohl sich der Zornige mit >Haut und Haaren< für eine Sache einsetzt, fehlt ihm das übertriebene und aufdringliche Gebaren des Wütenden. Im mimischen Bild des Zornigen dominiert das Auge. So sagt man von den Augen des zornigen Jupiter, daß sie blitzen; auch der Ausdruck >wenn Blicke töten könnten< geht auf das Bild eines vor Zorn brennenden Auges zurück. Zu Wut neigt jemand nur dann, wenn er sich selbst sehr schwach und unsicher fühlt. Jeder Wutanfall erwächst aus einem intensiven Ohnmachts- oder Verletztheitsgefühl. Man sieht das ohnehin brüchige Selbst in seiner Integrität bedroht. Der Wutanfall, der den ganzen Körper vibrieren läßt und sich bis in die Fingerspitzen hinein ausbreitet, kann ein Versuch sein, sich selbst und den anderen zu beweisen, daß man eben doch eine Persönlichkeit ist. Typisch ist der große Unterschied zwischen niedrigem Selbstwertgefühl und dem kompensatori- schen Größenideal. Ein Wütender will im Grunde nur so sein
- 160
- wie sein Ideal, und immer, wenn er in seinen Phantasien von der Realität gestört wird, bäumt er sich gegen die schmerzliche Korrektur auf. Ein wütender Mensch ist also immer auch ehrgeizig, eitel und perfektionistisch. Kern jeden Wutaus- bruchs ist auch eine ausgeprägte Willensschwäche, die wieder- um mit dem mangelnden Selbstwertgefühl zusammenhängt. Ein Wütender wünscht oft zu viel, d.h., ihm fehlt der Blick für ein realistisches Abwägen zwischen den eigenen Kräften und Fähigkeiten und dem von der Realität geforderten Kraftauf- wand: er überschätzt sich leicht. Ein willensstarker Mensch kann diese Kräfterelation hingegen sehr viel besser einschätzen und erlebt deshalb nicht so viele Mißerfolge und Enttäuschun- gen wie der Wütende. Zorn entsteht eher auf dem Boden eines kräftigen Selbstwertge- fühls. Er setzt Willensstärke und Mut voraus. Ein Zorniger ist in der Lage, sich für eine Sache einzusetzen, für etwas Uberper- sönliches zu kämpfen und dabei auch für gewisse Zeit auf die unmittelbare Anerkennung seiner Mitmenschen zu verzichten. Der Hunger nach Bestätigung, charakteristisch für den Wüten- den, ist untypisch für einen zornigen Menschen. Die Beziehung eines Wütenden zu seinen Mitmenschen ist durch starke Unsicherheit und Angst vor Nähe und Hingabe geprägt. In der Wut selbst ist das Gefühl der Verbundenheit mit der Welt und den Menschen sehr stark gelockert. Die »ande- ren*, durch deren Nähe oder bloße Existenz sich ein Wütender bedroht fühlt, weil sie die Macht haben, ihn so zu sehen, wie sie es wollen, ihn einfach zum Objekt ihrer Wahrnehmung machen können, werden im Wutanfall ausgeblendet. Der Wütende ist blind gegenüber seinen Mitmenschen und deren Weltsicht. Er bleibt deshalb völlig gefangen in seiner beklemmend engen Welt. Der Mitmensch wird weggestoßen, überrannt und damit »verkleinert*. Mit dem furchterregenden Gebaren, das in jedem Wutanfall liegt, flößt der Wütende seinem Gegenüber Angst ein, er will es ins Bockshorn jagen. Weil der Mitmensch für Minuten nicht mehr zu existieren scheint, äußert sich Wut ziellos und kommunikationsunfähig. Das Gegenüber fühlt sich kaum als Person angesprochen, sondern nur diffus verletzt. Das narzißtisch einsame Bezie- hungsmuster des Wütenden kommt ganz extrem bei Geistes- krankheiten wie z.B. Paranoia oder Manie zum Ausdruck. Der Kontakt zum Mitmenschen ist bei diesen Krankheiten, in de-
- 161
- nen Wut eine zentrale Rolle spielt, fast völlig abgerissen. Eigene Ängste und Haßgefühle werden auf die Bezugspersonen proji- ziert. Dem Paranoiker erscheint fast jeder Mensch als Verfol- ger, die ganze Welt hat sich scheinbar gegen ihn verschworen. Er meint dann schließlich, zu Verteidigungszwecken Wut oder sogar Gewalt mobilisieren zu müssen, um überhaupt seine Haut retten zu können. Die Formulierungen >wahnsinnige Wut<, »von Wut besessene zeigen die Verwandtschaft zwischen Wut und Geisteskrankheiten. Auch Spinoza bezeichnete die Affekte in seiner >Etbik< berechtigterweise als >kleine Geistes- krankheiten^ Ganz anders ist die Beziehung eines Zornigen zu seinen Mit- menschen. Philipp Lersch charakterisiert den Zorn als ein »gerichtetes Gefühh, d.h. Zorn zielt auf ein konkretes Gegen- über ab. Obwohl sich auch Zorn machtvoll ausdrückt, über- rennt er nicht das Gegenüber, sondern er steuert direkt darauf zu. Der Zornige formuliert sein Anliegen, kleidet es in Worte, die genau auf das Gegenüber zugeschnitten sind. Ein Zorniger ist nicht in seiner eigenen Welt gefangen, sondern er bezieht die Welt des Gegenübers in seine Perspektive ein, er vermag sich in sein Gegenüber einzufühlen, um zu erahnen, wie er seinen Zorn gezielt beim Gegenüber anbringen kann; denn er will um jeden Preis, daß der andere sein Anliegen versteht, er will etwas Wichtiges bewirken und drückt durch den Zorn aus, daß er an eine Veränderung glaubt. In diesem Sinne hat Zorn, wie Höl- derlin schreibt, »etwas Reinigendes, ihm wohnt eine Schöpfer- kraft inne... Er tötet und verzehrt das Erstarrte, das Gesetzte, daß es lebendig werde« (P. Bertaux, >Friedricb Hölderlin<, Frankfurt 1978, S. 293, 295). Hölderlin, der den Zorn als etwas Göttliches betrachtet, sieht in ihm die Quelle jeden Neuan- fangs, von Schöpfung und von Selbsterkenntnis. Ähnlich ver- wendet auch Nietzsche den Zornbegriff, wenn er schreibt: »Der Zorn schöpft die Seele aus und bringt selbst den Boden- satz ans Licht« (F. Nietzsche, > Menschlich es, Allzumenschli- ches< II, München 1969, S. 763). Der Zornige gibt mit seinem Standpunkt auch sich selbst den anderen preis. Im Zorn bringt er sich kraftvoll ein und ringt mit der Welt um eine Einigung. Im Gegensatz zum Gegenüber eines Wütenden fühlt sich dasjenige eines zornigen Menschen stark angesprochen, vielleicht sogar bis ins Mark getroffen. Freud schildert in seinem Aufsatz über die Figur des Moses von
- 162
- Michelangelo das Gefühl eines Menschen, der sich vom Zorn getroffen fühlt: Denn ich habe von keinem Bildwerk je eine stärkere Wirkung erfah- ren. Wie oft bin ich die steile Treppe vom unschönen C o r s o C a v o u r hinaufgestiegen zu dem einsamen Platz, auf dem die verlassene Kirche steht, habe immer versucht, dem vcrächtlich-zürnenden Blick des H e r o s standzuhalten, und manchmal habe ich mich dann behutsam aus dem Halbdunkel des Innenraumes geschlichen, als gehörte ich selbst zu dem Gesindel, auf das sein A u g e gerichtet ist, das keine Uberzeugung festhalten kann, das nicht warten und nicht vertrauen will und jubelt, wenn es die Illusion des Götzenbildes wieder bekom- men hat. 2
- Der appellative Charakter des Zorns wird hier sehr deutlich zum Ausdruck gebracht.
- Charakterologie der Wut
- Die bisherigen Ausführungen haben ergeben, daß der Zorn nicht als ein Ausdruck einer festgefügten Charakterstruktur, sondern als eine Fähigkeit anzusehen ist, die eine sich entwik- kelnde Persönlichkeit im richtigen Moment und in der richtigen Situation einzusetzen weiß. Im Unterschied zum Zorn ist die Wut als ein fester Bestandteil einer Charakterstruktur beschrie- ben worden, die weitgehend unabhängig von der Vielfalt der äußeren Ereignisse in einer vorhersehbaren Regelmäßigkeit und fast wie unter einem Zwang in Erscheinung tritt. Aus diesem Grunde beschränkt sich der folgende Abschnitt auf die Darstel- lung der Charakterstruktur des Wütenden und ihrer Entste- hung anhand der Theorien verschiedener Schulen der Tiefen- psychologie. Sigmund Freud führt die Wut hauptsächlich auf drei unter- schiedliche Bedingungen zurück. Eine davon ist für ihn die Reaktion auf Versagungserlebnisse, die um so schmerzlicher empfunden werden, je maßloser die Wünsche nach verwöhnender Zuwendung sind. So tritt Wut hauptsächlich in der Entwicklungsgeschichte desjenigen auf, dem es als Kind überdurchschnittlich schwerfiel, auf lang ver- traute und lustvolle Gewohnheiten zu verzichten. Zu zentralen Versagungserlebnissen im Leben eines Kindes kommt es, wenn es der Mutterbrust entwöhnt wird oder wenn es Reinlichkeit
- 163
- lernen muß. In diesen Entwicklungsphasen reagieren Kinder häufiger als sonst mit Wut. Als eine weitere Erklärung für von Wut bestimmtes Verhalten nennt Freud die Herausbildung verschiedener Formen der Triebenergie. So kann Wut als eine Äußerung der kindlichen Partialtriebe verstanden werden, wie z.B. des oral-sadistischen Partialtriebs, der sich zeigt, wenn das Kind in die Mutterbrust beißt, oder des anal-sadistischen, der hauptsächlich im Zurück- halten von Kot besteht. Diese Partialtriebe verwandeln sich nach Auffassung Freuds nicht notwendigerweise in höherent- wickelte Formen der Libido, sondern können im Falle von Entwicklungsstörungen zu Fixierungen führen, die das Kind daran hindern, sein orales oder anales Triebverhalten aufzuge- ben und eine gewisse Vielfalt von Triebreaktionen auszu- bilden. Im Anschluß an sein Konzept von den kindlichen Fixierungen beschreibt Freud die Wut im Erwachsenenalter als eine Regres- sion, als ein Zurückfallen auf Formen der Triebbefriedigung, die in der Kindheit eingeübt und beibehalten worden sind. In diesem Sinn kann Wut als infantiler Versuch, Probleme zu lösen, verstanden werden. Freuds Triebmodell läßt jedoch die Frage offen, warum für den einen bestimmte Erlebnisse eine ungeheure Frustration bedeuten, während ein anderer diesel- ben Ereignisse gelassen hinnehmen kann. Die unterschiedliche Intensität der Wut führt Freud im wesent- lichen auf die Triebanlage eines Menschen zurück. So nimmt er z.B. an, daß Männer deshalb im Durchschnitt aggressiver sind als Frauen, weil der männliche Sexualtrieb mit mehr Aggres- sionsenergie ausgestattet ist. Bei Alfred Adler gilt die Wut als ein »trennender Affekt< und als Kompensationserscheinung eines sich schwach und minder- wertig fühlenden Menschen, der ein gesundes Selbstvertrauen durch eine das Ich stärkende Eingliederung in die Gemeinschaft nicht entwickeln konnte. Sein ausgeprägtes Minderwertigkeits- gefühl versucht er durch Macht- und Geltungsstreben auszu- gleichen. Folglich besteht sein Lebensziel in dem Wunsch, seine Mitmenschen zu übertrumpfen und aus allen Lebenssitua- tionen als der Stärkste und Größte hervorzugehen. Adler bringt die Wutausbrüche eines Menschen mit Situationen in Zusam- menhang, in denen sein neurotisches Ziel, Größe und Überle- genheit um jeden Preis aufrechtzuerhalten, durch bestimmte
- 164
- Erlebnisse in Frage gestellt wurde. In solchen Situationen dient die Wut für den Betreffenden als ein seit langem bewährtes Mittel, sich wieder als Herr der Lage zu fühlen. Indem er sich aufplustert, anderen damit angst macht und sie verkleinert, dreht er in einem Moment, in dem er sich sehr ohnmächtig fühlt, den Spieß um. Die Angst des Wütenden vor Schwäche, vor Unterlegenheit und vor der Möglichkeit, in den Augen anderer als Objekt dazustehen, ist so groß, daß er fast jede Hingabesituation, von anderen Menschen als Quelle des Glücks empfunden, durch Wutausbrüche zerstört. Die Frage, welche Erziehungseinflüsse das Entstehen eines wütenden Charakters begünstigen, beantwortet Adler mit dem Hinweis auf die Verzärtelung und die Verwöhnung als Haupt- quellen späterer Aggressionen. Charakteristisch für verwöh- nende Erziehung ist die Tatsache, daß die Mutter häufig selbst liebeshungrig ist und in der Beziehung zum Kind ihre übertrie- benen Liebeswünsche auslebt: sie versucht das Kind in eine allzu große Abhängigkeit zu zwingen, um sich so selbst zu bestätigen. Ein Kind wächst dann wie >in Watte gepackt* auf und fühlt sich später angesichts der weniger liebevollen Realität ständig frustriert und enttäuscht. Auch eine sehr harte Erziehung kann nach Adler zu der Bereit- schaft führen, mit Wut gegen die äußeren Lebensumstände anzukämpfen. Eine autoritäre Erziehung vermag zwar den Eigenwillen des Kindes sehr bald zu brechen; dieses paßt sich jedoch nur scheinbar an, während sich sein Gemüt durch das Ausbrüten sadomasochistischer Phantasien verdüstert. Im Lau- fe von unzähligen Demütigungssituationen beginnt das Kind, auf Rache zu sinnen. Damit wird der Grundstock gelegt für die Entwicklung zum autoritären Charakter, der Autoritäten ge- genüber sich zwar häufig fügt, seine Wut jedoch bei Schwäche- ren oder Untergebenen auslebt. Adler legt besonderes Gewicht auf den Mechanismus der Iden- tifizierung, der bei der Charakterbildung eine entscheidende Rolle spielt. So kann es geschehen, daß Kinder einen Elternteil wegen seines durch die Wut bestimmten Charakters bewun- dern, da sie Wut mit Stärke und Ansehen gleichsetzen. Gerade wenn sich ein Kind besonders minderwertig fühlt, greift es zu dem vorgelebten Aggressionsverhalten, um seine Unzuläng- lichkeit zu überdecken. Nach Auffassung des Adler-Schülers Fritz Künkel neigt der
- 165
- >Startyp< sehr leicht dazu, mit Wut zu reagieren. Er möchte immerzu im Mittelpunkt stehen und erwartet, daß ihm Hinder- nisse und Schwierigkeiten abgenommen werden. Wenn dies nicht geschieht, wenn andere etwas anderes wollen als er selbst, oder wenn er ein Ziel nicht ganz besonders schnell erreicht, bietet sich ihm die Wut als ein naheliegendes Mittel an, um mit der Widerständigkeit der Realität fertig zu werden. Die Grund- stimmung eines solchen Menschen besteht in Ungeduld und Anspannung. Karen Horney sieht in der Wut eine Zerrform der Bewältigung neurotischer Grundangst. Wut als vorherrschende Stimmung läßt sich ihrer Meinung nach besonders bei den »narzißtischem und den >arrogant-rachsüchtigen< Typen beobachten, die beide eine »expansive Lösung< wählten, um ihr psychisches Uberle- ben zu sichern, die also aus ihrer Angst heraus die Konfronta- tion mit ihren Mitmenschen suchen. Die Aufmerksamkeit des narzißtischen Typs ist ständig auf das eigene Ideal-Ich gerichtet. Er will nicht nur groß sein, sondern auch von den anderen dafür gehalten werden. Deshalb ist er abhängig davon, daß seine Mitmenschen ihn ununterbrochen bewundern und ihm bestätigen, wie großartig er ist. Dabei spürt er durchaus Angst vor der Macht, die andere deshalb über ihn gewinnen; sein Bedürfnis nach Unabhängigkeit wird nicht befriedigt. Die Wut des Narzißten, die dann ausbricht, wenn er durch Mißerfolge oder Kritik mit seinem realen Selbst konfron- tiert wird, interpretiert Horney einerseits als Ausdruck von Selbsthaß - das schwache, verachtete Ich soll zerstört werden -, andererseits als Versuch, sich in ein Machtgefühl hineinzustei- gern und sich auf diese Weise dem idealen Selbst wieder zu nähern. Solche Menschen empfinden ihr Verhalten oft mehr oder minder bewußt selbst als Heuchelei und leiden dann unter nagenden Selbstzweifeln. Sie leiden unter ständiger Angst, die Diskrepanz zwischen ihrem realen und ihrem idealen Selbst könne entdeckt werden und sind erfüllt von Anspannung und Scham. Wie am »narzißtischem T y p läßt sich auch am »arrogant-rach- süchtigen< ein ausgeprägt anspruchsvolles Verhalten beobach- ten. Er meint immer, besondere Behandlung verdient zu haben. Horney deutet das folgendermaßen: Bei genauerem Hinsehen erweisen sich seine Ansprüche jedoch als Forderungen auf Wiedergutmachung f ü r erlittenes Unrecht. Um diese
- 166
- Basis seiner Ansprüche zu festigen, muß er natürlich erlittenes Un- recht hegen und lebendig halten, sei es uralt oder neu.3 Harry Stack Sullivan, der sich eingehend mit sehr frühen psychischen Schäden befaßt hat, beschreibt ausführlich, wie sich die Bereitschaft zu Wutreaktionen schon in der frühen Mutter-Kind-Beziehung entwickelt, wenn diese unharmonisch und unbefriedigend verläuft. Sullivan sieht in der Wut eine archaische Reaktion auf tiefe Verunsicherung und Angst. Angst, Nervosität und Reizbarkeit der Mutter wirken sich auf das Kind aus, das auf Grund seiner Empathie ihre Affekte unmittelbar wahrnimmt, selbst wenn die Mutter sie vor dem Kind zu verbergen sucht. Das Kind entwickelt daraufhin sei- nerseits starke Angst, die es durch eigene Abwehr- oder An- griffshaltungen übertönen möchte. Die feindseligen, aggressi- ven Reaktionen des Säuglings - Sullivan bezeichnet einen sich blau schreienden Säugling als den Inbegriff der Wutäußerung - provozieren wiederum Feindseligkeiten bei der Mutter, die sich in ihrer Zuneigung und ihrem mütterlichen Stolz verletzt fühlt und das Kind ablehnt, weil es ihren Wunschvorstellungen nicht entspricht, wodurch sie neue Angst und Feindseligkeit im Kind hervorruft. Es entsteht eine Affektspirale von Angst und Aggression. Die Wut, die Sullivan als »gesteigerte Form von Zorn< bezeich- net, übernimmt die Funktion eines Sicherungsapparats für das Selbst. Die Wut ist also einerseits Ausdruck eines schon defek- ten Selbst, andererseits eine sinnvolle Reaktion, weil sie ein schwaches, schutzloses Selbst vor feindlichen Umwelteinflüs- sen teilweise abzuschirmen vermag. Die Abwehr- und Schutz- funktion der Wut hat allerdings auch eine Kehrseite; denn sie beeinflußt die Umwelt im Sinne einer Verstärkung des dem Selbst entgegenkommenden Feindseligkeitspotentials. In Heinz Kohuts Theorie der Wut vereinigen sich Elemente Adlers, Horneys und Sullivans. Auch Kohut sieht im Zentrum eines zu Wut neigenden Charakters ein schwaches Selbst. Er verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff der »narzißti- schen Wut<, die seiner Meinung nach bei einem bestimmten Menschentyp auftritt, nämlich bei der sogenannten »narzißtisch gestörten Persönlichkeit*. Charakteristisch für die narzißtische Persönlichkeit ist ein schon während der frühen Mutter-Kind-Beziehung entstande- ner Defekt in der Selbststruktur eines Menschen. Häufige
- 167
- Frustrationen, die das Kind in einer feindseligen Beziehung zur Mutter erfährt, und das Ausbleiben von Identifikationsprozes- sen, die das Selbst des Kindes stabilisieren, hindern es daran, ein Gefühl für seinen eigenen Wert zu entwickeln. Das unter- entwickelte Selbst des späteren Erwachsenen nimmt deshalb die Realität nicht angemessen wahr und vermag die Beziehung zwischen sich und der Umwelt nicht realistisch einzuschätzen. Es bleibt ihm nur der kindliche Traum erhalten, ein »grandioses Selbst< zu besitzen, allmächtigen Einfluß auf die nahestehenden Bezugspersonen zu nehmen und mit denjenigen von ihnen zu verschmelzen, die von ihm idealisiert werden. Denn er hat die Erfahrungen, die zu einer realistischen Selbsteinschätzung füh- ren - Kohut bezeichnet diese als »transmutierende Internalisa- tion<, d.h. die Verinnerlichung der >guten< Mutter als Grundla- ge für den Aufbau des Selbst - nur in unzureichendem Maße gesammelt. Ahnlich wie Adler und Horney beschreibt Kohut bestimmte Situationen, die narzißtische Wut auslösen. Ein narzißtisch gestörter Mensch wird immer dann mit ziel- und grenzenloser Wut reagieren, wenn seine um die eigene Großartigkeit krei- sende Phantasie von der Realität gestört wird oder wenn er spürt, daß seine »idealisierten Selbstobjekte<, d.h. die überhöh- ten Vorstellungen von einem oder von beiden Elternteilen, in Frage gestellt werden, oder wenn er keine Kontrolle über diese »Selbstobjekte< ausüben kann. In diesem Zusammenhang deutet Kohut die Wut als Reaktion auf ein intensives Schamgefühl. Wut und Scham sind seiner Meinung nach zwei unterschiedli- che Außerungsformen ein und derselben Persönlichkeits- struktur. Sehr plastisch stellt Kohut den Zustand und die Dynamik der Wut dar. So wird in der Wut das Gegenüber nicht als eigenstän- dige Person gesehen, sondern es verschwimmt mit dem eigenen gekränkten Selbst. Wut zielt auf die Auslöschung des anderen in seiner Eigenständigkeit und ist deshalb nahezu grenzenlos. Die »gesunde Aggression jedoch, die dem oben definierten Begriff des Zorns ungefähr entspricht, hört dann auf zu existie- ren, wenn sie ihr Ziel für erreicht hält. Ein narzißtischer Mensch betrachtet sein Gegenüber als eine Art »Störunge in einer Welt, die er ausschließlich in seiner narzißtisch-ichhaften Art und Weise wahrnimmt. Schon die bloße Andersartigkeit oder auch die Unabhängigkeit eines
- 168
- Menschen, der zudem noch das Ich des Narzißten eventuell anders beurteilt, als dieser es sich wünscht, stört das eigene Weltbild und wird zur Bedrohung. Die Kränkungen, die zu den heftigen Wutreaktionen führen, sind oft nicht einmal real vorgekommen, sie sind reine Phantasieprodukte. Deshalb kann ein Außenstehender oft nicht mehr nachvollziehen, wie es zu dem Wutausbruch kam. Aus dem kurzen Überblick über die verschiedenen tiefenpsy- chologischen Theorien zur Charakterologie der Wut geht her- vor (darin sind sich die erwähnten Autoren einig), daß der zu Wut neigende Charakter in seiner Kindheit keine Möglichkei- ten hatte, ein starkes Ich aufzubauen. Auch im Erwachsenenal- ter erkennt er nur selten, wie er aus eigenem Antrieb und mit Hilfe der anderen sein Ich stabilisieren könnte. Mit ihren Beiträgen zum Verständnis eines wütenden Charakters haben die erwähnten Autoren die tiefenpsychologische Begründung für ein Verhalten geliefert, das im vorhergehenden Abschnitt über die Phänomenologie der Wut als unmittelbarer Gesamt- eindruck von einer wütenden Persönlichkeit beschrieben wur- de. Wenn man versucht, die Erscheinungsform der Wut verein- facht darzustellen, kann man behaupten, daß sie in den meisten Fällen als ein sofort in die Augen springender und als ein deutlich spürbarer Affekt in Erscheinung tritt. Daß jedoch Wut auch Äußerungsformen animmt, die ihre Wirkungen im ver- borgenen entfalten und die auf den ersten Blick nicht wahrge- nommen werden können, versucht der folgende Abschnitt über die durch Wut hervorgerufenen psychosomatischen Erkran- kungen nachzuweisen.
- "Wut und Psychosomatik
- Wut spielt bei der Entstehung von psychosomatischen Sympto- men und bei Depressionen eine entscheidende Rolle. Der A f - fekt äußert sich hier nur indirekt und wendet sich zunächst gegen die eigene Person. Er trifft die Mitmenschen lediglich auf dem Umweg der Selbstschädigung des Wütenden, die jedoch häufig durchaus provokatorischen Charakter hat. Zum entwicklungsgeschichtlichen Hintergrund der Entstehung verborgener Wut lassen sich bei Sullivan wichtige Hinweise finden. Seiner Auffassung nach haben die an Wut psychosoma-
- 169
- tisch Erkrankten in ihrer Kindheit Aggressionen zwar offen gezeigt, sind aber mit diesen Äußerungen auf massiven Wider- stand von Seiten der Umwelt gestoßen. So lehnen manche Eltern ein Kind ab, sobald es Wut zeigt, strafen es und verbie- ten damit von vornherein jede Wutäußerung. Bald koppelt sich dann im Kind die Wut mit der Angst vor der Wut. Es beginnt, seine Affekte aus Angst vor der elterlichen Ablehnung zu unterdrücken und zu verdrängen und sinnt unwillkürlich auf andere Formen der Aggressionsverarbeitung und Wutäuße- rung. Oft entwickelt sich gleichzeitig mit der Verdrängung von Wut auch eine Hemmung der »gesunden Aggression^ die psychische Voraussetzungen für Selbstbehauptung und Expansion bietet. So kommt es, daß der vernünftige Umgang mit Wut und mit Aggression nicht erlernt wird. Neben der Angst vor der Wut des Gegenübers, der man nichts entgegenzusetzen vermag, bleibt eine untergründige Angst bestehen, man könne von den eigenen, unberechenbaren Wutgefühlen völlig überschwemmt werden. Die daraus sich entwickelnden, verborgenen Formen der Wut enthalten zwei Aspekte, die im Zusammenhang mit den hier ausgeführten Überlegungen von besonderer Bedeu- tung sind. Zum einen schädigt die Wut in Form von psychosomatischen Symptomen und Depressionen die eigene Person, da diese unter ihnen immer intensiv leidet. Freud beschreibt am Beispiel der Depression sehr anschaulich, wie sich ein Melancholiker vor Selbsthaß geradezu >zerfrißt<, indem das unerbittlich harte Über-Ich sich gegen das schwache Ich wendet und dessen Handlungsfähigkeit vermindert. Ebenso beinhaltet jedes psy- chosomatische Symptom eine Selbstaggression. Man denke nur an das Magengeschwür, bei dem der Magen sich selbst verdaut, oder auch an Anfallsleiden, die schon in ihrem Erscheinungs- bild Angriffen auf sich selbst gleichen. Ganz extrem kommt die Selbstaggression beim »status asthmaticus< zum Ausdruck, der sehr häufig zum Tod, also zur totalen Selbstzerstörung, führen kann. Die andere Seite der unauffälligen Arten der Wutverarbeitung besteht jedoch darin, daß sie einem Menschen oft einen gewis- sen Schonraum oder auch einen Ersatz für den Sinn des Lebens einzubringen vermögen, was Adler als den >Krankheitsgewinn< bezeichnet und unter dem finalen Aspekt interpretiert. Ein
- i/o
- Kind zum Beispiel, das unter Kopfschmerzen leidet, wird meist von der Mutter gepflegt und mit liebevoller Zuwendung be- lohnt, statt, wie es bei der offenen Wut der Fall ist, auf Ablehnung zu stoßen. Auch durch eine Depression kann ein Wütender indirekt sein Ziel erreichen: er erhält einerseits eine Sonderbehandlung und man nimmt ihm Aufgaben ab, deren Bewältigung er sich nicht zutraut. Andererseits verdirbt er seinen Bezugspersonen die gute Stimmung und Lebensfreude. Dies kann eine fast schlimmere Strafe sein als die offen geäußer- te Wut, was im Sinne von Nietzsche verstanden werden soll, der einmal geschrieben hat, daß »Klagen immer auch Anklagen sind<. In diesem Zusammenhang muß auch der Gedanke von Arthur Jores erwähnt werden, der alle psychosomatischen Symptome und auch die Depression als Ersatz für nicht gelebtes Leben oder für mangelnde Liebesfähigkeit versteht. Oft brechen psy- chosomatische Symptome dann aus, wenn ein Mensch zu lie- ben aufhört, was z.B. nach einer zu Ende gegangenen Partner- schaft der Fall ist. In solchen Situationen verleihen die Sympto- me den Wut- und Enttäuschungsgefühlen über die fehlende Zuwendung oder die verlorengegangene Liebe beredten Aus- druck. Im Zentrum vieler Theorien psychosomatischer Erkrankungen steht der Gedanke von der Aggressionshemmung als Hauptur- sache des körperlichen Leidens. Wie oben erwähnt, gehen Aggressionshemmung und verborgene Wut meist Hand in Hand. Franz Alexander, ein Pionier der Psychosomatik, teilt die psychosomatischen Erkrankungen in zwei verschiedene Kate- gorien ein. Seiner Ansicht nach kann die erste Kategorie der Symptome - hierzu zählen Hypertonie, Herzneurose, Migräne und Hauterkrankungen - als Hemmung des Angriffs- oder Fluchtverhaltens interpretiert werden. Der Körper gerät in Aufruhr, ohne tatsächlich handlungsfähig zu sein. Alexander beschreibt diesen Vorgang unter physiologischem Aspekt: der Körper ist durch die Aktivierung des sympathischen Nervensy- stems auf Kampf eingestellt, es besteht jedoch eine psychische Hemmung, den vorbereiteten Angriff in die Tat umzusetzen. Die bereitgestellte Energie bleibt im Körper stecken und stört den Ablauf der vegetativen Funktionen. Die daraus resultieren- den, fehlgesteuerten Körperreaktionen bleiben Schein- oder
- Ersatzhandlungen; denn der echte Handlungsimpuls ist im Ansatz blockiert. Die zweite Gruppe der Symptome, die nach Alexander Magen- geschwüre, Darmerkrankungen, Asthma und Eßstörungen umfaßt, gehen auf die unzweckmäßige Uberaktivierung des parasympathischen Nervensystems zurück und gründen haupt- sächlich auf unerfüllten, oft maßlosen Liebes- und Verwöh- nungswünschen. Hinter diesen Symptomen steht ebenfalls hef- tige, unbewußte Wut, die aus Enttäuschungen wegen unbefrie- digter Geborgenheitswünsche resultiert. Siegfried Elhard bezeichnet die in psychosomatischen Sympto- men enthaltene Wut als »defensive Aggression«;. Erkrankungen wie z.B. Erbrechen, Ulcus, psychogene Harnsperre, Hyperto- nie oder Diabetes mellitus entstehen stellvertretend für eine fehlende Selbstbehauptung. Sie dienen der Verteidigung und sind in diesem Sinne für den Erkrankten nützlich. Der Körper teilt durch seine Funktionsstörung die Botschaft mit, daß der Kranke sich zuviel vorgenommen hat oder von anderen Men- schen zu stark in Anspruch genommen worden ist. Die Krank- heit schafft dann eine Rückzugsmöglichkeit, einen Schonraum, was dem Patienten die Chance gibt, über sich nachzudenken. Dieter Beck bezeichnet deshalb die psychosomatische Erkran- kung auch als Selbstheilungsversuch. Psychosomatische Symptome deuten nicht nur darauf hin, daß Wut nicht mehr mitgeteilt werden kann, sondern daß sie nicht einmal mehr dem Erleben des Betreffenden zugänglich ist. Das körperliche Symptom tritt als Ersatz für Sprache und Empfin- dung in Erscheinung. Es muß als Verhaltenshieroglyphe vom Therapeuten entziffert werden. Wenn dies gelingt, kann dem Kranken zu wichtigen Einsichten in Ursachen seiner Werdens- hemmungen verholfen werden. Medard Boss nimmt an, daß den psychosomatischen Sympto- men, den Depressionen und der offenen Wut eine enorme Gestaltfeindlichkeit gemein ist. Wie ein ewig Trauernder oder ein durch körperliche Symptome geplagter Mensch macht auch ein Wütender einen verkrampften, entstellten und häßlichen Eindruck. Es wird also deutlich, daß eine Verdrängung, Unterdrückung oder Nach-Innen-Wendung der Wut ebenso ungesund und pathologisch ist wie die zuvor beschriebene offene Wut. Psychosomatische Symptome dürfen aber nicht nur als Folge-
- 1 72
- erscheinungen der Unterdrückung von offener Wut gedeutet werden, sondern sie lassen sich auch als Ergebnis der Unfähig- keit, soziale Ungerechtigkeit und inhumane Lebensbedingun- gen im Beruf und in der Familie mit berechtigtem Zorn zu beantworten, interpretieren. Diese Unfähigkeit, Gefühle des Zorns zu äußern, und die daraus resultierende Neigung zu offener und versteckter Wut treten innerhalb unserer Gesell- schaft in einer solchen Häufigkeit auf, daß sie als ein Problem- komplex der Massenpsychologie betrachtet und untersucht werden müssen.
- Zur Massenpsychologie von Wut und Zorn
- Wut und Zorn sind besonders wegen ihres offensiven, lauten, nahezu brachialen Grundzugs und wegen ihres Ansteckungs- charakters, der hauptsächlich bei größeren Menschenansamm- lungen zur Geltung kommt, von beachtenswerter gesellschaftli- cher Tragweite. Die Wirkung, die von diesen Affektäußerun- gen in einer Masse ausgeht, kann im positiven Fall zu kraftvol- ler Durchsetzung bestimmter Interessen führen, im negativen Fall aber gefährliche Ausmaße annehmen und sich in Kriegen oder blinder Destruktivität entladen. Deshalb muß auch im Bereich der Massenpsychologie die Wut vom Zorn abgegrenzt werden, wobei dem Zorn eine für alle Beteiligten befreiende Wirkung zukommt. Die Frage, ob ein Massenaufstand als zornig-berechtigtes oder als nur ohnmächtig-kurzlebiges, blindes Aufbegehren zu beur- teilen ist, kann nur im Einzelfall entschieden werden. Ernst Bloch geht davon aus, daß auf tausend Kriege nur ein einziger wirklicher Revolutionskrieg kommt, der vor allem an dem »aufrechten Gang< der am Aufstand Beteiligten zu erkennen ist. Der »aufrechte Gang< ist eine Gefühlshaltung, die emotionale Voraussetzungen für die Äußerungen von Zorn herstellt. Eines von mehreren Kriterien für die Entscheidung, ob es sich bei einem Massenaffekt um eine Wut- oder Zornesäußerung handelt, besteht in der Frage, ob die Ziele eines Aufstands human, freiheitlich und aufklärerisch sind und ob ein Aufstand durch die Art und Weise, wie er organisiert wird, diese Ziele verkörpern kann. Ein weiteres Kriterium ist die Dauer der Bemühungen um die überpersönlichen Ziele der Gerechtigkeit,
- 173
- Freiheit und Humanität. Massenzorn muß also einhergehen mit dem Festhalten an zentralen ethischen Werten und einer von möglichst vielen Menschen getragenen Erarbeitung von psy- chologischem und soziologischem Wissen. In einer Masse kann es sehr leicht geschehen, daß Affekte wie Zorn und Empörung ihre Gebundenheit an ethische Werte verlieren und sich zu Affektregungen verselbständigen, die weitgehend frei von gedanklichen Inhalten sind. Oft lassen sich Menschen blindlings von Zornaffekten anstecken, sie sind, ohne die wirklichen Gründe zu kennen, empört, verschaffen sich durch die Beteiligung am Massenaufruhr ein Ventil für angestaute Emotionen und fühlen sich wohl dabei, sich vom Strom der Menge treiben zu lassen. Nach Gustave Le Bon neigt eine Masse dazu, von einem rationalen in einen affektiven und triebgebundenen Zustand abzugleiten. Freud vertritt die An- sicht, daß der einzelne innerhalb der Masse »unter der Vorherr- schaft des Es steht«, und sich damit nahezu ganz dem Lustprin- zip hingibt, während ein einzelner außerhalb der Masse sich eher nach dem Realitätsprinzip ausrichtet. Diese von Freud vorgenommene Differenzierung ist vielleicht auch der Grund dafür, daß Charaktere, die Geschichte gemacht haben, meist einzeln auftreten. Sie empören sich über die allgemein verbreitete Verletzung ethischer Normen und versu- chen, mit Hilfe einer intensiven, aufklärerischen Beeinflussung der Masse deren moralisches Niveau anzuheben. So schleuderte Moses zornentbrannt die beiden Gesetzestafeln zu Boden und machte damit sein Volk, das dem »richtigem Glauben untreu geworden war, nachdrücklich auf dessen Vergehen auf- merksam. Ein Beispiel für eine zornige Haltung gegenüber den Unwerten der Autoritätshörigkeit, der Staatsvergötzung und der rassisti- schen Vorurteile aus unserer Zeit ist der französische Roman- schriftsteller Emile Zola. Moralischer Zorn trieb ihn 1898 dazu, in Zeitungsartikeln und Flugschriften für die Wiederaufnahme des Gerichtsverfahrens gegen den Hauptmann Dreyfus zu kämpfen, der jüdischer Herkunft war und wegen angeblicher Spionage zu lebenslanger Haft in einer Strafkolonie verurteilt wurde. Das Ergebnis von Zolas Bemühungen bestand darin, daß ihm seinerseits der Prozeß gemacht wurde, in dessen Verlauf er die Wut des Pöbels in vollem Ausmaß zu spüren bekam. Es gab
- 74
- eine lautstarke Feindseligkeit der wartenden Menge bei seiner A n k u n f t vor dem Justizpalast... Sobald sein Wagen gesichtet wurde, ging ein Aufschrei durch die Menge: »Nieder mit Zola! Nieder mit den Juden.« 4
- Der von Zola durchgefochtene Kampf um die Verteidigung eines Unschuldigen hebt den Unterschied zwischen dem Zorn eines einzelnen und der eher blinden Wut der Volksmenge besonders deutlich hervor. Der Zorn äußert sich in einem ganz auf sich selbst gestellten Individuum, das ethische Werte im Auge behält, für die es schon vorher gekämpft hatte. Die Masse jedoch läßt sich zu dem undifferenzierten und primitiven Af- fekt der Wut hinreißen, der auf viele deshalb eine so starke Anziehungskraft ausübt, weil er oft ohne jede gedankliche Auseinandersetzung mit dem Gegenstand der Aggression her- vorbricht. Von besonderem psychologischem Interesse sind im Zusam- menhang mit der Wut der Masse die Phänomene des Vorurteils und der Ansteckung, die vor allem auf den psychischen Mecha- nismen der Projektion, der Identifizierung und der Regression beruhen. In Vorurteilen gegen Frauen, Ausländer, Andersgläubige oder Randgruppen ist die Wut für einen psychologisch nicht ge- schulten Menschen auf den ersten Blick kaum zu erkennen. Die Wut- und Haßgefühle, die immer den Kern eines Vorurteils bilden, äußern sich zunächst nur still in ömnipotenzgefühlen und Abwertungsphantasien oder auch einfach in Berührungs- ängsten. Die aggressive Komponente dieser Vorurteile fällt auch deshalb nicht so stark auf, weil sie weit verbreitet sind, häufig sogar von den Medien und der sogenannten öffentlichen Meinung unterstützt werden, so daß sie oft als gesellschaftlich legitimierte Formen der Wutäußerung bezeichnet werden kön- nen. Dennoch haben diese scheinbar stillen Vorurteile verhee- rende Konsequenzen: sie führen dazu, daß Menschen blind und unüberlegt Sadismus und Gewalt gegenüber Schwächeren un- terstützen; denn unmenschliches, Vorurteilen verhaftetes Den- ken zieht immer auch entsprechendes Handeln nach sich. Das Vorurteil bietet für Menschen, die sich ohnmächtig und einsam fühlen, ein Ventil, das ihnen gestattet, ihre Enttäu- schung und Wut durch die Abwertung von gesellschaftlichen Randgruppen auszuleben, wobei verdrängte Aggressionen auf diese Gruppen projiziert werden. So fühlt man sich einerseits
- 75
- von ihnen bedroht, andererseits verachtet man sie. Diese dop- pelte negative Reaktion bleibt den Betroffenen natürlich nicht verborgen, sie antworten ihrerseits mit Wut, und so entsteht eine Wut- und Angstspirale: alle Beteiligten steigern sich in immer stärkere Feindseligkeit hinein. Das Phänomen der Ansteckung von Wut innerhalb einer Masse führt Freud auf die Verlockungen der Regression zurück. Als psychische Grundlage dieses Mechanismus nimmt Freud die Identifizierung der Massenmitglieder untereinander an. Indem sich jeder einzelne mit den anderen Massenmitgliedern identifi- ziert, erfahren die Inhalte seines Über-Ichs eine gewisse Wand- lung. Die strenge Zensur, die den einzelnen davon abhält, sich primitiven Triebregungen zu überlassen, wird innerhalb der Masse gelockert, manchmal sogar ausgeschaltet. Plötzlich glaubt sich jeder berechtigt, Kontrollen und Abwehrmechanis- men fallen zu lassen und das zu tun, was auch die anderen tun; denn die Verantwortung für ungezügeltes Verhalten muß nicht mehr vom Individuum allein getragen werden. Rollo May schildert in seinem Buch >Quellen der Gcioalt< den Fall einer jungen, masochistischen Frau, die in allen Lebensbe- reichen die größte Mühe hat, ihre Interessen zu vertreten, bei der also aus Angst vor Liebesverlust eine starke Hemmung an konstruktiver Selbstbehauptung vorliegt. Diese Frau kann nur, wenn sie an Massendemonstrationen teilnimmt, ihre angestaute Wut ungezügelt ausleben. Sie weiß dabei oft nicht einmal genau, welche Ziele die Demonstranten, denen sie sich an- schließt, vertreten, schlägt jedoch voller Inbrunst und Wut- empfindungen während der Demonstrationen um sich. Diese Frau ist ein Beispiel dafür, wie eine von Wut aufgewühlte Masse dem aggressionsgehemmten einzelnen Menschen Er- leichterung verschafft, indem sie seine Eigenverantwortung und seine inneren Kontrollen nahezu aufhebt. Es wird auch deut- lich, daß es sich in diesem Fall nicht um sachbezogene Empö- rung handelt; denn die junge Frau informiert sich nicht einmal über die Kampfziele der jeweiligen Demonstration. Das Mit- laufen in der Masse bietet hauptsächlich die Möglichkeit für ichbezogene Affektentladungen. In einer von Wut aufgepeitschten Masse vollziehen sich psychi- sche Dynamismen, die nach ganz bestimmten, feststehenden Gesetzen ablaufen und deren Wirkungsweise unmittelbar kaum verändert werden kann. Eine langfristige Beeinflussung wüten-
- 176
- der Massen besteht einzig und allein in der Möglichkeit, die auch Rollo May in seinem eben erwähnten Fallbeispiel ange- deutet hat, nämlich in psychotherapeutischen Gesprächen, in denen die emotionalen Hintergründe für die Bereitschaft der Analysanden zur Wut bewußt gemacht und verschiedene Ent- wicklungsschritte nach und nach aufgezeigt werden, deren Verwirklichung die Wut als überflüssig erscheinen läßt. Diese Möglichkeit wird sicher von vielen als uneffektiv und wirklich- keitsfremd beurteilt. Ihr Vorteil liegt jedoch darin, daß nicht nur in ferner Zukunft auf Grund der wachsenden Zahl denken- der Individuen weniger Massenreaktionen sich ereignen, son- dern daß schon in der Gegenwart einzelne Menschen durch psychotherapeutische Gespräche eine Befreiung von den scheinbar zwingenden Mechanismen der Wut erfahren.
- Wut und Zorn in der Psychotherapie
- Im Zusammenhang mit dem Thema Wut und Zorn in der Therapie sind die folgenden beiden Fragestellungen von beson- derem Interesse: 1. Welche Bedeutung hat die Wut in einer psychotherapeuti- schen Situation? 2. Wie können derartige Affekte mit Hilfe einer Psychothera- pie abgebaut werden? Zu Frage i: Die Wutgefühle, die ein Analysand in einer be- stimmten Phase des Therapieverlaufs verspürt, deuten meist darauf hin, daß der betreffende Analysand sich in einer kriti- schen Therapiesituation befindet, die entweder durch innerpsy- chische Konflikte oder durch Probleme in der Beziehung zum Therapeuten entstanden ist. Die Wut kann, wenn sie ausagiert wird, den therapeutischen Prozeß massiv stören, sie kann zu Stagnation in der persönlichen Entwicklung oder sogar zum Abbruch einer psychotherapeutischen Behandlung führen. Sie kann aber auch, wenn der Therapeut mit ihr umzugehen weiß und ihre Bedeutung versteht, zu einem wichtigen Schlüssel für die Selbsterkenntnis des Analysanden werden. Freud erörtert die in der Theapie aufkommende Wut im Zu- sammenhang mit seinen Ausführungen über den Widerstand. Der Widerstand äußert sich häufig in einer Wut, die entweder diffus empfunden wird oder sich gegen den Therapeuten rich-
- 177
- tet. Freud bezeichnet die auf den Therapeuten gerichtete Wut auch als eine von mehreren möglichen Formen der negativen Übertragung. Sie läßt sich nach Freuds Ansicht aus der Tatsa- che erklären, daß der Analysand in bestimmten Stadien seiner Therapie eine große Scheu entwickelt, wichtiges, verdrängtes Seelenmaterial mitzuteilen und gemeinsam mit dem Therapeu- ten zu reflektieren. In diesem Falle tritt eine Entwicklungshem- mung auf, die darin ihren Ausdruck findet, daß der Analysand die beruflichen Fähigkeiten des Therapeuten in Frage stellt, anstatt sich um die Aufdeckung und Bewältigung seiner eigenen Probleme zu kümmern. Eine zentrale Stellung in den Ausführungen Freuds über den Widerstand nimmt auch der Gedanke ein, daß die im Verlauf der Therapie entstehenden Wutgefühle des Analysanden der Realität oft nur wenig entsprechen, sondern eine >Neuauflage< von den in der Kindheit erlebten Wutgefühlen darstellen, die der Analysand seinen Eltern gegenüber empfunden hatte und verdrängen mußte. Erst wenn es dem Therapeuten gelungen ist, dem Analysanden die Wut als eine Form des Widerstands begreiflich zu machen, verliert sie an Heftigkeit und schwindet allmählich ganz. Dann wird es möglich sein, daß der Analysand seine eigene Entwick- lung neu betrachtet, indem er sich sein verdrängtes Seelenma- terial bewußt macht, auf den Kampf mit dem Therapeuten verzichtet und die dadurch frei gewordene Energie auf das Wesentliche, nämlich auf die eigene Persönlichkeitsentfaltung hinlenkt. Der Therapeut soll sich nach Freud so weit wie möglich aus den in der Therapie aufbrechenden Emotionen heraushalten, d.h., er darf die Wut des Analysanden nicht auf sich beziehen. Dieser wird nur dann, wenn die gewünschte oder gewohnte Reaktion auf die eigenen Wutäußerungen nicht erfolgt, auf sich selbst zurückverwiesen, um so zu erkennen, warum er wütend ge- worden ist. Wenn man wie Horney und andere Neopsychoanalytiker die Beziehung zwischen Therapeut und Patient als lebendiges zwi- schenmenschliches Geschehen betrachtet, gewinnt der Begriff der Übertragung eine andere Bedeutung als bei Freud. Ein Narzißt wird, seinem vertrauten Beziehungsmuster entspre- chend, um jeden Preis dem Therapeuten gefallen und von ihm bewundert werden wollen. Er reagiert mit Wut, wenn er sich
- 178
- der Anerkennung nicht mehr sicher ist oder wenn er spürt, daß Leistungen von ihm verlangt werden, welche die Größenvor- stellungen von seinem Ich in Frage stellen. Ein arrogant-rach- süchtiger Typ wird das unbewußte Ziel verfolgen, seinen The- rapeuten zu übertrumpfen, nicht aber seinen Charakter zu verändern. Möglicherweise wird seine Wut zum Ausbruch kommen, wenn er spürt, daß der Therapeut nicht bereit ist, sich mit ihm auf einen Machtkampf einzulassen. Bekanntlich setzt ein Analysand alles daran, den Therapeuten von der Richtigkeit seines eigenen Weltbildes zu überzeugen. Ein Wütender wird seine Erlebniswelt dem Therapeuten so schildern, daß Kampf und Wut als notwendige Verteidigungs- maßnahmen betrachtet werden müssen. Die Darstellung von demütigenden Situationen, von Gefahren und von ungerechter Behandlung wird großen Raum in seinen Ausführungen ein- nehmen. An Mimik und Gestik, wie z.B. einem finsteren und verschlossenen Gesicht, einer verkrampften Haltung oder an sichtbaren nervösen Spannungen kann man erkennen, wie er sich fühlt. Mit jeder Faser seines Körpers möchte er dem Therapeuten zu verstehen geben: ich kann mich nicht entspan- nen, die Welt ist doch nur gegen mich! Wenn es dem Therapeuten gelingt, die scheinbar stichhaltigen Argumente des Analysanden zu durchschauen, zu erkennen, daß er die eigene Weltsicht als objektiven Sachverhalt darzustel- len versucht, hat er nach Ansicht von Horney eine zentrale therapeutische Aufgabe gelöst. Horney geht sehr viel differen- zierter als Freud auf das Phänomen der Gegenübertragung ein. Sie beschäftigt sich mit der Frage, welche Gefühle die Wut des Analysanden im Therapeuten auslöst. Es kann leicht ge- schehen, daß der Therapeut sich eingeschüchtert fühlt. Oder er entwickelt dem Analysanden gegenüber Gefühle der Ableh- nung, was eine produktive analytische Arbeit unmöglich macht. Horney empfiehlt deshalb dem Therapeuten:
- Hingegen wird er das notwendige, mitfühlende und respektvolle Verständnis aufbringen, wenn er erkennt, daß auch dieser Patient, trotz seiner gegenteiligen Behauptungen, ein leidender und ringender Mensch ist. 5
- Diese Empfehlung kann ein Therapeut nur dann befolgen, wenn er sich selbst und seine Gefühlsreaktionen gut kennt und sich aus innerer Stabilität und Selbständigkeit von den Affekt-
- 9
- äußerungen des Analysanden zu distanzieren vermag. Ist ein Therapeut durch eigene Charakter- und Lehranalyse in der Wahrnehmung eines umfangreichen Gefühlsspektrums ge- schult, beherrscht er auch die Fähigkeit, den psychischen Hin- tergrund eines Affekts an den in ihm selbst aufkommenden Gefühlen sehr differenziert abzulesen. Durch Deutung und Verbalisierung seiner Gefühle wird er dem Patienten zu Selbst- erkenntnis verhelfen können. Wut wird in dem Maße im Ana- lysanden zurückgehen, wie der Therapeut sich als Gegenüber in die verengte Weltsicht des Analysanden einzuschalten ver- mag. Dies wird nur auf der Grundlage von gegenseitiger Sym- pathie gelingen können. Ein unbewußtes Ziel der Wut des Analysanden besteht auch darin, Distanz in der Beziehung zum Therapeuten herzustellen und aufrechtzuerhalten, da er eine fast panische Angst vor Nähe und Hingabe hat. Mit seiner Wut stößt der Analysand den Therapeuten von sich weg und macht sich dadurch selbst wenig liebenswert, um zu verhindern, daß im Gegenüber Sym- pathie entsteht. Auf diese Weise bestätigt er sich die eigene Feindseligkeitserwartung und das Mißtrauertf Auch die Distanz erzeugende Wirkung der unterdrückten Wut kann ohne weiteres erkannt werden. Häufig versuchen Analy- sanden, ihren Groll zu verbergen, entwickeln eine große Di- stanz und zweifeln insgeheim an der Kompetenz des Therapeu- ten. Die Angst, seine Wut auch zu äußern, wird oft mit dem Argument begründet, der Analysand könne die Liebe des Therapeuten verlieren. Diese Furcht erweist sich jedoch oft nur als Vorwand. Dahinter verbirgt sich die Angst, wirklich eine Beziehung mit dem Therapeuten einzugehen und damit auch, sich verändern zu müssen. Die unterdrückte Wut bietet Anlaß für die abenteuerlichsten Projektionen, die sich ebenfalls dazu eignen, die Distanz zum Therapeuten zu festigen. Der Analy- sand empfindet hierbei weniger die eigene Wut, vielmehr glaubt er, der Therapeut sei wütend auf ihn oder könne ihn nicht besonders gut leiden. In diesem Fall ist ein offenes Gespräch über die lange angestauten Wutgefühle für den fruchtbaren Fortgang der Therapie von entscheidender Bedeutung. Die von Kohut speziell für narzißtische Persönlichkeiten ent- wickelte Form der Analyse legt den Schwerpunkt auf das Aussprechen und >Durcharbeiten< der narzißtischen Wut, die innerhalb der Übertragungsprozesse auftritt. Demnach soll im
- 180
- Anschluß an jede Wutempfindung des Analysanden genau nachgeforscht werden, was diese Wut jeweils ausgelöst hat. Meist hängen die Auslösesituationen für Wut mit Verletzungen des eigenen, überhöhten Selbst oder mit der Enttäuschung darüber zusammen, daß sich der Therapeut als nicht so voll- kommen erweist, wie ihn der Analysand gerne sehen möchte, um sich mit ihm identifizieren zu können. Oder sie hängen damit zusammen, daß der Analysand den Therapeuten als eine eigenständige Person erlebt, die er nicht kontrollieren kann. Das »Durcharbeiten* dieser Auslösesituationen soll dem Analy- sanden dazu verhelfen, ein realistisches Bild von sich selbst und seiner Beziehung zur Umwelt zu entwickeln, die Größenphan- tasien abzubauen, Riesenansprüche und Erwartungshaltungen zu verringern, um sie in das Selbst zu integrieren und dieses damit zu stabilisieren. So fruchtbar das »Durcharbeiten* von Wutgefühlen für den eigenen Entwicklungsgang sein kann, so schädlich ist das Aus- agieren der Wut, das in einigen neueren Therapieverfahren eifrig befürwortet wird. Dieses Ausagieren gibt dem Analysan- den nicht die Möglichkeit zu tiefgreifender Selbsterkenntnis, sondern verschafft ihm eine nur kurzfristige Spannungsabfuhr oder sogar einen gewissen Machtrausch. Zu Frage z: Da die Wut ein fester Bestandteil der gesamten Charakterstruktur eines Menschen ist, kann die übermäßige Affektbereitschaft nur dann abgebaut werden, wenn eine Per- son sich insgesamt verändert, d.h. sich entwickelt und zu höherer Reife heranwächst. Nur wenn der Anspruch auf Über- legenheit, die Riesenerwartungen, das Mittelpunktstreben, die Empfindlichkeit, die Feindseligkeitserwartung, die Hingabe- angst und andere mit der Wut verflochtene Charaktereigen- schaften nach und nach schwächer werden, nimmt auch die Wutbereitschaft ab, was nur dann geschieht, wenn das Selbst- wertgefühl des Wütenden zu wachsen beginnt. Denn all den genannten, trennenden Charaktereigenschaften liegt ein man- gelhaft ausgebildetes Selbst zugrunde. Die Icherweiterung vollzieht sich zunächst in der Beziehung zum Therapeuten, in welcher es dem Analysanden auf die Dauer möglich sein sollte, Nähe und gegenseitiges Verstehen zuzulassen, ohne Gefahren für das eigene Ich zu befürchten. Auch Identifikationsprozesse spielen eine ganz entscheidende Rolle. William James weist darauf hin, daß jeder Mensch so viel
- 181
- an Ichstärke besitzt, wie er andere >Ichs< durch Identifikation in sich aufgenommen hat. Eine beträchtliche Vermehrung von Identifikationsmöglichkeiten wird vor allem in Gruppenthera- pien angeboten. Von großer Wichtigkeit ist auch die Erkenntnis, welche Bedeu- tung den Affekten im Rahmen des eigenen Charakters zu- kommt. Wenn diese Erkenntnis praktische Folgen nach sich ziehen soll, darf sie nicht nur auf rationalen, sondern sie muß auch auf emotionalen Verständnisprozessen beruhen, die auf dem in der Beziehung zwischen dem Therapeuten und dem Analysanden allmählich entstehenden Gefühlshintergrund der Liebe und Sympathie in Gang gesetzt werden. Ein weiterer Schritt zum Aufbau eines stabilen Ichs besteht darin, die Diskrepanz zwischen realem und idealem Ich abzu- bauen, eine Diskrepanz, die wir schon als charakteristisches Merkmal des Wütenden beschrieben haben. Wenn das erdrük- kende Ideal-Ich reduziert wird und sich immer mehr der Reali- tät anpaßt, muß sich das reale Ich nicht mehr minderwertig fühlen, sondern der Analysand lernt, sein Ich zu akzeptieren, wie es ist. Er wird dann wagen, Hindernissen ins Auge zu blicken und das Handeln in der Realität einzuüben. Auf Wut- ausbrüche als Handlungsersatz kann er dann verzichten. Der Abbau von Wut kann also nur erreicht werden, wenn ein positives Ziel angestrebt wird, nämlich die Stabilisierung und Ausbildung eines eigenständigen Ichs. Die allmähliche Ver- wirklichung dieses Ziels geht einher mit dem Gefühl der Zu- friedenheit über die kleinen, aber kontinuierlichen Entwick- lungsschritte. Eine zufriedene Stimmung steht in direktem Gegensatz zur Wut, da der zufriedene Mensch in den meisten Lebenssituationen mit sich selbst im Einklang lebt, während ein Wütender nicht nur andere, sondern auch sich selbst gleichsam in Stücke zerreißen möchte. Es gibt jedoch Situationen, in denen einer reifenden und sich entwickelnden Persönlichkeit Verhaltensweisen abverlangt werden, die ihr kaum eine Chance lassen, ihre innere Ausgeglichenheit zu bewahren. Gerade ein ichstarker und realitätsbezogener Mensch, der sich auch durch die Fähigkeit auszeichnet, ethische Werte von Pseudowerten genau zu unterscheiden, wird angesichts von Situationen, in denen die Entwürdigung und ungerechte Behandlung einzelner widerspruchslos geduldet wird, seine innere Ausgeglichenheit aufgeben und statt dessen den Gefühlen des Zorns freien Lauf
- 182
- lassen, um darauf hinzuweisen, daß keine Solidarität zwischen ihm und denjenigen besteht, denen moralische Grundsätze gleichgültig sind. Eine Psychotherapie, die über die Behandlung auffälliger Sym- ptome hinausgeht und sich durchaus für ethische Werte enga- giert, wird sich nicht darauf beschränken, die Wut eines Analy- sanden abzubauen. Sie wird ihn dagegen dazu ermutigen, auf der Grundlage einer differenzierten Beurteilung ethischer Wer- te die Bereitschaft und die Fähigkeit zu Zornesäußerungen in sich zu entwickeln. Zornesäußerungen deuten darauf hin, daß das Ich des Analysanden einen beträchtlichen Zuwachs an persönlicher Macht erfahren hat. Auf seinen Zorn reagieren die anderen oft zunächst erschrocken, dann nachdenklich. Wutge- fiihle verlieren ihre drohende Wirkung dagegen sehr schnell und vermögen immer weniger Menschen einzuschüchtern. Im Gegensatz zum wütenden Menschen, der seine Affekte nicht auf eine konkrete Situation abstimmt, sondern sie wahllos und in einer eintönigen Regelmäßigkeit äußert, vermag der zornige Charakter nüchtern und realitätsgerecht die Besonder- heiten der Situationen, in denen er gerade lebt, einzuschätzen und nur die Emotionen zum Ausdruck zu bringen, von denen er auf Grund seines Takts und Feingefühls weiß, daß sie in der jeweiligen Situation sinnvoll und notwendig sind. Die in einer Therapie sich vollziehende Ausbildung der Fähigkeit zu zorni- gen Gefühlen stimmt also völlig mit dem Grundanliegen einer richtig verstandenen Psychotherapie überein, nämlich mit dem Bemühen, dem Analysanden einen möglichst großen Gefühls- reichtum und eine umfassende Lebenskenntnis zu vermitteln, die ihn dazu befähigen, das richtige Wort im richtigen Augen- blick auszusprechen, und ihm den Mut geben, im Kampf gegen Dummheit, Vorurteile und die verschiedensten Formen gesell- schaftlicher Unterdrückung zeitweiliges Alleinsein zu er- tragen.
- 183
- Josef Rattner
- Haß
- Wenn man Liebe als >Gefühl< bezeichnet, wird man den Haß kaum in dieselbe Kategorie seelischer Erscheinungen einordnen können. Hier passen wohl besser die Bezeichnungen >Affekt< und >Leidenschaft<. In einem >Wörterbuch der Psychologie< heißt es dazu:
- Affekt, Wallung, heftige Gemütsbewegung; ein Erregungszustand, der zu gesteigertem Antrieb führen, aber Einsicht und Kritik ausschalten und die H e r r s c h a f t des Menschen über sich selbst beeinträchtigen kann. Inhalt und G r a d e der Affekterlebnisse sind überaus mannigfal- t i g . . . V o n den Leidenschaften unterscheiden sich die A f f e k t e durch die geringere D a u e r ; Leidenschaften schließen eine gewisse A f f e k t b e - reitschaft ein. 1
- Da es viele Affekte und Leidenschaften gibt, muß man noch weiter spezifizieren: Haß ist ein exquisites Aggressionsphäno- men und soll daher im Rahmen einer >Theorie der Aggression abgehandelt werden. Haß ergibt sich in erster Linie im zwi- schenmenschlichen Bereich; der Mitmensch ist das bevorzugte Objekt unserer Haßgefühle, indes wir Tiere, Pflanzen, Land- schaften, Kunstgegenstände vielleicht nicht gerade mögen, aber kaum je hassen werden. In der Populärpsychologie werden oft Liebe und Haß neben- einander gestellt, und es wird sogar behauptet, daß Liebe besonders leicht in Haß >umschlagen< kann. Diese These ist sehr fragwürdig. Wenn ein Liebender sich in einen Hassenden verwandelt, werden wahrscheinlich enttäuschte Begierde, fru- strierte Herrschsucht und ähnliche Regungen eine viel größere Rolle spielen als echte Zuneigung. Richtig ist allerdings, daß Liebe extreme Bejahung des Gelieb- ten und Haß extreme Verneinung des Gehaßten beinhaltet: insofern kann man davon ausgehen, es mit polaren Seelenvor- gängen zu tun zu haben. Im Haß fühlt man sich zutiefst gestört
- 184
- und irritiert durch das Verhalten und die Existenz des Objekts; in der Liebe ist man beseligt, daß es das Du überhaupt gibt, und man akzeptiert dieses Gegenüber mit seinen Tugenden und Schwächen. Auch wünscht man dem Geliebten ein langes, reiches und erfülltes Leben. Der Hassende dagegen tendiert dazu, dem anderen ein erfülltes Leben zu mißgönnen, ihm sogar Untergang und Unglück zu wünschen. Jeder nachdenkliche Beobachter wird zugeben, daß es unend- lich viel Haß in der Welt gibt und daß die Menschheit vielleicht eines Tages an ihrem extrem ausgelebten Haß zugrunde gehen kann. Nicht nur im Zusammenleben der Völker, Rassen, Reli- gionen und Klassen nehmen Haßgefühle einen gewaltigen Raum ein, sondern auch im Mikrokosmos der Familie, in der Beziehung von Mann und Frau, Eltern und Kindern und der Geschwister untereinander. In der psychotherapeutischen Be- ratungspraxis wird oft der rosenfarbige Vorhang beiseite ge- schoben, der die familiären Disharmonien vor der Außenwelt verbirgt: dann zeigt sich das Heim der »gutbürgerliche Fami- lien* als Kriegsschauplatz, auf dem jeder gegen jeden kämpft, oder wo Koalitionen bestehen, zwischen denen grimmige Aus- einandersetzungen stattfinden. Der »Kampf aller gegen alle*, den Darwin in der Natur zu beobachten glaubte, ist zumindest in der Familienpathologie eine unbestreitbare Tatsache.
- Freuds Lehre vom Haß
- Die Psychoanalyse befaßte sich seit ihren Anfängen mit der Haßproblematik; dennoch ist sie kaum bis zu den letzten Hintergründen dieses Phänomens vorgedrungen. Der frühe Freud ordnete die Entstehung von Haßregungen beim Kind der oralen und der analen Phase der Libidoentwicklung zu: er sprach von oral-kannibalistischen Regungen und jenen Haß- und Wutgefühlen, die mit der Zurückhaltung des Kots bei der Reinlichkeitserziehung im Zusammenhang stehen. Um 1914 formulierte er seine »Narzißmustheorie*. Sie beschreibt die Ausgangssituation der kindlichen Entwicklung als »narzißtische Selbstverliebtheit*. Man müsse sich den Säugling als ein in sich verkapseltes Wesen denken, welches nur sehr zögernd und vorsichtig mit der Umgebung Kontakt aufnimmt. Dabei erfährt sein grenzenloses Luststreben überall Frustrationen, auf die er
- 185
- mit Erbitterung und Empörung reagiert. Innerhalb der oralen und der analen Stufe der Libidoorganisation ist der Haß - nach Freud - viel stärker ausgeprägt als die Liebe, die erst nach und nach unter dem Einfluß einer entsprechenden Betreuung em- porkeimt. Später wurde das Ich zur >Stätte des Hasses<, und ein Zitat aus dem Jahre 1 9 1 5 beleuchtet schlaglichtartig Freuds düsteres Menschenbild, das den Menschen als >Raubtier< definiert. So schreibt er: Das Ich haßt, verabscheut, verfolgt mit Zerstörungsabsichten alle Objekte, die ihm zur Quelle von Unlustempfindungen werden, gleichgültig, ob sie ihm eine Versagung sexueller Befriedigung oder der Befriedigung von Erhaltungsbedürfnissen bedeuten. J a , man kann behaupten, daß die richtigen Vorbilder für die Haßrelation flicht aus dem Sexualleben, sondern aus dem Ringen des Ichs um seine Erhaltung und Behauptung stammen.1 Die anfängliche Auffassung, der Haß sei die urtümliche Welt- beziehung des Menschen, die nachträglich von der Liebe gemil- dert werde, behielt Freud zeit seines Lebens bei. Er verschärfte sie noch, als er in Jenseits des Lustprinzips< (1920) den berühmt- berüchtigten >Todestrieb< postulierte, die These nämlich, der- zufolge es angeborene destruktive Mächte im Menschen gibt, die auf seine eigene Vernichtung hinarbeiten. Ein großer Teil dieser Zerstörungsenergie werde als Sadismus nach außen abge- leitet, wo er den Mitmenschen erheblich zu schaffen macht; der Rest der >Destrudo< jedoch (wie es bald im Jargon der Psycho- analytiker hieß) fließe zurück nach innen und erzeuge dort sekundären Masochismus<, ein unerbittliches Über-Ich oder Gewissen, eventuell sogar Krankheitserscheinungen und To- dessehnsucht. Damit hatte Freud die Aggression als einen festen Bestandteil der >menschlichen Natur< etabliert. Die von Rousseau und den Sozialisten vertretene Meinung, das Wesen des Menschen sei prinzipiell gut (und nur durch die gesellschaftlichen Verhältnis- se zur Böswilligkeit entartet), wies er spöttisch als oberflächlich zurück. Überall in der Geschichte sah er das Walten einer unkontrollierten und kaum kontrollierbaren Aggressivität, die sich gegen alle richtete, die der Mensch als >im Wege stehend< empfinde. H o m o homini lupus (Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf) - das sei das wahre Geschichtsgesetz. Man müsse blind sein, um nicht das Meer von Haß und Grausamkeit zu
- 186
- sehen, das die ungesicherten Küsten der Zivilisation und H u - manität umspült. Für Freud ist demnach nicht der Haß ein erstaunlicher Charak- terzug, sondern die Liebe und die Tatsache, daß die Menschen auch solidarisch und freundlich miteinander umgehen können. Dies führt er auf den >Eros< zurück, eine zweite »kosmische Instanz«, die dem >Thanatos< (Todestrieb) entgegenarbeitet. FIaß und Liebe treffen in der menschlichen Seele aufeinander, wo es zu einem heftigen Ringen um die Vorherrschaft kommt. Die Wirkung der erotischen Kräfte beschreibt Freud in >Warum Krieg< (1932) mit folgenden Worten:
- Alles, was Gefühlsbindungen unter den Menschen herstellt, muß dem Krieg entgegenwirken. Diese Bindungen können von zweierlei Art sein. Erstens Beziehungen wie zu einem Liebesobjekt, wenn auch ohne sexuelle Ziele. Die Psychoanalyse braucht sich nicht zu schämen, wenn sie hier von Liebe spricht, denn die Religion sagt dasselbe: Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst. Das ist nun leicht gefordert, aber schwer zu erfüllen. Die andere A r t von Gefühlsbindung ist die durch Identifizierung. Alles, was bedeutsame Gemeinsamkeiten unter den Menschen herstellt, ruft solche Gemeingefühle, Identifizierungen, hervor. A u f ihnen ruht zum guten Teil der A u f b a u der menschlichen Gesellschaft. 3
- Viele Kritiker Freuds haben hervorgehoben, daß diese Lehre von der »Raubtiernatur des Menschern eine Apologie autoritä- rer politischer Systeme und Weltanschauungen impliziere; in der Tat nähern sich Freuds Gedankengänge in bedenklicher Weise den Konzepten von Hobbes, Machiavelli, Schopenhau- er, Nietzsche und Oswald Spengler (von unbedeutenderen Ideologen des Konservatismus nicht zu reden). In jüngerer Vergangenheit hat Konrad Lorenz als Verhaltensforscher mit Bezugnahme auf Freud ähnliche Thesen formuliert (>Das soge- nannte Böse - Zur Naturgeschichte der Aggression, Wien 1963), worin er weitschweifig ein Amalgam von autoritären Relikten, biologischen Erkenntnissen und politischen Banalitäten vor- trug. Die leichtfertigen Parallelen, die Lorenz zwischen Tier und Mensch zieht, sind selbst im Kreise seiner Schüler und Mitar- beiter nicht unangefochten geblieben. Man hat an seinen farbi- gen Schilderungen der Aggressionen im Tierreich bemängelt, daß er die Phänomene der Solidarität und gegenseitigen Hilfe der Artgenossen untereinander (was erst die Evolution im
- 187
- Tierreich möglich machte) eindeutig unterbewertet. Auch wird des öfteren die Frage aufgeworfen, ob die menschlichen Phäno- mene von >Liebe< und >Haß< mit irgendwelchen Vorgängen in der Tierpsyche identifiziert werden können. Irenäus Eibl-Ei- besfeldt rät in >Liebe und Haß - Zur Naturgeschichte elementa- rer Verhaltensweisen zur größtmöglichen Zurückhaltung und sagt: Ich verwende in diesem Buch des öfteren den Begriff Liebe. Es ist dabei nicht allein die geschlechtliche Liebe gemeint, sondern allgemei- ner die gefühlsmäßige, persönliche Bindung eines Menschen an einen anderen oder die daraus erwachsende Bindung über Identifikation mit einer bestimmten G r u p p e . Das Gegenstück zur Liebe ist der Haß als individualisierte emotionelle Ablehnung und der daraus erwachsende Gruppenhaß. Wir können in diesem Sinne genaugenommen nur beim Menschen von Liebe und H a ß sprechen. Bei Tieren können wir nur rein beschreibend individualisiertes Kontaktstreben und Bindung be- ziehungsweise Aggression feststellen. Aussagen über die solches Ver- halten begleitenden Gemütsbewegungen sind aus erkenntnistheoreti- schen G r ü n d e n grundsätzlich nicht möglich."'
- Wenn wir in der Folge die >Psychologie des Hasses< untersu- chen, vermeiden wir die kurzschlußartige Verankerung der Haßgefühle in der angeblich >bösen Menschennatur< und lassen auch die niedlichen Beispiele aus der Tierwelt beiseite, deren Erklärungswert uns als null und nichtig erscheint.
- Phänomenologie der Haßkrankheit
- Im durchschnittlichen Alltagsleben bewahren die Menschen eine relativ große Distanz zueinander, und die Gefühle, die sie hierbei entwickeln, sind matt und undifferenziert. Damit hefti- ge Gefühlsregungen wie Liebe oder Haß entstehen können, ist Nähe in irgendeinem Sinne des Wortes unabdingbar; wir ken- nen den Haß in Familienbeziehungen, in Partnerschaften, in Berufsverhältnissen, in Nachbarschaften (wobei auch verschie- dene Konfessionen, Rassen und Nationen als >nachbarlich< aufgefaßt werden müssen), in der Politik und im Kultur- leben. Der Hassende und sein >Objekt< sind dadurch miteinander verknüpft, daß beide um dasselbe Gut rivalisieren oder daß der eine an den anderen leidenschaftlich Ansprüche stellt, die er
- 188
- nicht erfüllen will oder kann. So kann es etwa in menschlichen Beziehungen um Anerkennung, sexuelle Befriedigung, mate- rielle Güter und dergleichen gehen. Wer das Anrecht zu haben glaubt, dies oder jenes mit Affektaufwand fordern zu dürfen, wird tiefe Frustration empfinden, wenn es ihm verweigert wird. Jeder Hassende kann >Gründe< angeben, warum er haßt: in seinem Denksystem ist dann logisch alles folgerichtig, aber die Argumentation folgt oft einer sehr merkwürdigen Willkür. Genau studiert wurde schon häufiger die Entstehung von Haß in Ehen oder Liebesverhältnissen. Zunächst sind die beiden Beteiligten in >Liebe< miteinander verbunden. Sie gehen ihre Beziehung ein mit dem Wunsch, von ihrem Du Achtung, sexuelle Zuneigung, Fürsorglichkeit und Bewunderung zu empfangen. Es ergibt sich aber früher oder später ein »Teufels- kreis<, in den die beiden Partner fast blindlings eingespannt sind: Lieb- und Verständnislosigkeiten fangen irgendwo an, werden mit ebensolcher Münze heimgezahlt, so daß sich eine emotionale Kluft auftut. Es ist nicht jedermanns Sache, diese resignativ zu akzeptieren und sich aus einem solchen Verhältnis - wenn es sehr unbefriedigend geworden ist - zurückzuziehen. Der Hassende läßt sein Objekt nicht los und baut tiefgreifende Ambivalenzen auf, in denen er sein Gegenüber einerseits be- kämpft, andererseits aber auch als Partner haben will. Mächtige Affekte werden mobilisiert, um in diesem Zweikampf nicht zu unterliegen. So lernen wir im Haß einen Affekt zu sehen, der einen wirklichen oder vermeintlichen Widerstand nicht auflö- sen, sondern brechen will - der Haß intendiert die Durchset- zung des eigenen Willens, und möge dabei auch das gehaßte Du zugrunde gehen. Daher kann man von »blindem Haß< sprechen; wo dieser auftritt, ist er mit den Affekten der Wut, des Zorns, der Anklage und der Schuldzuschreibung verschwistert. Wir hassen Menschen, die uns - angeblich - Unrecht angetan haben. Um dieses Gefühl kultivieren zu können, muß stets ein »Feindbild« strukturiert werden; der andere läßt uns nicht so sein, leben oder handeln, wie wir es unbedingt für nötig halten. Daraus entspringt die »Hinderniserfahrung«, um die es im Haß immer geht: man fühlt sich vor einer Wand oder in einer »ummauerten Welt«, gegen die man in verzweifelter Auflehnung anstürmt. Hätte dieser Kampf gute Aussichten auf Erfolg, würde man ihn
- 189
- mit Vernunft und Besinnung angehen können. Der Hassende aber fühlt sich ohnmächtig gegenüber seinem >Feind<, weshalb er auf die destruktive Leidenschaft zurückgreift, um sich gegen die >unsägliche Gefahr< verteidigen zu können. Hierbei spielt ihm seine pessimistische und misanthropische Lebenseinstel- lung schlimme Streiche. Mit Hilfe der Phantasie universalisiert der hassende Mensch seine >Widersacherempfindungen<, bis er sich im Mittelpunkt von Intrigen, Unterschätzungen und An- griffen gegen seine Person glaubt. Die Nähe zur Paranoia tut sich an dieser Stelle auf: der Hassende und sein Objekt sind durch Regungen des >Verfolgungswahns< miteinander verbun- den, wobei es - wie bei der genannten Psychose - nicht selten zum Phänomen des »verfolgten Verfolgers< kommt. Das bedeu- tet: der Paranoiker benimmt sich schlecht und verkehrt gegen jenen, den er als seinen Gegenspieler sieht; wenn dieser rea- giert, hat er rasch Argumente beisammen, die seine Kampfstim- mung zu rechtfertigen scheinen und ihm Antrieb zu neuen Aggressionen bieten. Die »Struktur Haß< ist zusammengesetzt aus Nichtigkeitsge- fühl, wütender Revolte dagegen, Aufbruch zur Destruktion, Neid, Eifersucht, Groll und Selbsterhöhungsstreben. Die Linie des Haßaffekts führt >von unten nach oben<; der Hassende meint, wenn er seinen Widersacher besiegt oder eliminiert habe, werde er groß, unanfechtbar und strahlend dastehen. So kann man aggressiv-haßerfüllte Regungen als Pervertierung des menschlichen Vollkommenheitsstrebens begreifen. Die Grundstimmung des Hassenden ist finster, traurig und trostlos. Man sucht vergebens nach Heiterkeit, Humor und Freude am Lachen beim haßkranken Menschen. Bestenfalls labt er sich an Schadenfreude, bissigen Kommentaren und Hohnge- lächter, das aber stets gequält klingt. Um hassen zu können, muß man gefühlsmäßig verschlossen und schwer ansprechbar sein; der gefühlsbetonte Charakter wird doch da und dort zum Lieben verleitet, was das Negieren und Verkleinern der Ob- jektwelt mildert. Der Hassende ist immer darauf aus, die Fehler und Schwächen seines >Objekts< zu suchen. Er richtet sich an diesen wirklichen oder eingebildeten Mängeln gleichsam auf, da ihm seine subjektive Optik vorspiegelt, er selbst sei von den Untugenden des Gehaßten frei. Dieses >Sich-Aufgeilen< am Manko des anderen ist mit dem Ärger verwandt. Der Hassende ärgert sich über den Gehaßten,
- 190
- wann immer er an ihn denkt. Dies löst fast zwangsläufig einen kleinen oder großen Wutanfall aus. Nun sind Zorn und Wut ein Tonikum, ein Steigerungsmittel für dumpfe und düster gestimmte Seelen. Der Hassende hat irgendwann gelernt, daß er sich von Trauer und Kleinmut befreien kann, wenn er an sein Objekt erinnert wird. Er sucht daher diese Erinnerung, weil sie auf ihn wirkt wie Alkohol oder eine psychotrope Droge. Hierbei wirkt auch der Mechanismus der »Projektion«. Projek- tion heißt: eigene Unzulänglichkeiten auf andere verlagern und eventuell gar an ihnen bekämpfen. Es besteht kein Zweifel, daß dies Entlastung von Schuld- und Minderwertigkeitsgefühlen mit sich bringt und so eine kümmerliche Art von Befriedigung herstellt. Die Eigenschaften und die Wesensart des Haßobjekts reichen wohl kaum je hin, um den Haß als sinnvolle Regung zu motivieren. Man muß schon zusätzliche Motivationen (zum Beobachteten und Wahrgenommenen) bereitstellen, um vor sich selbst den Haß zu »begründen«. Für manche oder viele Menschen sind Haßgefühle eine »gesuchte Lebensform«; sie sind gleichsam dispositionelle Hassende, die nicht viel »Stoff und Anlaß« benötigen, um sich ihrer Leidenschaft hinzugeben. Natürlich kommt hierbei der Sozialisation der Betreffenden und ihren späteren Schicksalen eine erhebliche Bedeutung zu. Man wird in die Welt des Hasses ebenso »eingeführt« wie in die Welt der Liebe. Nur unterscheiden sich beide Welten gewaltig: erstere ist eng, verschlossen, atembeklemmend und finster, letztere jedoch weit, offen, hell und heiter, ein Feld unendlicher oder doch weitläufiger Freiheiten. Aus dieser Verbannung in eine dunkle Umgebung explodiert gleichsam der Hassende diskontinuierlich in Richtung auf sein Objekt. Liebe wurde von den Phänomenologen als stetige Hingabe der eigenen Existenz an das geliebte Du beschrieben. Der Hassende verhält sich genau umgekehrt. Haß äußert sich abrupt, gewaltsam und »unmenschlich«. Er leugnet von vorn- herein eine gewisse Gemeinsamkeit aller Menschen, d.h. ihr Teilhaben an Tugenden und Lastern, Fehlern und Vorzügen. Dieser »Demokratismus« stört den Hassenden, da er seinen Affekt eher lähmt als fördert. Der hassende Mensch ist »Mani- chäerc die Welt muß in Gott und Teufel aufgeteilt sein, und er selbst gehört zu den Heiligen, deren Aufgabe es ist, die »Ketzer« mit allen Mitteln zu bekämpfen.
- 191
- So enthält das Haßgefühl ein religiöses Moment, und es ist kein Wunder, daß die Geschichte der Religionen (auch der politi- schen Religionen!) eine Geschichte des Hasses und der Ketzer- verfolgung ist. Man hat gesagt: Fanatismus sei das Mittel der Dummen, ihre Ansichten zu vertreten. Wenn dumme Men- schen an etwas glauben, sind sie in der Regel von der Einzigar- tigkeit ihrer >Erkenntnis< überzeugt: alle, die anders denken, müssen Narren oder Bösewichter sein. Wie leicht schleicht sich da Haß gegen jene ein, die die eigene Sicherheit bedrohen, weil sie anders glauben, sich verhalten und fühlen! Das prekäre Selbstwertgefühl der Fanatiker wäre erst dann stabilisiert, wenn niemand in der Welt ihre unumstößlichen Uberzeugungen anzweifelt. Daher die Versuchung, mit Kreuzzügen und Inqui- sition gegen das >böse Prinzip< zu Felde zu ziehen. Wir können den Haß einen >sthenischen< (kraftvollen) Affekt nennen, im Gegensatz zur Trauer, die eher »asthenische (kraft- los) ist. So gesehen ist die Depression oder Melancholie häufig eine unterdrückte oder versteckte Haßregung, die nicht zu äußern gewagt wird und darum als traurige Verstimmung zum Vorschein kommt. Damit stimmt überein, daß Beobachter mit guter Menschenkenntnis aus den Klagen des Depressiven so etwas wie »Anklägern heraushören. So empfindet man auch den Melancholiker, unter dessen Selbstbezichtigungen und Schuld- gefühlen seine Umwelt schwer zu leiden hat. Die Tiefenpsy- chologie vermutet sogar im Suizid einen Versuch, die Umwelt und vor allem wichtige Beziehungspersonen zu treffen; im Selbstmord kann ein Racheakt enthalten sein. Wir sollten vielleicht noch den Blick auf den Ehrgeiz und die Eitelkeit des Hassenden lenken. Nur wer immer ganz oben sein will und sich selbst für enorm wichtig hält, wird auf Frustratio- nen im zwischenmenschlichen Bereich mit so ungezügelter Empörung reagieren wie der Hassende. Weniger ehrgeizige und eitle »Naturem schicken sich eher in die Benachteiligungen und Zurücksetzungen des sozialen, familiären und beruflichen Da- seins. Nicht so der hassende Mensch: was ihm im Wege steht, gilt ihm als Majestätsbeleidigung, und die Maßnahmen, die er - wenn er kann - dagegen ergreift, sind das Wüten eines Pseudo- herrschers, dem man den Gehorsam verweigert hat. Stark ausgeprägter Haß ist demnach ohne Größenwahn im Hinter- grund kaum vorstellbar. Und dieser Größenwahn wirkt kompensatorisch: er be-
- 192
- schwichtigt die Wertlosigkeitsgefíihle, die am >Saum des Be- wußtseins« jedes Hassenden existieren. Hierzu hat er Grund genug. In der Liebe sah Max Scheler die Bewegung vom niederen zum höheren Wert hin; folglich wird man beim Haß voraussetzen dürfen, daß er ständig vom höheren Wert zum niederen tendiert. Er entdeckt picht >im Vollzug« die möglichen höheren Werte im Objekt, sondern ist fasziniert von den realen und eingebildeten negativen Werten, die er im Du findet oder in es hineininterpretiert. Alle Hassenden malen sich gleichsam ein düsteres Bild von der Welt. Sie glauben, gegen den Schmutz in der Welt zu kämpfen, aber sie beschmutzen sie eben erst, bevor sie in den Kampf ziehen: daher ihre Neigung zur »Anal- sprache«, zu Beschimpfungen und Verunglimpfungen, die Er- satzhandlung für stärkere Aggressionen sind oder diese ein- leiten. So hat der hassende Mensch seine liebe Not mit sich selbst und mit den Mitmenschen; er leidet an sich und an ihnen, was ungefähr der Definition von Psychopathie entspricht. Wo das Haßsyndrom deutlich ausgeprägt ist, sollen wir nach den übri- gen »psychopathischen« Merkmalen fahnden, die in unserem Sinne jedoch nicht als anlagebedingt, sondern als lebensge- schichtlich determiniert gelten sollen. Daß wir es hier mit Erscheinungen »außerhalb des Normalen« zu tun haben, beton- te schon Spinoza in seiner >Ethik< (IV, Lehrsatz 44, Anmerkung) sehr eindrücklich: Es gibt viele Menschen, denen ein und derselbe A f f e k t hartnäckig anhaftet. Denn wir sehen, wie Menschen zuweilen von einem Gegen- stand so affiziert werden, daß sie ihn, obgleich er nicht gegenwärtig ist, dennoch vor sich zu haben glauben; geschieht dies einem M e n - schen in wachem Zustande, so sagen wir, er sei v e r r ü c k t . . . Wenn jedoch der Habsüchtige an nichts anderes denkt als an Gewinn oder Geld, der Ehrgeizige nur an R u h m , so hält man diese nicht f ü r verrückt, sondern nur für unangenehm und verächtlich. In der Tat aber sind Habsucht, Ehrgeiz und so weiter Arten der Verrücktheit, obgleich man sie nicht den »Krankheiten« zuzählt. 5
- So ist auch der Hassende oft mit »Wahnwitz« geschlagen, da er leidenschaftlich und »fiebrig« an sein Objekt denkt und mit diesem bis in den Schlaf hinein seine Kämpfe ausficht. Der hassende Mensch hat meist aggressive und ängstliche Träume, und er muß Angst haben, weil er ständig von aggressiven Stimmungen beherrscht wird. Er ist nur äußerst selten ruhig
- 193
- und gelassen, und er wird gejagt von seiner >fixen Idee<, die seinen Haß auf einen bestimmten Menschen begleitet. In manchen Fällen kann sich der Haß bis zur >Monomanie< stei- gern, zu einer Art von Besessenheit. Sofern der Leib des Hassenden in seine Krankheit einbezogen ist, kommt es zu spezifischen psychosomatischen Symptomen. Gehäuft treten etwa Hypertonie, Geschwürkrankheiten (Ulcus duodeni et ventriculi) auf; auch Asthma bronchiale kann ein solches Symptom sein. Nur wäre es arg verfehlt, wenn man in jedem Falle solcher Erkrankungen einen zugrunde liegenden >Haß< vermuten würde; auch die anderen Affekte spielen in derartige Leiden hinein, und meistens sind es vielfältige Moti- vationssysteme, die in der >Psychosomatose< ihren Ausdruck finden. Wo immer Haß die dominierende Leidenschaft eines Menschen ist, müssen wir mit einem ernsten Defizit am Personsem rech- nen. Die Persönlichkeitsentwicklung des Menschen hängt in kaum zu überschätzendem Maße von seiner Fähigkeit zu lieben ab. Er kann nur so weit in seine Umwelt integriert werden, wie er lieben kann. Der Hassende jedoch ist nicht nur beziehungs- arm, sondern auch partiell oder gar total >weltlos<. Dement- sprechend verarmt seine Persönlichkeit, oder sie ist sogar nie richtig aufgebaut worden. Darum gibt es eigentlich keine »Freundschaft im Haß< (Freundschaft als personale Beziehung von Ich und Du), sondern höchstens die »Gemeinschaft der Hassendem, nämlich eine größere oder kleinere Gruppe, die zusammengekittet wird von gemeinsamen Affekten, Abneigun- gen und Destruktionsgelüsten. Partnerschaft im Haß imitiert lediglich emotionale Innigkeit. Aus allem Geschilderten sollte hervorgehen, daß Haß eine Verkrüppelung der menschlichen Natur darstellt, eine Krank- heit, die mehr als Angst oder Verzweiflung im Sinne Kierke- gaards eine »Krankheit zum Tode< bedeutet.
- Haß und Ressentiment
- Einer der bedeutendsten Psychologen auf dem Gebiet der Haßthematik war Friedrich Nietzsche, der allerdings seine Erkenntnisse zu diesem Problem unter dem Titel »Ressenti- ment abhandelte. Max Scheler, der in einer umfangreichen
- 194
- Untersuchung Nietzsches Thesen systematisierte, gibt folgende Definition: Ressentiment ist eine seelische Selbstvergiftung mit ganz bestimmten Ursachen und Folgen. Sie ist eine dauernde psychische Einstellung, die durch systematisch geübte Zurückdrängung von Entladungen gewisser Gemütsbewegungen und A f f e k t e entsteht, welche an sich normal sind und z u m Grundbestande der menschlichen N a t u r gehören, und die gewisse dauernde Einstellungen auf bestimmte Arten von Werttäu- schungen und diesen entsprechenden Werturteilen zur Folge hat. Die hier an erster Stelle in Betracht kommenden Gemütsbewegungen und A f f e k t e sind: Rachegefühl und -impuls, Haß, Bosheit, N e i d , Scheel- sucht, Hämischkeit. 6
- Nietzsches Ressentimentbegriff stammt aus seiner Kritik der christlichen Religion und Moral. In seinem Buch >Zur Genealo- gie der Moral< (1887) befaßte sich der Philosoph mit den soge- nannten »asketischen Idealem, d.h. jenen Wertmaßstäben, die in Zielsetzung oder Tendenz das Leben verneinen. Damit glaubte er die Rolle des Christentums in der europäischen Geistesgeschichte als verhängnisvoll entlarven zu können. Die Christen - in der Antike versklavt und verfolgt - inszenierten seiner Meinung nach einen >Sklavenaufstand in der Morah, indem sie die Werte der Demut, der Keuschheit, des Gehor- sams, der Unterwürfigkeit, der Armut und der Selbstverleug- nung predigten. Alle diese Ideale müssen als Kampfmittel der Sklaven gegen ihre Herren verstanden werden. Nach Nietzsche haben die »vornehmen Menschern des Alter- tums eine Moral gelebt und gelehrt, die sich auf aktive und expansive >Tugenden< gründete. Man bekannte sich ohne Rück- halt zur Sinnenfreude, zum Machtwillen, zur Begehrlichkeit, unter Umständen auch zu Gewalt und Herrschaft. Dies sei Ausdruck eines starken und siegesbewußten Lebensgefühls gewesen, das dort zustande kommt, wo soziale Stände oder Schichten sich an der Macht halten können. Nun beruhte aber die Gesellschaftsordnung der Antike auf Sklaverei, und die Zahl der Sklaven, die in absoluter Ohnmacht und Abhängigkeit vegetierten, war bei weitem größer als dieje- nige der Herren. Offenbar ertragen Menschen es schlecht, wenn sie unterdrückt und ausgebeutet werden. Es kommt immer zu offener oder heimlicher Auflehnung. Revolten er- schütterten gelegentlich das römische Imperium, doch die Chan- cen der Sklaven, ihre Ketten abzuwerfen, waren sehr gering.
- 5
- Aber der »indirekte Aufstand« hatte mehr Aussicht auf Erfolg und zog die Angstlichen, Schwachen und Mutlosen an. Nietz- sche vertritt die Lehre, nach der das Christentum in seinem Wesen eine solche >umwegige Revolution« gewesen sei. Die Christen vergällten den Sklavenhaltern ihre Lust an Schönheit, Macht, Sinnlichkeit und Lebensfreude, indem sie durch ihr Leben und Verhalten die gegenteiligen Werte propagierten. Da psychisches und soziales Chaos diese Phase des Umbruchs regierten, waren die Menschen reif für eine Botschaft, die ihnen die Erde als »Jammertal« schilderte und ihren Blick auf das »Jenseits« und das »Leben nach dem Tode« lenkte. Nietzsche bezweifelt radikal, daß die christliche »Nächstenlie- be« als »Liebe« gemeint war: vorherrschend in Denken und Handeln der Christen war der Haß gegen eine bestehende Welt, in die man sich nicht integriert fühlte. Deshalb wurde sie mit allen nur denkbaren Mitteln entwertet und angeschwärzt. Man erkenne das am »reaktiven Charakter« der verkündeten Ideale und Wertvorstellungen, in denen allzusehr der grimmige Mißmut und die Lebensverleugnung an den Tag drängen. So heißt es in Abschnitt 10 der ersten Abhandlung von >Zur Genealogie der Moral< u.a.: - D e r Sklavenaufstand in der Moral beginnt damit, daß das Ressenti- ment selbst schöpferisch wird und Werte gebiert: das Ressentiment solcher Wesen, denen die eigentliche Reaktion, die der Tat, versagt ist, die sich nur durch eine imaginäre Rache schadlos halten. Während alle vornehme M o r a l aus einem triumphierenden Ja-sagen zu sich selber herauswächst, sagt die Sklaven-Moral von vornherein nein zu einem »Außerhalb«, zu einem »Anders«, zu einem »Nicht-selbst«: und dies N e i n ist ihre schöpferische Tat. Diese Umkehrung des werte-setzen- den Blicks - diese notwendige Richtung nach außen statt zurück auf sich selber - gehört eben zum Ressentiment: die Sklaven-Moral be- darf, um zu entstehn, immer zuerst einer Gegen- und Außenwelt, sie bedarf, physiologisch gesprochen, äußerer Reize, um überhaupt zu agieren, - ihre A k t i o n ist von G r u n d aus Reaktion. 7
- Aus solchen rein »reaktiven Lebensvorgängen« kann nach Nietzsche nichts Lebensförderndes und Kulturschaffendes ent- stehen. Die Stärke des Ressentimentcharakters besteht allein in Verneinung und Herabsetzung; er pervertiert jede menschliche Regung, die von ihm Besitz zu ergreifen droht. Es ist ein kaum wiedergutzumachender Schaden für die Menschheitsentwick- lung, wenn die Unglücklichen, die am Leben Leidenden und
- 196
- die »Mißratenen« ihre »Wertmaßstäbe« durchsetzen können; meistens verschwören sie sich gegen gesunde und schöpferische Existenzen, die ihnen ein Dorn im Auge sind. Das ist nach Nietzsche der Sinn der »asketischen Ideale«, die mit dem Christentum in Europa zu dominieren begannen. Die zur Macht gelangte Kirche habe den unerbittlichen Kampf gegen alle menschliche Größe und Selbstverwirklichung aufgenom- men. Vor dem Jammerbild des gekreuzigten Heilands machte sie die Lebensfreude beinahe zum Sakrileg; die auf Armut, Keuschheit und Gehorsam verpflichteten Mönche wurden zu Idealen sittlicher Lebensführung emporstilisiert. Da hierdurch Sinnlichkeit, Lebensgenuß und Selbstverwirklichung in die Ka- tegorie der »Laster« fielen, wurden für zwei Jahrtausende die natürlichen Regungen und Bedürfnisse der Menschen »verteu- felt«; die Folge davon war, daß sich Natur oft genug in Unnatur und Perversion verwandelte. In den abschließenden Sätzen von >Zur Genealogie der Morah klagt Nietzsche das asketische Ideal als einen »Brunnenvergifter des Lebens« an und sagt: Man kann sich schlechterdings nicht verbergen, was eigentlich jenes ganze Wollen ausdrückt, das vom asketischen Ideale her seine Rich- tung bekommen hat: dieser H a ß gegen das Menschliche, mehr noch gegen das Tierische, mehr noch gegen das Stoffliche, dieser Abscheu vor den Sinnen, vor der Vernunft selbst, die Furcht vor dem Glück und der Schönheit, dieses Verlangen hinweg aus allem Schein, Wech- sel, Werden, T o d , Wunsch, Verlangen selbst - das alles bedeutet, wagen wir es, dies zu begreifen, einen Willen zum Nichts, einen Widerwillen gegen das Leben, eine Auflehnung gegen die grundsätz- lichsten Voraussetzungen des Lebens, aber es ist und bleibt ein Wil- le!... U n d , um es noch zum Schluß zu sagen, was ich anfangs sagte: lieber will noch der Mensch das Nichts wollen, als nicht w o l l e n . . . s
- Ubersetzt man diese kultur- und religionskritischen Auslassun- gen in die für uns interessante »Psychologie des Hasses«, dann wird man diesen als eine Art von Nihilismus begreifen, der sich gerne als »Dienst am Leben« maskiert, aber seinen Ursprung in der Verzweiflung am Leben hat. Was Nietzsche als Kulturpsychologe beschreibt, bezieht sich auf »großflächige« Phänomene, deren Beurteilung dem philoso- phischen und psychologischen Laien Mühe bereiten wird. Die- ser kann Ressentiments besser dort studieren, wo sie sich im Verhältnis von Individuum zu Individuum zeigen. Wir spre- chen in diesem Zusammenhang vom sogenannten Existenzial-
- 97
- neid: der zu kurz gekommene Mensch haßt seinen Mitmenschen nicht nur wegen bestimmter Eigenschaften, sondern weil er ist, wie er ist. Vor allem wird die >Lebensfülle< des anderen benei- det; sie macht die Armseligkeit des eigenen Daseins erst richtig bewußt. Das scheint Goethe im Sinn gehabt zu haben, als er schrieb:
- Was klagst du über Feinde? Sollten solche je werden Freunde, Denen das Wesen, wie du bist, Im stillen ein ewiger V o r w u r f ist? 9
- Man kann diesen Existenzialneid ungemein häufig bei individu- ellen und kollektiven Haßerscheinungen feststellen. Vor allem Probleme im >Kindheitsmilieu< bieten hierfür lehrreiche Bei- spiele; aber auch im Verhältnis von Liebespartnern zueinander können solche destruktive Regungen eine große Bedeutung haben. Hier müßte dem Hassenden der Goethesche Rat in Erinnerung gerufen werden: »Gegen große Vorzüge eines an- deren gibt es kein Rettungsmittel als die Liebe.« Ein erschütterndes Beispiel für ein solches Ressentiment gibt Herman Melville (1819-1891) in seiner Erzählung >Billy Budd<. Der schöne und liebenswürdige Matrose Billy wird vom Offi- zier Claggart »grundlos gehaßt< und aus purem Lebensneid der Meuterei bezichtigt - Billy wehrt sich dagegen mit einem Faustschlag, der Claggart tötet, Billy aber das Todesurteil bringt.
- Haß und Vorurteil
- Eine spezielle Form der Haßmanifestation ist das Vorurteil, welches eine kollektiv-psychologische Erscheinung ist, die aber auch in individueller Ausprägung vorkommt. Wir definieren das Vorurteil als ein ungünstiges Urteil über Personen und Sachen, das nicht auf Erfahrung basiert und aus affektiven Gründen sehr schwer korrigierbar ist. Vorurteile werden durch neue Erkenntnis kaum widerlegt; der Vorurteilsträger findet immer >Bestätigungen< für das, was er schon glaubt und für wahr hält. Vorurteile ergeben sich, wenn ein Mensch in bestimmten Gruppen heimisch und in anderen fremd ist. Die Andersartig-
- 198
- keit der anderen beunruhigt das Gemüt; auch kommt es aus geschichtlichen Gründen zu gegenseitigen Animositäten und Antipathien. Benachbarte Gruppen kennzeichnen einander gern mit Schwarzweißmalerei. Wert und Unwert der ingroup oder outgroup werden oft sehr ungerecht beurteilt. Es werden völlig irreale Kategoriebildungen propagiert, wobei oft gegen alle Evidenz der Fremdgruppe Eigenschaftskomplexe zuge- schrieben werden, die Haß und Verachtung verdienen. Die eigene Gruppe weist diese Mängel natürlich nicht auf und kann deshalb ohne weitere Differenzierung als über jede Kritik erha- ben akzeptiert werden. In der Geschichte der Menschheit haben vor allem nationale, rassische, religiöse und geschlechtsspezifische Vorurteile eine verhängnisvolle Rolle gespielt. Es kam zu Stereotypenbildung, die rein schematisch festlegte, wie der Angehörige der Neben- oder Gegengruppe beschaffen sei. Auf Grund autistischer Denkprozesse wurde hierbei die Realität bis zur Lächerlichkeit vereinfacht; alle spezifischen Eigenarten bestimmter Völker, Rassen, Nationen und Volksgruppen wurden auf das Prokru- stesbett einer vorgefaßten Negation gespannt, so daß Selbst- erhöhung auf Kosten dieser >Opfer< mühelos zu bewältigen war. Das Vorurteil argumentiert in primitiver Weise folgender- maßen: da die anderen schlecht oder böse sind und ich sie bekämpfe, muß ich jedenfalls >gut< sein! Die Tiefenpsychologie hat zur Vorurteilsforschung einige Kon- zepte beigetragen, die unseres Erachtens zum Verständnis des Hasses wertvoll sind. Es handelt sich um die Begriffe der Verdrängung, der Projektion, der Rationalisierung und der Abwehrmechanismen. i. Nach dem ursprünglichen Freudschen Theorem bedeutet Verdrängung die Nicht-Annahme von Triebregungen durch das Bewußtsein. Es wird einem Trieb die Zulassung zum bewußten Seelenleben verweigert, wobei eine Gegenbesetzung geschaffen wird, die den ständig drängenden und bedrängenden Vitalanspruch niederhält. Diese Konfliktlage führt zu mannig- faltigen Ersatzhandlungen und Reaktionsbildungen: der ver- leugnete Trieb hat die Möglichkeit, sich in Träumen, Fehllei- stungen, neurotischen Symptomen und Vorurteilen zur Gel- tung zu bringen. Die Verdrängung macht das Individuum allergisch gegen alles, was zur Aufhebung von Verdrängungen führen könnte. Selbst-
- 199
- verkennung, Grundvoraussetzung der Verdrängung, wird zur Quelle falscher Fremdeinschätzungen; die Wirklichkeit im Ganzen wird stark »subjektiv verkannt«. Wahrnehmung, Den- ken, Fühlen und Wollen unterliegen einer Deformation, die in extremen Formen wahnhaft anmutet. Auch ist die Kehrseite der Verdrängung ein merkwürdiges >Besessensein< von der jeweils verdrängten Regung. 2. Auf die Projektion kamen wir bereits weiter oben zu spre- chen. Hier sei nur noch erwähnt, daß feindselige Gemütsregun- gen besonders häufig projiziert werden. Wer Haß, Mißtrauen, Aggression und Wut in sich trägt, wird unwillkürlich seine gesamte Umwelt dieser Affekte und Emotionen wegen beschul- digen. 3. Rationalisierung zeigt die Korrumpierbarkeit des Intellekts, wenn in den tieferen Schichten der Persönlichkeit Unruhe und Chaos vorherrschen. Man bemäntelt die eigenen Fehler und rechtfertigt sie mit einer >Privatlogik<, die vom »gesunden Men- schenverstand« erheblich abweicht und seltsame Wege des Den- kens und Fühlens beschreitet. Rationalisierung als Selbstbetrug verweist auf eine grundlegende »Lebenslüge«, die die Selbst- achtung mit fadenscheinigen Gedankenoperationen aufrechter- halten will. 4. Als Ahwehrmechanismen haben Sigmund Freud und Anna Freud vor allem Scham, Ekel, Angst und Moral beschrieben. Alle diese psychischen Instanzen gelten als Schutzmaßnahmen des Ichs gegen die bedrohliche Überrumpelung durch nicht akzeptierte Triebregungen. Man kann es aber auch anders definieren: die Abwehrmechanismen sind die letzten Bastionen des Ichs in seiner Selbstbehauptung, und zwar nicht nur ange- sichts der »innerpsychischen« Triebe, sondern auch der Um- welt: je größer die Ichschwäche, um so mehr affektgeladene Abwehr gegen die Welt der Menschen und Dinge. Die meisten Vorurteile findet man bei der sogenannten »autori- tären Persönlichkeit«, die Horkheimer, Adorno, Flowerman und andere eingehend erforscht haben (>The Authoritarian Per- sonality < y New York 1950). Diese Soziologen und Psychologen bewiesen die »Einheitlichkeit« des »autoritären Weltbildes«, in- dem sie an einer beachtlichen Zahl von Versuchspersonen die Verflechtung verschiedener ethnischer, politischer, ökonomi- scher und rassischer Vorurteile statistisch ermitteln konnten. Auch fanden sie beim autoritären Menschentyp:
- 200
- a) Angst vor Gefühlsaustausch b) Überwiegen von Verdrängungen c) Mangel an Selbsterkenntnis d) Selbstidolatrie und Humorlosigkeit e) Unduldsamkeit gegenüber komplexen Zusammenhängen (für alles gibt es stets nur eine Lösung) f) Rigidität (Starrheit im Denken und Urteilen) g) Angst vor Neuerungen h) autistisch-undiszipliniertes Denken i) Neigung zur Analsprache (Kot, Schmutz in Verbindung mit dem Objekt des Vorurteils) j) Dschungelphilosophie (Meinung, daß in der Welt der >Kampf aller gegen alle< herrsche). Spätere Untersuchungen unterschieden noch zwischen den so- genannten extra-, intro- und impunitiven Menschen. Extrapu- nitiv werden jene genannt, die Frustrationen im Leben durch Bestrafung anderer abreagieren; intropunitiv jene, die sich seihst bestrafen; der impunitive Typ bestraft niemanden, son- dern sucht die Lösung des frustrierenden Problems, die zu finden er auch unter den drei Typen die größten Chancen hat. Der impunitive Mensch scheint in unserer Kultur der seltenste Typ zu sein. In der Haßthematik spielt der extrapunitive Typ die wichtigste Rolle, wobei auch der intropunitive nicht vernachlässigt wer- den darf. Es besteht nämlich die begründete Vermutung, daß derjenige, der extrapunitiv ist, auch unter entsprechenden Um- ständen zur Intropunition bereit ist. Wer andere anzuklagen fähig ist, wird auch sich selbst hart und unnachsichtig behan- deln. Es besteht offenbar eine einheitliche >punitive Weltan- schauungs die bei allen Unzulänglichkeiten des Daseins nach Schuldigen sucht, sich selbst nicht ausgenommen. So gibt es Menschen, die immer auf der Jagd nach >Sündenbök- ken< sind, wenn individuelle oder kollektive Schwierigkeiten auftauchen, die sie mit ihrer eingeschränkten Vernunft gedank- lich nicht durchdringen können. Im Haß liegt eine Kapitulation vor der Logik; es geht nur noch darum, durch einen Affekt- rausch die wahre Notlage zu vergessen und sich auf Kosten von meistens wehrlosen Opfern in Omnipotenzgefühle hinein- zusteigern. Besonders schwer gestörte Charaktere sind zu sol- chen psychischen Funktionsentgleisungen tauglich; sie spielen daher in politisch-ökonomischen Krisenzeiten eine verhängnis-
- 201
- volle Rolle, da sie die verwirrte Masse zu eigentlichen »Haßor- gasmen« anleiten, die als problemlösend mißverstanden wer- den. Man denke etwa an Ernst Kretschmers weises Wort über die Psychopathen, die wir in normalen Zeiten begutachten, indes sie uns in epochalen Krisen zu beherrschen pflegen. Auch Sartre sagt in >Betrachtungen zur Judenfrage<, der Hassende weiche in seiner Angst vor dem Ich und vor der Wahrheit in die »Starrheit des Felsblockes« aus; er will dann eine »Naturgewalt« und nicht mehr ein »Mensch« sein.
- Haß und Neurose
- Es mag auf den ersten Blick verblüffen, daß auch die Neurose zum Haß in Beziehung gebracht wird; mutet doch der neuroti- sche Patient für den oberflächlichen Betrachter (und auch in seiner Selbsteinschätzung) vornehmlich als »Leidender« an: wie sollte er da die »Kraft zum Hassen« aufbringen? Wir haben aber bereits im Zusammenhang mit dem tiefenpsychologischen Ver- ständnis der Depression darauf hingewiesen, daß Selbstbezich- tigungen, Schuldgefühle und sogar Selbstvernichtungstenden- zen eine verborgene Aggression gegen die Umwelt enthalten können. So wäre es durchaus möglich, daß jede Neurose von einer Kampfstimmung gegen das Leben und die Mitmenschen getragen wird. Schon in der Kindheit erzeugt der Haß neurotische Symptome, die wir großenteils »Kinderfehler« (Bettnässen, Trotz, Nägel- beißen, Daumenlutschen, Eß-Störungen, Sprechhemmungen, nächtliche Angst, Verwahrlosung usw.) nennen. Diese Sym- ptomatik tritt in der Regel auf, wenn das Kind mit seinen Eltern uneins ist und sich von ihnen nicht verstanden oder angenom- men fühlt. Das Symptom entsteht, weil soziale Einfügung und innere und äußere Weiterentwicklung nicht erreicht wurden; es ist eine Revolte gegen Bedingungen, die das Kind nicht akzep- tieren kann. Oft wird die Verdrängung aus einer Mittelpunkt- stellung (»Entthronungserlebnis«) durch ein nachgeborenes Kind zum Anlaß der Symptomentstehung; der Haß gegen den Rivalen in der Gunst der Eltern kleidet sich dann in die verwandten Gefühle von Neid und Eifersucht, die das Lebens- glück des Kindes zerstören. Die Psychoanalyse befaßte sich vor allem mit dem Vaterhaß des
- 202
- heranwachsenden Knaben und dem Mutterhaß des Mädchens (Odipus- oder Elektrasituation). Sie postulierte, daß der Knabe die Mutter allein besitzen wolle und den Vater als Rivalen empfinde (analog ist es beim Mädchen). Es ist sehr zweifelhaft, ob dies ein »natürliches Durchgangsstadiurm der kindlichen Seelenentwicklung ist. Viele Autoren sprechen davon, daß derartige Antagonismen nur zustande kommen, wenn Mutter und Vater mit sehr verschiedenen Erziehungsstilen operieren. Ist etwa der Knabe von der Mutter verwöhnt worden, und will der Vater dieser Verzärtelung durch Strenge und Forderungen Grenzen setzen, wird das Kind in ihm einen Feind sehen, der die von der mütterlichen Erziehung geförderten Wünsche nach Verwöhnung frustriert. Damit wäre der Haß gegen den gleich- geschlechtlichen Elternteil das Kunstprodukt einer verwirrten und verwirrenden Pädagogik, mutmaßlich auch das Resultat der patriarchalischen Lebensordnung, die die Mütter infantili- siert und die Väter verhärtet. Richtig scheint allerdings die psychoanalytische These, daß dem Übergang von der Mutter zum Vater (und zur Welt) in der kindlichen Persönlichkeitsentfaltung eine große Bedeutung zu- kommt. Die väterliche Rolle in unserer Gesellschaft impliziert oft das Berufsethos, das Realitätsprinzip und die Übernahme von sozialer Verantwortung. Hat das Kind zu große Mühe, den Vater innerlich zu assimilieren, bleibt es oft in einer Wunsch- und Traumwelt gefangen, von der nur schmale Wege in die Wirklichkeit zurückführen. Wer am Vater scheitert, scheitert nicht selten auch später am Leben. Natürlich wird all dies schon durch ein chaotisches Mutterverhältnis eingeleitet, für welches das Stichwort >Verzärtelung< zu wenig Aufschluß gibt. Generell läßt sich sagen, daß spätere Neurotiker in der Kind- heit einen Elternteil oder beide Eltern mehr haßten als liebten und daher >auf sich selbst zurückgeworfem wurden. Daraus entspringt der Egozentrismus der Neurose, der eine der Grund- lagen für gesteigerte Lebensangst und soziale Ungeschicklich- keit ist. In Freuds dritter Trieblehre aus dem Jahre 1920 ( Jenseits des Lustprinzips<) wird die Neurose >metapsychologisch< auf die >Entmischung< der beiden Grundtriebe des Seelenlebens - des Eros und des Todestriebs - zurückgeführt. Hat ein Kind während seines Heranwachsens nicht genug Liebe empfangen (die immer auch mit Verständnis verbunden sein muß!), kann
- 203
- es nach Freuds metaphysischer Ausdrucksweise die destrukti- ven Energien des >Selbstvernichtungstriebs< nicht neutralisie- ren und sinnvoll nach außen ableiten (in Arbeit und soziale Zuwendung). So bleibt ein Destruktionspotential im Innern erhalten^ wo es ängstliche und aggressive Seelenregungen aus- löst und sich auch in psychische und psychosomatische Sym- ptome umsetzt. Streicht man von diesem Konzept das mytho- logische Beiwerk, dann bleibt die Einsicht, daß der Mensch körperlich und seelisch nur dann gut funktioniert, wenn er liebt und handelt (im konstruktiven Sinne); Lieblosigkeit aber macht krank und ist auf die Dauer sogar >tödlich<. Auch die psychotherapeutische Praxis zeigt deutlich genug, daß Neurotiker weniger gut lieben als hassen können. Viele von ihnen haben das Partnerschaftsproblem nicht oder nur schlecht gelöst. Sie leben einsam vor sich hin oder sind als Erwachsene noch irgendwie im Schlupfwinkel der elterlichen Familie hei- misch; haben sie eine Partnerschaft, dann ist diese oft eine »Einsamkeit zu zweit<, nicht ein Aufeinanderbezogensein. Die »Kunst des Liebens< hat der Neurotiker nicht gelernt. Das erfährt auch der Psychotherapeut im Verlaufe der Behand- lung, wenn er nach und nach sein Gegenüber »auftauen* und zu einer »wohlwollend-produktiven Zusammenarbeit* motivieren will. Der Patient ist häufig mißtrauisch, unkooperativ, stör- risch und negativ gestimmt. Dies wird in der Therapie als »Widerstand* registriert, und oft beginnen die Widerstands- manöver unmittelbar nach Beginn der Behandlung. Besonders in während der Therapie auftretenden Krisen werden starke Af- fekte mobilisiert, die den ärztlichen Helfer in den Augen des Hilfsbedürftigen als Feind und Widersacher erscheinen lassen. Die Tiefenpsychologie spricht in diesem Zusammenhang vom »Ubertragungsphänomen* und meint, daß der Patient Gefühle, die irgendwelchen Bezugspersonen aus seiner Frühsozialisation galten, nunmehr unkritisch auf seinen Seelenarzt »überträgt*. Abgesehen von diesen Reminiszenzen aus dem gesamten »Wer- densverlauf* spielen hier aber auch reale
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement