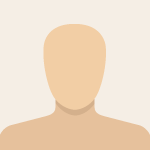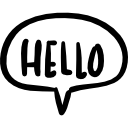Advertisement
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- Ein egalitärer Alptraum
- Diese Sorge spielt Kurt Vonnegut in seiner Kurzgeschichte »Harrison Bergeron« als negative Utopie durch. »Man schrieb das Jahr 2081«, beginnt die Story, »und alle waren endlich gleich (…). Niemand war schlauer als irgendein anderer. Niemand sah besser aus als der andere. Niemand war stärker oder schneller als der andere.« Diese durchgängige Gleichheit wurde von Vertretern des Zentralen Störungsausgleichs durchgesetzt. Bürger, die mit einer überdurchschnittlichen Intelligenz geschlagen waren, hatten einen kleinen geistigen Störsender im Ohr zu tragen. Ungefähr alle 20 Sekunden sandte der Sender ein scharfes Geräusch, um Leute wie G. davon abzuhalten, »dass sie aus ihren Geistesgaben einen unfairen Nutzen zogen«.15
- Der 14-jährige Harrison Bergeron ist ungewöhnlich intelligent, hübsch und begabt, weshalb er mit schwereren Handicaps versehen wird als die meisten anderen. Statt des kleinen Ohrsenders »trug er ein riesiges Paar Kopfhörer und eine Brille mit dicken, gewellten Linsen.« Um sein gutes Aussehen zu verbergen, verlangte man, dass Harrison ständig »einen roten Gummiball als Nase trug, seine Augenbrauen abrasierte und seine ebenmäßigen weißen Zähne mit unregelmäßig hervorstehenden schwarzen Kappen überzog.« Um seine körperliche Stärke auszugleichen, musste er beim Gehen schwere Metallgewichte tragen. »Während er um sein Leben rannte, trug Harrison ein Gewicht von 300 Pfund.«16
- Eines Tages, in einem Akt heroischen Widerstandes gegen die egalitäre Tyrannei, wirft Harrison seine Behinderungen ab. Um der Story nicht die Pointe zu nehmen, verrate ich nicht, wie sie ausgeht. Doch es sollte bereits deutlich geworden sein, wie Vonneguts Story eine vertraute Klage gegen egalitäre Theorien der Gerechtigkeit veranschaulicht.
- Doch auf Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit trifft dieser Einwand nicht zu. Er zeigt, dass nivellierende Gleichheit nicht die einzige Alternative zu einer meritokratischen Marktgesellschaft ist. Seine Alternative, die er das »Unterschiedsprinzip« nennt, korrigiert die ungleiche Verteilung von Talenten und Voraussetzungen, ohne die Befähigten zu behindern. Wie das? Ermutige die Begabten, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und auszuüben, aber mit der Übereinkunft, dass die Belohnungen, die diese Talente auf den Märkten einfahren, der Gemeinschaft insgesamt gehören. Behindere die besten Läufer nicht; lasse sie laufen und ihr Bestes geben. Vereinbare aber vorher, dass die Gewinne nicht ihnen allein gehören, sondern mit denen geteilt werden sollten, denen ähnliche Gaben fehlen.
- Obwohl das Unterschiedsprinzip keine gleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen fordert, drückt die ihm zugrunde liegende Theorie eine starke, wenn nicht gar inspirierende Vision von Gleichheit aus:
- Das Unterschiedsprinzip bedeutet faktisch, dass man die Verteilung der natürlichen Gaben in gewisser Hinsicht als Gemeinschaftssache betrachtet und in jedem Falle die größeren sozialen und wirtschaftlichen Vorteile aufteilt, die durch die Komplementaritäten dieser Verteilung ermöglicht werden. Wer von der Natur begünstigt ist, sei es, wer es wolle, der darf sich der Früchte nur so weit erfreuen, wie das auch die Lage der Benachteiligten verbessert. Die von der Natur begünstigt Bevorzugten dürfen keine Vorteile haben, bloß weil sie begabter sind, sondern nur zur Deckung der Kosten ihrer Ausbildung und zu solcher Verwendung ihrer Gaben, dass auch den weniger Begünstigten geholfen wird. Niemand hat seine besseren natürlichen Fähigkeiten oder einen besseren Startplatz in der Gesellschaft verdient. Doch das ist natürlich kein Grund, diese Unterschiede zu übersehen oder gar zu beseitigen. Vielmehr lässt sich die Grundstruktur so gestalten, dass diese Zufälle auch den am wenigsten Begünstigten zugute kommen.17
- Sehen wir uns nun die vier konkurrierenden Theorien der Verteilungsgerechtigkeit an:
- Feudal- oder Kastensystem: starre, auf Geburt beruhende Hierarchie
- Libertarianisch: freier Markt mit formaler Chancengleichheit
- Meritokratie: freier Markt mit fairer Chancengleichheit
- Egalitär: Rawls’ Unterschiedsprinzip
- Rawls bringt vor, die ersten drei Theorien begründeten distributive Anteile mit rein willkürlichen Faktoren – seien dies nun der Zufall der Geburt, soziale oder wirtschaftlicher Vorteile oder natürliche Begabungen und Fähigkeiten. Allein das Unterschiedsprinzip vermeide es, die Verteilung von Einkommen und Vermögen auf diese Kontingenzen zu gründen.
- Obwohl das Argument der moralischen Willkür nicht vom Argument des Urzustands abhängt, ähnelt es ihm in folgender Hinsicht: Beide halten daran fest, dass wir, wenn wir über Gerechtigkeit nachdenken, Zufälligkeiten aller Art ignorieren sollten.
- Einwand 1: Anreize
- Rawls’ Begründung für das Unterschiedsprinzip zieht zwei wesentliche Einwände auf sich. Erstens: Wie steht es mit Anreizen? Wenn die Begabten nur unter der Bedingung von ihren Gaben profitieren können, dass auch die am wenigsten Begünstigen einen Vorteil davon haben: Was ist, wenn sie beschließen, weniger zu arbeiten oder ihre Fähigkeiten gar nicht erst zu entwickeln? Wenn die Steuersätze hoch oder Lohnunterschiede gering sind, würden begabte Leute, die vielleicht Chirurg hätten werden können, dann nicht weniger anspruchsvolle Arbeitsbereiche vorziehen? Würde Michael Jordan dann nicht weniger intensiv an seinem Sprungwurf arbeiten oder seine Karriere früher beenden?
- Darauf erwidert Rawls, das Unterschiedsprinzip lasse Einkommensunterschiede um der Anreize willen zu, vorausgesetzt, die Anreize seien notwendig, um das Los der am wenigsten Begünstigten zu verbessern. Vorstandsvorsitzenden mehr zu bezahlen oder die Besteuerung Wohlhabender zu verringern, um das Bruttoinlandsprodukt zu steigern, würde nicht genügen. Wenn die Anreize aber ein Wirtschaftswachstum erzeugen, das den Armen ein besseres Leben ermöglicht als bei einer egalitäreren Struktur, dann sind sie nach dem Unterschiedsprinzip erlaubt.
- Von besonderer Bedeutung ist hier, dass es einen Unterschied macht, ob Lohndifferenzen mit der Notwendigkeit von Anreizen begründet werden oder ob man sagt, die Erfolgreichen hätten ein moralisches Anrecht auf eine höhere Bezahlung. Rawls zufolge sind ungleiche Einkommen nur insofern gerechtfertigt, als sie Anstrengungen wachrufen, die letztlich auch den Benachteiligten zugutekommen, nicht aber, weil Vorstandsvorsitzende oder Sportstars es verdienen, besser bezahlt zu werden als Fabrikarbeiter.
- Einwand 2: Anstrengung
- Damit kommen wir zu einem zweiten, schwerer wiegenden Einwand gegen Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit: Wie steht es mit dem persönlichen Einsatz? Rawls verwirft die meritokratische Theorie der Gerechtigkeit mit der Begründung, die Menschen seien für ihre natürlichen Gaben nicht selbst verantwortlich. Aber wie verhält es sich mit der Arbeit, die man darauf verwendet, seine Gaben zu kultivieren? Bill Gates hat lange und hart daran gearbeitet, Microsoft zu einer erfolgreichen Firma zu machen. Michael Jordan verwandte unendlich viele Stunden darauf, seine Geschicklichkeit im Basketball zu verbessern. Verdienen sie nicht die Belohnungen, die ihre Anstrengungen einbringen – ungeachtet ihrer Talente und Gaben?
- Auf solche Einwände erwidert Rawls, dass auch die Fähigkeit, sich anzustrengen, das Ergebnis einer günstigen Erziehung sein könne. »Selbst die Bereitschaft zum Einsatz, zur Bemühung, die im gewöhnlichen Sinn verdienstvoll ist, hängt noch von günstigen Familienumständen und gesellschaftlichen Verhältnissen ab.«18 Wie andere Erfolgsfaktoren werde auch unsere Fähigkeit zur Selbstdisziplin durch Zufälligkeiten beeinflusst, für die wir selbst nichts könnten. Es dürfte auf der Hand liegen, »dass der Einsatz, zu dem jemand bereit ist, von seinen natürlichen Fähigkeiten und den ihm offenstehenden Möglichkeiten abhängt. Die Begabteren werden unter sonst gleichen Umständen mehr gewissenhaftes Bemühen an den Tag legen (…).«19
- Wenn ich meine Studenten mit Rawls’ Argumentation zur Arbeitsmoral konfrontiere, protestieren viele energisch. Sie sagen, ihre Erfolge einschließlich der Zulassung für Harvard seien das Ergebnis der eigenen harten Arbeit und nicht moralisch willkürlichen Faktoren geschuldet, auf die sie keinen Einfluss hätten. Eine Theorie der Gerechtigkeit, die nahelegt, dass wir die Belohnungen für unsere Anstrengung moralisch nicht verdienen, betrachten sie mit Misstrauen.
- Im Anschluss an die Debatte führe ich regelmäßig eine nichtrepräsentative Umfrage durch. Ich verweise darauf, dass Psychologen behaupten, die Reihenfolge der Geburt habe Einfluss auf die Neigung, sich anzustrengen – etwa um in Harvard aufgenommen zu werden. Die Erstgeborenen würden angeblich eine stärkere Arbeitsmoral an den Tag legen, mehr Geld verdienen und auch sonst erfolgreicher sein als ihre jüngeren Geschwister. Diese Studien sind umstritten, und ich weiß nicht, ob ihre Befunde zutreffen. Doch zum Spaß frage ich meine Studenten, wie viele von ihnen Erstgeborene sind. Etwa 75 bis 80 Prozent heben die Hand. Das Ergebnis ist bislang bei jeder Umfrage gleich ausgefallen.
- Niemand behauptet, Erstgeborene seien für ihren Status selbst verantwortlich. Wenn aber etwas so Willkürliches wie die Reihenfolge der Geburt unsere Neigung zu harter Arbeit und bewusster Anstrengung beeinflussen kann, dann dürfte Rawls nicht ganz unrecht haben. Selbst unsere Anstrengung kann nicht die Grundlage moralisch gerechtfertigter Meriten sein.
- Die Behauptung, Menschen hätten die aus Anstrengung und harter Arbeit hervorgehenden Belohnungen verdient, ist aus einem weiteren Grund fragwürdig: Obwohl Verfechter der Meritokratie oft die Vorzüge der Anstrengung anführen, glauben sie nicht wirklich, dass Anstrengung allein die Grundlage von Einkommen und Wohlstand sein sollte. Nehmen wir zwei Bauarbeiter. Einer ist muskulös und kräftig und kann pro Tag vier Wände hochziehen, ohne in Schweiß auszubrechen. Der andere ist dürr und schwach und kann höchstens zwei Ziegelsteine auf einmal tragen. Obwohl er sehr hart arbeitet, braucht er eine Woche, um zu erledigen, was sein muskulöser Kollege locker an einem Tag schafft. Kein Vertreter der Meritokratie würde sagen, der schwache, aber schwer schuftende Arbeiter verdiene eine höhere Bezahlung als der starke, weil er sich mehr anstrenge.
- Oder nehmen wir Michael Jordan. Gut, er hat hart trainiert. Doch manche weniger begabten Basketballspieler trainieren noch härter. Niemand würde behaupten, sie hätten als Belohnung für die endlosen Stunden in der Turnhalle einen besseren Vertrag verdient als Jordan.
- Demnach ist es eigentlich die Leistung, die nach Ansicht des Meritokraten belohnt werden sollte. Ob wir für unsere Arbeitsmoral nun selbst verantwortlich sind oder nicht – unsere Leistung hängt zumindest teilweise von natürlichen Begabungen ab, auf die wir keinen Einfluss haben.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement